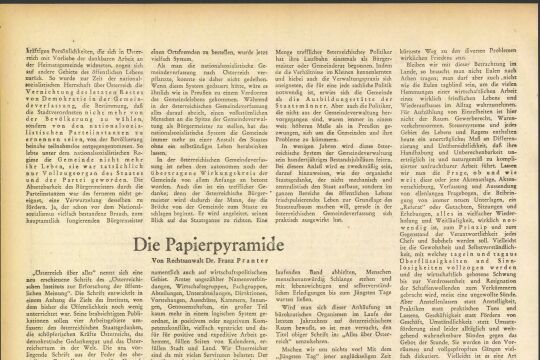In den National-, Landes- und Stadtmuseen quillt das 19. Jahrhundert aus allen Depots, doch die letzten Jahrzehnte fehlen. Welche Objekte stehen für "kollektive" Erfahrungen der Gegenwart? Was soll nach welchen Kriterien gesammelt werden?
Man kann ja nicht in einen Supermarkt gehen und alle Produkte kaufen, um sie dann ins Museumsdepot zu schleppen". Wenn über die künftige Sammlungspolitik von Universalmuseen diskutiert wird, fällt häufig dieser Satz - und zu Recht. Museumssammlungen wären nichts anderes als hoch subventionierte Varianten des Messy-Syndroms, würden sie ungefiltert die sich rasend vermehrenden und immer vielfältigeren materiellen Lebenszeugnisse in den Bau schleppen. Ihre kulturelle Mehrleistung sollte im Filtern bestehen, im Erarbeiten von Sammlungs-Strategien, um der Zukunft Relevantes zur zu hinterlassen. Seit unter Kulturwissenschaftlern Einigkeit besteht, dass nicht nur "hohe" Objekte relevant sind, sondern auch Zeug aus dem Supermarkt (oder eine Aufschrift aus einem Polizei-Wachzimmer) geeignet sein kann, Lebensformen, Machtverhältnisse oder kollektive Stimmungslagen zu bezeugen, wird es aber immer schwieriger, "Relevanz" im Hinblick auf Museums-Sammlungen zu definieren.
Radikal selektiv
Was ist "relevant" oder "signifikant", in welchen Objekten bündelt sich "kollektive" Erfahrung? Und in welchen die wohl ebenso relevante abweichende oder minderheitliche? Soll die Form der Objekte die Auswahl leiten oder doch eher ihre soziale Einbettung in den Alltag? Gilt es, auch dem Typischen nachzuspüren oder soll man eher das Außergewöhnliche ins Museum bringen, in der Hoffnung, damit auch das "Allgemeine" in höchster Konzentration vor sich zu haben? Man wird in jedem Fall Kriterien brauchen, weil weder Zufälligkeit noch Resignation gute Partner sind, um das von allen Museumsgesetzen zu Recht eingeforderte "Sammeln" (im Sinn von Weitersammeln!) sinnvoll zu betreiben.
Bei einer Enquete über "Stadtmuseen im 21. Jahrhundert", die 2002 im Zusammenhang mit der Reformdebatte um die Museen der Stadt Wien stattfand, sprach ich davon, dass man in nächster Zeit verstärkt "mit Strategien einer radikalen, genau begründeten Selektivität arbeiten" werde müssen. Das Stichwort "radikale Selektivität" wurde, vielleicht weil es angesichts der drohenden Unübersichtlichkeit beruhigend wirkt, sofort aufgegriffen. Seither muss ich, inzwischen als Museumsdirektor für ein Sammlungsuniversum aus reichhaltigen, alle Depots sprengenden und unüberschaubaren Spezialsammlungen zuständig, eine vielleicht allzu griffige Formel in die Pragmatik des Museumsalltags übertragen. Folglich ist die Erarbeitung einer "künftigen Sammlungsstrategie" für das neue Wien Museum (vormals: Historisches Museum der Stadt Wien) zu einem zentralen Zukunftsthema geworden. Es gilt schließlich, mit dem Sammeln endlich in die Nähe der Gegenwart zu kommen. Deshalb wird die jüngste Vergangenheit Sammlungsschwerpunkt sein müssen - vielleicht auf Kosten des in unseren Sammlungen dominant 19. Jahrhunderts. Das entscheidende Kriterium - um nicht zu sagen: die Kampfzone - wird angesichts voller und die Kräfte bindender Depots die Haltung zum Weitersammeln sein. Vielleicht wird man sogar von einem partiellen Neubegründen des musealen Sammelns sprechen müssen.
In vielen großen National-, Landes- oder Stadtmuseen ist ja im mittleren 20. Jahrhundert ein Beobachtungs- und Sammlungsloch entstanden, eine sich gefährlich öffnende Schere zwischen Depotbestand und aktuellen Entwicklungen. Demografen würden sagen: Viele Sammlungsbestände sind überaltert, es fehlt ihnen an Jugendlichen, Kindern und Neuzuziehenden. Energien und Mittel wurden allzu lange primär für die ehrenvolle Betreuung der Senioren beansprucht, obwohl auch das Altenversorgungssystem irgendwann einmal implodierte, weil die Stauräume übergingen und man mit dem Inventarisieren kaum nachkam.
Sammelwut wird mutlos
Die Krise des Sammelns steckt aber schon in jenen wissenschaftlichen Begründungen, die im systematischen Ordnungsdenken des 19. Jahrhunderts wurzeln. Es wurde die Möglichkeit imaginiert, nach streng positivistischer Ordnung zu einem sinnvollen Ganzen zu kommen (ein quasi administrativer Denkansatz, dem auch eine beamtenmäßige Organisation der Museen entsprach). Heute wissen wir, wie viel Wichtiges früher aus genau dieser hierarchischen Systematik heraus nicht gesammelt, ja sogar gezielt ausgesperrt wurde. Irgendwann wurde aus Sammelwut also Mutlosigkeit, und bedeutende Sammlungen verloren den Anschluss an die Gegenwart.
Dafür gibt es etliche Gründe. Vielleicht hatten die Museumsleute eine gewisse Scheu, zunehmend mit Objekten umgehen zu sollen, die gewissermaßen unter ihrem Niveau waren, weil es galt, immer neue Alltagsschichten ("Trash") und subalternere soziale Erfahrungen in den Blick zu bekommen. Es mag auch Kompetenzgrenzen, etwa bei der Einbeziehung neuer Medien und Materialien, gegeben haben. Die Museen standen mit ihrem Beobachtungsdefizit nicht allein da: Auch die universitäre Zeitgeschichte konzentrierte sich auf die in Daten und Informationen zu verhandelnde politische Ereignisgeschichte, bevor sie zögernd auch Phänomene einer breiten visuellen Kultur oder die Bedeutung sich langsam verändernder Mentalitäten und alltäglicher Verhaltensmustern (Wohnen, Konsum, Freizeit, Tourismus u.v.a.) zu bearbeiten begann. Es sind genau diese Themenfelder, die in Bibliotheken, Archiven und auch Museen mit Grauzonen des Sammelns und Bewahrens zu rechnen haben.
Und da war ein weiterer Grund für die offenbar systematische Blindheit vieler Sach-Museen gegenüber dem sowieso beklemmenden Reliktanfall einer Überflussgesellschaft: Man geriet in Konkurrenz mit einer nach immer neuen Erweiterungen gierenden Kunstpraxis. Seit Daniel Spoerris Fixierung von Speiseresten, Andy Warhols Fotokopie-Blick auf die Wirklichkeit oder den Materialsammlungen von alltagsarchäologischen "Spurensicherern" wie Christian Boltanski hat die Bildende Kunst keinerlei Problem mehr damit, "draußen im Leben" gefundenes Zeug mit oder ohne Methode ins Museum zu holen und dort zu Assemblagen oder Installationen zu gruppieren, die den Angeboten traditioneller Sachmuseen erstaunlich ähnlich sind. Wenn die Kunst buchstäblich alle Alltagsobjekte exzessiv poetisiert, müssen sie als als herkömmliches Sammelgut geradezu banal wirken.
Kunst oder Museumsobjekt?
Ganz heikel wird es, wenn brave Museumsleute, vom Primat der Kunst in Museumsdingen irritiert, die Methoden der Kunst zu imitieren versuchen. Dennoch wird man, um selektiv und somit abgrenzbar sammeln zu können, mit Methoden wie Serie, Längsschnitt, Vergleich, Clusterbildung, Tiefenbohrung auf kleinem Raum oder poetische Häufung arbeiten müssen. Es wird darum gehen, die Selektivität gut zu begründen. So wird das Sammelmotiv zum integralen Teil des musealisierten Objekts, sollten doch mit jedem Gegenstand stets auch Informationen über dessen Leben vor dem Museumstod gesichert werden. Das hat auf das Sammeln von Objekten aus den eben durchlebten Jahrzehnten ökonomische Konsequenzen: Das Sammelgut ist relativ billig, ja sogar kostenlos, wenn man Firmen, Ämter oder Private strategisch einbezieht. Aber der intellektuelle Bearbeitungsaufwand wird drastisch zunehmen. Genau so verstehe ich den Passus im Wiener Museumsgesetz, wonach neben dem traditionellen Erwerb dem Sammeln von Informationen vermehrte Bedeutung zukommt.
Der Autor ist Direktor der Museen der Stadt Wien.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!