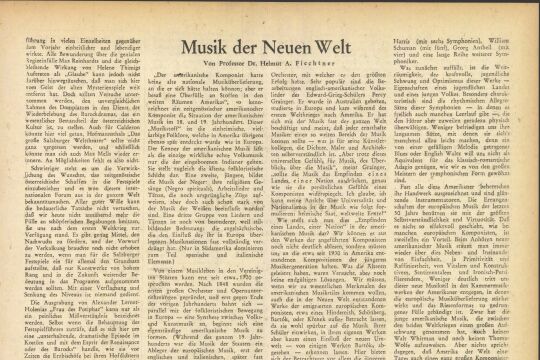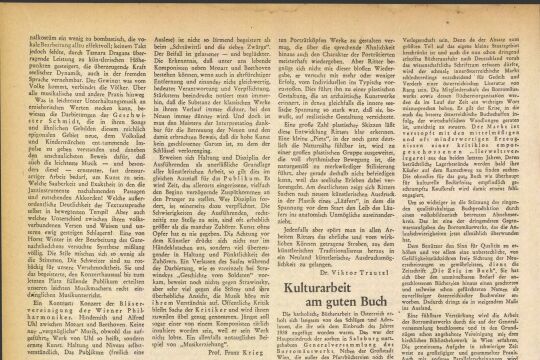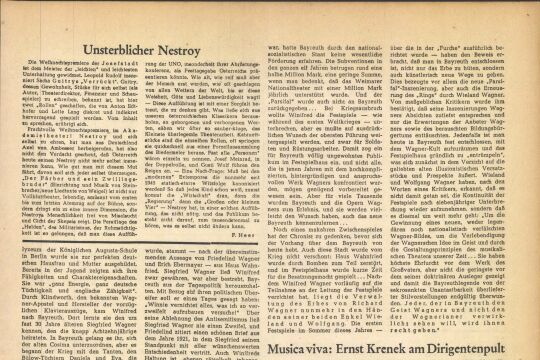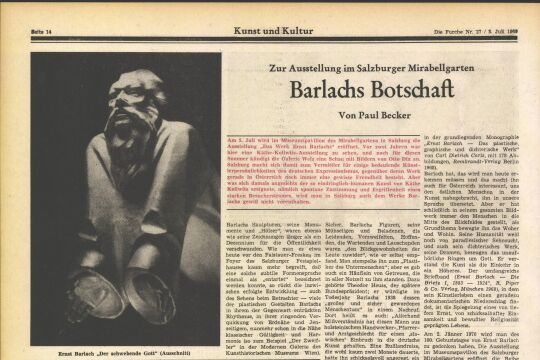Ernst Kreneks Oper "Jonny spielt auf" erstmals seit 1927 wieder an der Wiener Staatsoper.
Sie ist wohl die einzige Zigarettenmarke der Welt, die nach dem Titelhelden einer zeitgenössischen Oper benannt wurde: "Jonny". Ernst Kreneks "Jonny spielt auf" feierte Ende der zwanziger Jahre des vorigen Jahrhunderts einen Siegeszug ohnegleichen. Von der triumphalen Uraufführung 1927 in Leipzig an lief "Jonny" innerhalb von zwei Jahren mehr als 450-mal auf über 100 Bühnen, die Oper wurde in 18 Sprachen übersetzt. Die Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland bedeutete das Ende der Oper, das Ende des Nationalsozialismus jedoch keineswegs ihre Wiederkehr. Nur sporadisch kam das Werk in der Nachkriegszeit zur Aufführung, 1963 machte Florenz den Anfang, erst seit den neunziger Jahren wird es wieder öfters gespielt - wie nun an der Wiener Staatsoper. "Möglich, dass Kreneks ,Jonny spielt auf' demnächst zum Klassiker aufsteigt", mutmaßt Staatsopern-Dramaturg Peter Blaha. Die aktuelle Staatsopernaufführung ist freilich nicht dazu angetan, "Jonny" in die Liga von "Lulu" oder "Billy Budd" zu katapultieren. Gedämpfter Jubel und nur vereinzelte Buhs bei der Premiere bedeuten: reißt niemanden vom Sockel, regt niemanden auf. Liegt es an der szenisch schwachen Umsetzung oder an hartnäckigen Vorurteilen gegen das Werk?
"Entartete Musik"
"Unsere Staatsoper, die erste Kunst- und Bildungsstätte der Welt, der Stolz aller Wiener, ist einer frechen jüdisch-negerischen Besudelung zum Opfer gefallen", hetzten die Nazis gegen die Wiener Erstaufführung am 31. Dezember 1927, wo "Jonny" statt der traditionellen "Fledermaus" gegeben wurde. Das Titelblatt des Klavierauszuges, ein Saxophon spielender Schwarzer, musste später als Vorlage für die berüchtigte Propagandaschau "Entartete Musik" herhalten. Aber auch im Kunstbetrieb selbst erfreute sich Kreneks Geniestreich nicht gerade großer Wertschätzung: "Gewöhnlich machen wir Oper ohne Kassa, im Fall von ,Jonny' machen wir Kassa ohne Oper", mokierte sich der damalige Staatsoperndirektor Franz Schalk anlässlich der Wien-Premiere. Eine Geschichte, die sich lose um einen afroamerikanischen Jazzgeiger dreht, eine Welt, in der Sex eine Selbstverständlichkeit ist, Radio und Telefon, ein Automobil, eine Bahnhofshalle, in die ein Zug einfährt: Über jene Ingredienzien, die "Jonnys" Erfolg ausmachten, rümpfte schon der Opernfreund von damals die Nase. Lange Zeit wurde "Jonny spielt auf" daher als so genannte Zeitoper abgetan. In der Tat hat Krenek den Zeitgeist der zwanziger Jahre trefflich eingefangen: wieder erwachte Lebenslust, grenzenloser Fortschrittsglaube und die Faszination Amerikas.
"Jazzoper"?
Umso erstaunlicher ist es, wie frisch Kreneks expressionistische Musik heute noch klingt: spritzig, schmissig, effektvoll, bisweilen unglaublich komisch. Er scheute sich nicht, so etwas wie ein erstes Finale und eine Art Schlussrondo zu komponieren, bei dem der Zuseher direkt angesprochen wird - halb Rückgriff auf bewährte Tradition, halb ironisches Zitat. Seiji Ozawa, der bei der aktuellen Aufführung das Orchester der Wiener Staatsoper - vulgo Wiener Philharmoniker - leitet, hat wieder einmal den Ton einer österreichischen Klangsprache genau getroffen. Gerade die Leichtigkeit der Partitur, die sich wohltuend vom bitteren Ernst vieler Komponistenkollegen Kreneks abhebt, kostet der kleine, quirlige Mann aus Japan mit viel Freude aus. Wahrscheinlich ist es aber genau jene Leichtigkeit, die es der Oper heute schwer macht, dem strengen Urteil der Adepten der Moderne zu genügen.
Bemerkenswerterweise sind es die "jazzigen" Passagen der Partitur, die mittlerweile am überholtesten klingen. "Jonny spielt auf" gilt ja seit jeher als "Jazzoper" - eine missverständliche Bezeichnung, über die Krenek selbst nie glücklich war. Zwar hatte der Komponist zum Teil zeitgenössische Rhythmen wie Tango oder Foxtrott verwendet, Saxophone, Xylophon, Banjo sowie andere im Jazz gebräuchliche Instrumente vorgeschrieben und eine Jazzband auf die Bühne gestellt, doch mit echtem Jazz hatte dies nur oberflächlich zu tun. Kein Wunder, dass "Jonny" in den USA, in der Heimat des Jazz, nur mit Erstaunen zur Kenntnis genommen und kein Renner wurde. Krenek hatte eine - gelinde gesagt - unorthodoxe Vorstellung von Jazz. "Die Gäste müssen gedacht haben, jemand sei verrückt geworden", erinnerte er sich in seiner Autobiografie an ein "Jazz"-Konzert Anfang der zwanziger Jahre in einem Wiener Nachtclub. "Mit nicht zu bremsender Begeisterung und Energie" schlug er in die Tasten des Klaviers und gab Eigenkompositionen - vom Blatt! - zum Besten. "Es war mein erster und einziger Auftritt in einer derartigen Umgebung." Auch der eigentümliche Name "Jonny" - für gewöhnlich heißt es "Johnny" - beruht auf einem Missverständnis: "Von Englisch hatte ich nicht die geringste Ahnung", bekannte Krenek später freimütig. Die Zigarette der Austria Tabakwerke trägt in ihrer filterlosen Variante noch heute den Namen "Jonny", nur mit Filter heißt sie orthographisch korrekt "Johnny".
Pathos und Trivialität vermischt die Handlung von "Jonny spielt auf" in zum Teil grotesker Weise: Am Fuße eines Gletschers werden der Komponist Max und die Sängerin Anita ein Paar. Er (Torsten Kerl) ein grüblerischer Schöngeist, sie (stimmgewaltig: Nancy Gustafson) eine verführerische Diva mit tief ausgeschnittenem Rückendekolleté. Bei einem Gastspiel in Paris verbringt sie die Nacht mit dem öligen Violinvirtuosen Daniello (Peter Weber), der daraufhin nichts Besseres zu tun hat, als Max durch das Stubenmädchen Yvonne (Ildikó Raimondi) von der Affäre in Kenntnis zu setzen. Zu diesem Zeitpunkt weiß der Salongeiger freilich noch nicht, dass ihm der schwarze Jazzgeiger Jonny (Bo Skovhus) sein wertvolles Instrument gestohlen hat. Nach einigen Turbulenzen wird Daniello in einem Bahnhof von einem einfahrenden Zug überfahren, Max, Anita, Yvonne und Jonny setzen sich nach Amerika ab.
Wer ist ein "Neger"?
Die dekadente, im Niedergang begriffene Kunst Europas, die den Kürzeren zieht gegen die vitale, frische Kunst der Neuen Welt; das Drama des wahren Künstlers, dem "die Daniellos die Frauen und die Jonnys die Kunst stehlen" (Krenek) - davon ist in der Regie von Günter Krämer wenig zu merken. Fast scheint es, als hätte er sich streng an das Verdikt des Komponisten gehalten: "Es ist ein Stück ohne doppelten Boden. Keine Symbolik, keine Vertiefung, sondern alles, was geschieht, bedeutet nichts weiter als das, was man zu sehen bekommt." Bis zur Pause plätschert die Handlung tatsächlich ohne Vertiefung dahin, in einem radikal entrümpelten Bühnenbild (Andreas Reinhardt) fließen die einzelnen Bilder traumhaft ineinander, die aus dem vollen Leben gegriffene Geschichte verliert sich in einem imaginären Raum, der immerhin auch das Parkett miteinbezieht.
Natürlich weiß auch Krämer, dass man diese Oper, deren triebhafter Titelheld schon auf der Besetzungsliste als "Neger" charakterisiert ist, nicht mehr eins zu eins umsetzen kann. (Ihn als Siebziger Jahre-Soulsänger mit Afrohaarschnitt und gigantischem Hemdkragen - Kostüme: Falk Bauer - zu zeigen, ist allerdings auch nicht mehr ganz zeitgemäß, wo ja die "Neger" heutzutage in Turnschuhen, weiten Hosen und T-Shirt ihre Arme im Rhythmus des Rap schlenkern.) Der Regisseur präsentiert das Schwarz-Sein ganz zeitgemäß als soziales Konstrukt und lässt sich Skovhus neben Ozawa sitzend am Ende abschminken - Standard in jeder Travestieshow, wo sich der Darsteller am Liebsten zu den Klängen von "My Way" seiner Maske entledigt.
Zeitgeist der 20er Jahre
Ein schönes Bild gelingt, wenn sich Max, zum Selbstmord bereit, vor seinem geliebten Gletscher an die erste Begegnung mit Anita erinnert: Die Eingangsszene wird riesenhaft auf die Bühne projiziert. Dass die Einfahrt des Schnellzuges, unter dessen Räder die Kultur der alten Welt am Ende gerät, auch nur eine Projektion ist, mag eine technisch interessante Lösung und ein starkes filmhistorisches Zitat sein - mit einem auf den Zuschauer zurasenden Zug erschreckten die Brüder Lumière das Publikum ihrer allerersten Filmvorführung -, das starke Finale droht dadurch allerdings im Nebulosen verloren zu gehen.
Auf das Aufkeimen des politischen Autoritarismus in den zwanziger Jahren verweist Krämer dezent mit den Horden uniformierter Polizisten, die am Ende überall nach der gestohlenen Geige suchen. Die Hakenkreuze und SA-Uniformen blieben zum Glück im Fundus liegen. Dies ist auch der einzige Vorwurf, den man Krenek und "Jonny spielt auf" machen kann: Trotz vollen Schöpfens aus der Gegenwart nicht die leiseste Vorahnung der kommenden Schrecken zu artikulieren. "Wenn jemand behauptet hätte, dass in weniger als zehn Jahren der deutsche Liberalismus und das Judentum in Konzentrationslagern zu Tode geprügelt werden würde, hätte man ihn in ein Irrenhaus gesperrt", gab Krenek die Stimmung im Jahr der "Jonny"-Uraufführung wieder. Wie Künstler doch irren können.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!