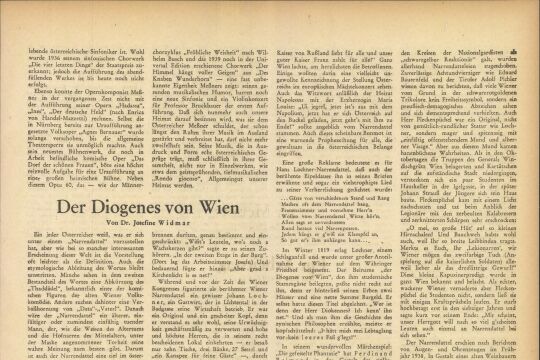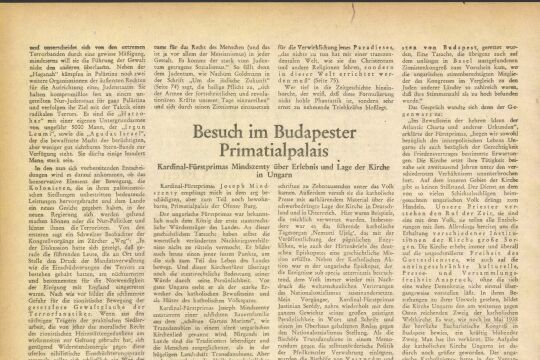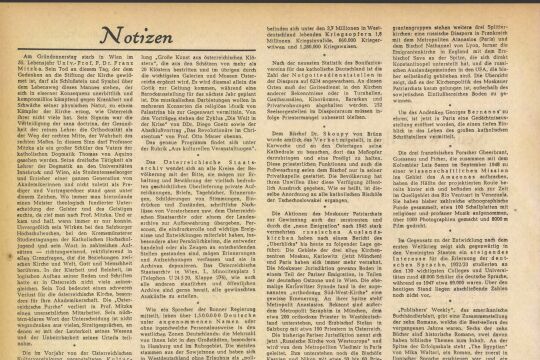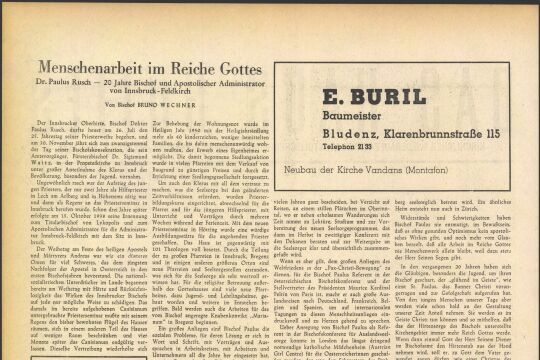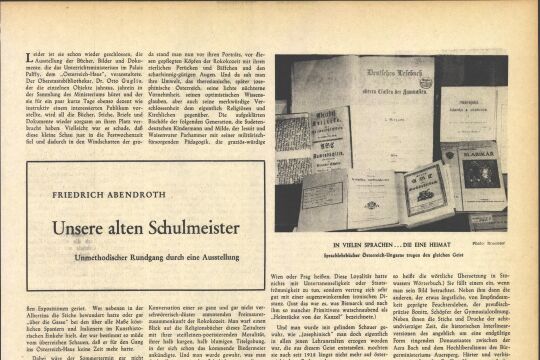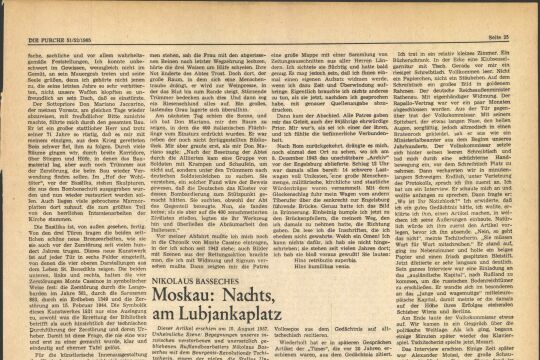So manchem Pilger, der im Heiligen Jahre nach Rom kam, mag im Straßenbild der Ewigen Stadt eine kleine Gruppe von jungen Männern in hellroten Talaren aufgefallen sein, es waren Theologiestudierende des „Germanicums“, die nach alter Tradition rot bekleidet sind. I Rossi“, .die Roten“, nennt sie der römische Volksmund.
Während der Kriegsjahre beherbergte das Innsbrucker Canisianum die Studierenden und Professoren des .Collegium Germanicum“, des „Deutschen Kollegs“. Als sie nach Kriegsende nach Rom zurückkehrten, hielt man es, um nicht antideutsche Ressentiments beim Anblick der Theologen des Collegium Germanicum zu wecken, für geraten, ihren roten durch den üblichen schwarzen Talar zu ersetzen. Doch die Stadtväter von Rom waren anderer Ansicht und ersuchten bald den Rektor des Hauses, die Germaniker sollten doch wieder ihre roten Talare tragen, sie gehörten nun einmal so sehr zu Rom, daß man ihren Anblick nicht missen wolle. Seit dieser Zeit ist der hellrote Theologentalar wieder zu den Eigentümlichkeiten Roms geworden. Wenn man im Frühling über den Pincio wandert, hat ea einen eigenen Reiz, gelegentlich dem leuchtenden Rot einer Gruppe raschen Schrittes zwischen den Büschen der Anlagen wandernde Germaniker zu begegnen. Ihre Tracht, der rote Talar mit dem schwarzen Zingulum, geht noch auf die Gründungszeit des berühmten Institut vom Jahre 1552 zurück. Sie ist ein Unikum in der buntbewegten Stadt, sowie überhaupt das „Deutsche Kolleg“ ein Unikum ist. Es gibt in der Ewigen Stadt neben den großen Ordenszentralen 30 Nationalkollegien, die Priesterseminare der Franzosen, Engländer, Nord-und Südamerikaner, Portugiesen, Spanier, Griechen, Schotten und Ruthenen. Ihre Studierenden unterscheiden sich durch die verschiedene Farbe des Zingulums, aber nicht ihrer Talare. Sie alle erhalten hier im Zentrum der katholischen Kirche in Harmonie mit der Uberlieferung und im Geiste ihres Heimatlandes ihre religiöse und geistige Formung. Von den meisten Studenten der Kollegien werden die theologischen Vorlesungen an der „Gregoriana“, der großen internationalen päpstlichen Universität, besucht. Diesen vielen nationalen theologischen Studienanstalten gegenüber ist das Germanicum eine Besonderheit dadurch, daß es im Grunde gar kein Nationalkollegium ist wie die anderen. Abgesehen davon, daß etwa dreißig Jahre nach der Gründung des Germanicums mit ihm das Collegium Hungaricum vereinigt worden war — daher der offizielle Titel „Collegium Germanicum et Hungaricum“ —, beherbergt es auch Studenten, die aus nichtdeutschen Gebieten stammen, sogar aus Ländern, für die ein eigenes Nationalinstitut besteht. Diese auffallende Erscheinung findet ihre Erklärung darin, daß das Germanicum geschichtlich eben noch das letzte Wahrzeichen des alten Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation ist und daß es daher heute noch immer im Sinne seiner alten Uberlieferung seine Pforten den Studenten aus solchen Diözesen öffnet, die aus diesem ursprünglich eine große Einheit bildenden Gebiet, dem übernationalen Reich von einst, stammen.
Wenn ich einen „Rosso* in Rom anspreche, so steht es deshalb durchaus nicht von vornherein fest, daß er einer deutschen oder österreichischen Diözese angehört. Er kann ebenso ein Norditaliener mit italienischer Muttersprache, ein Ungar oder Schweizer, ein Slowake, Slowene oder Kroate sein, er kann aus dem westlichen Polen, dem Elsaß, aus Siebenbürgen oder Ermland und sogar in einem seltenen Falle aus der holländischen Diözese Roermond oder Riga stammen.
Da die Leitung und der überwiegende Teil der Hausgemeinschaft aus Deutschen besteht, ist auch die Umgangssprache deutsch; die den Theologen auferlegte Probepredigt wird von den Studierenden aller Nationen in deutscher Sprache gehalten. So formt sich hier ein kleines Abbild der Völker und Sprachen umspannenden Ecclesia Catholica, eine lebende Erinnerung daran, daß es schon einmal so etwas wie die Vereinigten Staaten von Europa gab.
In den Jahren 1924 bis 1933 beherbergte das Collegium Germanicum einen kroatischen Alumnus Alois S t e p i n a 6.
Sieben Jahre lang trug der spätere Erzbischof und jetzige Gefangene von Lepoglava den'roten Talar. Er hatte zuvor in seiner Heimat die Hochschule für Bodenkultur absolviert. Er war deshalb etwas älter als der Durchschnitt seiner Consemester. Da die Aufnahme ins Germanicum von gewissen wissenschaftlichen und charakteriidien Eignungen abhängig ist, die das Ma'urazeugnis und eine entsprechende Empfehlung des Bischofs oder eines ehemaligen Germanikus beweisen muß, so war es nicht ein bloßer Zufall, der Stepina6 io das Germanicum führte, um dort seineß philosophischen und theologischen Studien zu obliegen. Nach den alten Traditionen des Hauses wird ein größeres Maß von Philosophie-ud Theologjestudium gefordert, als es sonst in den Priesterseminartien üblich ist. Heute ist es zum Beispiel nur bei äußerster Ausnutzung der Zeit'“.möglich, innerhalb von acht Jahren die theologische Doktorwürde zu erwerben. \Stepinaö war ein liebenswürdiger, gefälliger, hilfsbereiter und fröhlicher Kamerad, eifrig, ausdauernd und gründlich in seinen Studien, wie es dem Geiste des Hauses entsprach. Ein klein wenig ernster schien er zu sein als die anderen. Seine Kameraden meinten, es sei das Kriegserlebnis des ersten Weltkrieges gewesen, das den jungen Leutnant reifer gemacht hatte. Jeder wußte, daß er sich darauf verlassen konnte, wenn „Step“ etwas versprach. — Der damalige Spiritual des HauSes war der alte Ketteier- und Windt-horst-Biograph P. Otto Pfülf S. J., in dem noch etwas vom Kampfgeist jener Männer steckte, die er so meisterhaft geschildert hat. Es war uns aufgefallen, daß Pfülf damals schon eine besondere Hochschätzung für den „alten Soldaten“ aus Zagreb hatte. Er kannte dessen Charakter, seine männlich gerade Art noch besser als wir. Die kernige kompromißlose Haltung des Spirituals dürfte nicht ganz ohne Einfluß auf Stepina6 gewesen sein.
Wenn die heißen Tage in Rom kommen und die Mehrzahl ihre Prüfungen abgelegt hat, dann ziehen die Studenten des Germanicums in die kühlere römische Campagna hinaus, in die Nähe des alten Palestrina, der Stadt mit der eindrucksvollen Kathedrale, den Resten des großen Fortunatempels: es ist der Geburtsort des Pierluigi Palestrina. Etwa 30 Kilometer östlich von Rom, in der Nähe der Albanerberge und an der alten Via Praeneste, liegt der alte Sommersitz des Germanicums. Dort verbringen an die hundert junge, ideale Menschen die Sommermonate, mit Frohsinn und Ferientreiben bis zum Rande gefüllt. Der im Jahre 1944 zu tragisch verschiedene ehemalige deutsche Botschafter am Quirinal, Freiherr von Hassel, ist in den Jahren vor dem letzten Krieg oft und gern in seinem Auto nach San Pastore, dem Ferienhaus der Germaniker, hinausgefahren. Er, der Protestant, liebte es, sich von der Heiterkeit und Unbeschwertheit — wie er sich ausdrückte — dieser singenden, spielenden, sporttreibenden jungen Menschen anstecken zu lassen. Die Germaniker hatten immer eine kleine Überraschung für den deutschen Botschafter bereit: einmal war es ein Handball- oder ein Fuß-b'allwettspiel, ein andermal ein heiteres Theaterstück oder eine Freilichtaufführung, ein flottes Orchester, das im Refektorium zu Ehren des Gastes alte Soldatenmärsche spielte — v. Hassel war Ulanenoffizier gewesen —, oder es kamen ihm zwei Theologen hoch zu Roß ein Stück des Weges entgegen, um dann im gestreckten Galopp das Botschaftsauto bis zur Einfahrt zu begleiten. So viel „Martialität“, äußerte einmal der Botschafter, hätte er bei katholischen Theologen nicht vermutet.
In dieser Ferienwelt pflegte Stepina 5 ganz aus sich herauszugehen; er entwickelte sich zu einem überdurchschnittlichen Handballspieler. Bei den Wettspielen zwischen „Philosophen“ und „Theologen“ war Stepina6 die Seele des Theologenteams und sicherte seiner Mannschaft als die Seele von „Links-rückwärts“ in der Regel den Sieg. Seine besondere Stärke war es, die flachen, aus dem Spielfeld springenden Bälle noch einmal zurückzuholen, sie zu „retten“. Ich erinnere mich noch an ein Wettspiel in den Ferien vor seiner Subdiakonats-weihe. Die zahlreichen roten Schlachtenbummler, die „Step“ damals in voller Form sahen, haben ihm lebhaft applaudiert. — Neben den Handballspielern gehörte Stepina6 zu den „Bergfexen“. Sowohl in Rom wie vor allem in San Pastore gehörte er zu jener Gruppe „Verwegener“, die sich von immer schwierigeren und ferneren Bergzielen im Apennin locken ließ. Je schwieriger die Tour, je größer die geforderte physische Anstrengung, und je knapper die Zeit, desto größer war bei Stepinaö die Freude. Die Meisterung der Schwierigkeiten, innen und außen, war damals schon ein Kennzeichen seines Lebens.
Nach seiner Priesterweihe im Jahre 1930 und nach Beendigung seiner theologischen Studien im Jahre 1931 kehrte er in seine Heimatdiözese nach Zagreb zurück. Der Abschied vom Germanicum, das ihm eine zweite Heimat geworden war, wie er sich ausdrückte, fiel ihm sehr schwer. Er sagte, daß er nur den einen Wunsch habe, mitten in schwierigste Seelsorgearbeit hineingeworfen zu werden, er wünsche nur eines nicht zu werden: bischöflicher Sekretär oder Hofkaplan beim Bischof. Stepina 5 kam in die Seelsorge. Aber bald holte ihn der damalige Erzbischof ausgerechnet als seinen Sekretär und Zeremoniär zurück. Es mag ihm dies ein großes Opfer gewesen sein. Später wurde erzählt, Stepinaö habe seinem Bischof gegenüber den Wunsch geäußert, in einen strengen Orden einzutreten. Der Erzbischof antwortete, er werde dafür sorgen, daß er das nicht tue. Es waren noch nicht die vom Kirchenrecht geforderten fünf Jahre seit der Priesterweihe vergangen, als die Nachricht ins Germanicum kam, Stepinad sei zum Weihbischof cum jure successionis in Zagreb ernannt worden. Ich war damals gerade im letzten Jahre der Theologie, als Stepina 5 einige Monate später mit den Abzeichen seiner neuen Würde im Germanicum erschien, von den Alumnen stürmisch begrüßt. An seiner Schlichtheit, an seiner männlich entschiedenen Art hatte sich nichts geändert. Am nächsten Tage ging er in den Vatikan, um sich dort in der üblichen Weise vorzustellen. Nacn seiner Rückkehr erzählte er uns folgende köstliche Episode: „Ich ging am späten Vormittag allein über den Petersplatz. Plötzlich stand ein kleiner römischer Bub vor mir mit ungewaschenem Gesicht und wirrem Haar. Er fragte mich mit sichtlicher Neugierde: ,Padre, che ora fa?' — ,Hochwürden, wie spät ist es ienn?' Erstaunt über die merkwürdige Frage des Kleinen bleibe ich stehen und
öffne meinen Mantel, um nach der Uhr in meinem Talar zu langen. In dem Augenblick, als beim öffnen meines Mantels das rote Zingulum und das bischöfliche Brustkreuz sichtbar wurden, sprang der kleine Bengel im Nu, ohne die Antwort auf seine Frage abzuwarten, mit behenden Sätzen davon und rief seinem in der Nähe stehenden kleinen Kameraden zu: .Adriano, 4 veramente un vescovo!' — ,Du, Adrian, es ist tatsächlich ein Bischof.“ — Die beiden Buben konnten es offenbar nicht glauben,
daß der gar so Junge, schlanke Mann, der eine grüne Schnur als Zeichen seiner Würde auf seinem breitkrempigen, schwarzen Hute trug, sonst aber nur einen schwarzen geschlossenen Mantel über seinem Talar an hatte, wirklich ein Bischof sein sollte. Ihre Vorstellung von einem Bischof gab ihnen hier ein Rätsel auf. Sie lösten das Problem auf die geschilderte Art.
Ob sich der Gefangene von Lepoglava heute noch an diese Bubengeschichte vom Petersplatz erinnert?