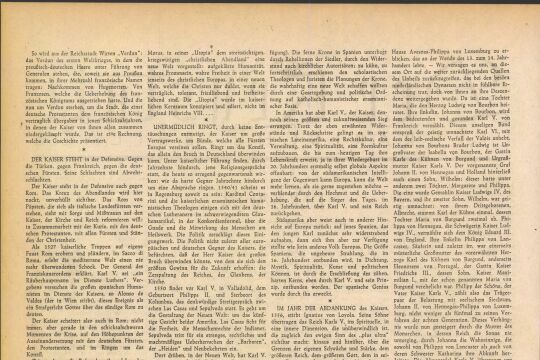Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Guelfen und Ghibellinen
„In jenen Tagen erschienen aim Himmel Toscanas wie schwere Nebelballen die Gestalten zweier miteinander ringender weiblicher Dämonen und das Volk gab ihnen nicht mit Unrecht die Namen G e b e 11 i a und G u e 1 f a.“ So berichtet der guelfische Sekretär des Papstes Johannes XXI., Saba Malaspina, in seinem Geschichtswerk über die Zeit von 1250 bis 1285. Gerade in diesen Jahren ging „die Drachensaat jener zwei alten Faktionen“ (Gregorovius) auf italienischem Boden am üppigsten auf. Es ist die Zeit der letzten Kämpfe der Staufer in Italien. Das Jahr 1268 brachte das Ende des staufischen Hauses. Damit hätte eigentlich auch die Parteibezeichnung „Ghibellinen“ ihre Berechtigung verlieren müssen.
Trotzdem wurde der Name beibehalten. “Waren doch auch die Gegner Manfreds und Konradins längst keine Weifen mehr. Aber aus dem dynastischen Gegensatz der deutschen Thronwirren am Beginn des 13. Jahrhunderts hatten sich so einprägsame politische Devisen gebildet, daß man in Italien unter diesen Devisen noch fortkämpfte, als längst niemand mehr an ihre urspüngliche Bedeutung dachte. Auch die Gleichseteung der Ghibellinen mit der kaiserlichen und der Guelfen mit der päpstlichen Partei ist nur sehr ungenau. In Wirklichkeit reichten die Parteigegensätze viel weiter zurück als in die Zeit der Kämpfe zwischen Staufern und Weifen, und die eigentlichen Motive der Parteiung verschlangen sich zu einem unentwirrbaren Wurzelgeflecht.
Ungefähr hundert Jahre nach Saba Malaspina schreibt der Novellist S e r Giovanni Fiorentino über den Ursprung der Parteien: „In Deutschland waren zwei sehr vertraute Freunde, beide edel und reich, der eine hieß Guelfo, der andere Ghibellino. Als sie eines Tages von der Jagd heimkehrten, gerieten sie in Streit über eine Hündin, und während sie zuvor Freunde und Kameraden gewesen waren, wurden sie nunmehr Feinde und ließen nicht ab, einander zu befehden ...“ In der Folge wandte sich der eine um Hilfe an den Kaiser, der andere an den Papst „und so kam es, daß der papstliche Stuhl guelfisch, das Kaisertum ghibellinisch wurde“. Aus dieser Fabel kann man sehen, wie sehr die eigentlichen Namensbedeutungen der beiden großen /Parteien in Vergessenheit geraten waren. Nur eine geschichtlich richtige Bemerkung findet sich in der Erzählung des Ser Giovanni: daß nämlich in Italien die Parteinamen zuerst in den Adelskämpfen des Jahres 1215 in Florenz aufscheinen. Also zu einer Zeit, in* welcher tatsächlich der Machtkampf in Deutschland eben erst zu Ende ging. Für Italien hingegen begann jetzt jener verhängnisvolle Parteikampf, welcher „der Geschichte Italiens den heroischen Charakter wilder und großer Leidenschaften aufgedrückt hat“ (Gregorovius).
Wenn nun versucht werden soll, den programatischen Gegensatz zwischen Guelfen und Ghibellinen kurz darzulegen, so darf man dabei nicht vergessen, daß in sehr vielen Fällen weder die eine noch die andere Partei auch nur im geringsten an solche Gegensätze dachte, sondern daß durch mehr als ein Jahrhundert alle sozialen und Familienfehden Italiens unter diesen beiden Fahnen ausgekämpft wurden.
Die Gestalten der drei großen staufischen Kaiser Friedrich I., Heinrich VI. und Friedrich II. bedeuteten für Italien drei Stufen der Verwirklichung des ghibellinischen Kaisertums. Babarossa hatte versucht, die freien oberitalienischen Stadtgemeinden fest ins Reich einzufügen, was ihm trotz empfindlicher Niederlagen doch im wesentlichen gelungen war. Heinrich VI. hatte den Süden Italiens und Siziliens mit dem Reiche vereint. Schließlich hatte Friedrich II., nachdem er den Besitz seines Vaters übernommen hatte, dieses Imperium besonders in seinen italienischen Teilen straff durchorganisiert, wozu er sich des wiedererweckten römischen Rechts bediente.
Die ghibellinische Idee stellte sich also als die Wiedererweckung des alten römischen Imperiums dar. Im gleichen Maße, wie sich diese Idee, von Babarossa angefangen, stufenweise verwirklicht, nimmt diese Verwirklichung immer mehr antik-heidnische Züge an. War Babarossa noch zu tiefst von der christlichen Heilsaufgabe des Reiches und seiner kaiserlichen Würde überzeugt — trotz aller Kämpfe mit dem Papst —, so war sein Enkel Friedrich II. ein vollendeter Freigeist — trotz der biblisch-apokalyptischen Sprache seiner Staatsbriefe.
So mußte dem Italiener der ghibellinische Staat als typisches Machtgebilde erscheinen, das seine Ansprüche auf Weltgeltung, nicht auf Grund des christlichen Ordo-Gedankens stellte, sondern einzig auf Grund des Machtwillens einer starken Persönlichkeit. Es ist ein weltweiter Unterschied zwischen diesem ghibelhnischen Reich und der Reichsvorstellung eines Otto III., der die kaiserliche Macht als Ordnungsmacht über den im Reich zu einem Bund geeinten Völkern und Königreichen der Christenheit sah. Es ist letzten Endes der Unterschied zwischen der Civitas Dei und dem kalten römischen Rechtsstaat.
Trotzdem hatte diese ghibellinische Reichsauffassung auch in Italien ihre Anhänger, besonders unter dem Adel, der seine persönlichen Vorteile von dieser Reichsorganisation hatte. Viele waren wohl auch geblendet von der Wiedererweckung alter römischer Herrlichkeit und mochten von der Erneuerung der römischen Weltherrschaft träumen, zumal unter dem Eindruck der glanzvollen Persönlichkeit Friedrichs II.
War diese ghibellinische Reichsidee tatsächlich aufs engste mit der Persönlichkeit des großen Staufers verbunden, so fehlte dem guelfischen Gegenpol eine überragende Persönlichkeit so gut wie ein klar umrissenes Programm. Aber in einigen Hauptpunkten waren sich die verschiedenartigen Gegner der Ghibellinen doch einig, besonders in der Behauptung der Freiheit der Städte und in der. Verehrung der kirchlichen Autorität. Nicht nur das persönliche Verhalten Friedrichs IL, sondern auch der heidnische Charakter seines Staates mußte notwendig die Gegnerschaft des Papstes Hervorrufen. Um ihn scharten sich in der Folge nicht nur jene, welche aus religiösen Gründen den ghibellinischen Staat ablehnten, sondern alle Arten von Feinden der Ghibellinen.
Das guelfische Programm umfaßte vor allem die kirchlichen Forderungen nach Freiheit vor Bevormundung durch den Kaiser. Diese Forderungen gingen soweit, daß jetzt der Papst seinerseits den Anspruch darauf machte, auch die kaiserliche Gewalt auszuüben. Bonifaz VIII. war es, der solche Ansprüche stellte; unter seiner Regierung erhielt auch die päpstliche Krone, welche bis dahin nur einen einzigen Kronreif gehabt hatte, den zweiten Kronreif (erst in der Avignonesischen Zeit wird die Tiara zum „Triregnum“).
Ein zweiter Punkt des guelfischen Programms war die nationale Freiheit Italiens Wenn auch die Zeiten noch lange nicht reif waren für eine nationale Einigung, so wurde es doch als unwürdig empfunden, daß ein Nicht-Italiener die höchste politische Gewalt innehaben sollte.
Schließlich war es die soziale Bewegung der großen Städte, welche in einem dritten Programmpunkt die bürgerliche Freiheit gegen den Kaiser wie auch gegen die einheimischen Stadttyrannen verlangte.
Aus diesen Hauptpunkten des guelfischen Programms sieht man, daß es nicht spezifisch „guelfisch“ war, sondern daß es die Zusammenfassung aller jener gravamina bedeutet, welche Italien und das Papsttum , seit jeher gegen das deutsche Kaisertum vorbrachten.
Dante wird vielfach als großer Ghibelline gefeiert, besonders im Hinblick auf sein Werk „De monarchia“, in welchem er seinen politischen Begriff des diristlichen Weltkaisertums darlegt. Obwohl er als Florentiner gut guelfisch war, habe er (so stellt man es gewöhnlich dar) in seiner späteren Zeit „umgelernt“ und sei zum Ghibellinen worden.
In Wirklichkeit hat sich aber Dante nie von der einen zur anderen Partei „bekehrt“, sondern ist über den beiderseitigen Parteistandpunkt hinaus zu einer Synthese der beiden Programme gekommen, die nur der oberflächlichen Betrachtung als „ghibellinisch“ erscheint. Denn die Weltmonarchie Dantes sollte nicht ein Machtstaat sein, wie es der Ghibellinenstaat des 13. Jahrhunderts gewesen war, sondern wieder die Civitas Dei. Der Kaiser selbst ist nicht der Zwingherr unterjochter Völker und Königreiche, sondern der von Gott selbst bestellte Hirt der in freiwilliger Vereinigung zusammengeschlossenen Völker.
In diesem Reiche werden aber auch die guelfischen Streitfragen gegen die Ghibellinen gegenstandslos. Denn der Friedenskaiser Dantes ist in brüderlicher Eintracht mit dem Papst verbunden — Dante weist die imperialistischen Ansprüche seines Feindes Bonifaz VIII. in schärfster Weise zurück. Der nationale Unterschied spielt in einem nach christlichem Geiste geordneten Reiche überhaupt kaum eine Rolle; so kommt es, daß gerade Dante, der Bahnbrecher des italienischen Nationalbewußtseins, dem deutschen Heinrich als dem Weltmonarchen seinen Platz in den höchsten Regionen seines „Paradiso“ zuweist. Auch die sozialen Forderungen der Guelfen sind im christlichen Weltreich nicht mehr aktuell. Denn dem Weltmonarchen ist nicht nur persönlich jede Herrsch- und Raffgier ferne, sondern er sorgt auch für musterhafte Rechtspflege im ganzen Reich.
Das großartige Bild, das Dante von seinem Friedenskaiser entworfen hat, ist niemals zur Wirklichkeit geworden. Aber im grundsätzlichen Ideengegensatz zwischen Guelfen und Ghibellinen hat wohl Dante das letzte Wort gesprochen. Die Lösung liegt zwischen und über den Partei-Extremen. Vielleicht war sie gerade deshalb für beide Seiten unannehmbar. Denn die menschliche Kurzsichtigkeit war im 14. Jahrhundert nicht anders geartet als heute: sie wird viel leichter durch' laute Extreme gefesselt als durch die stille Harmonie der Mitte.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!