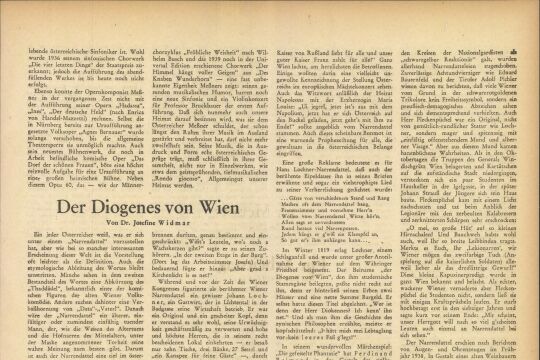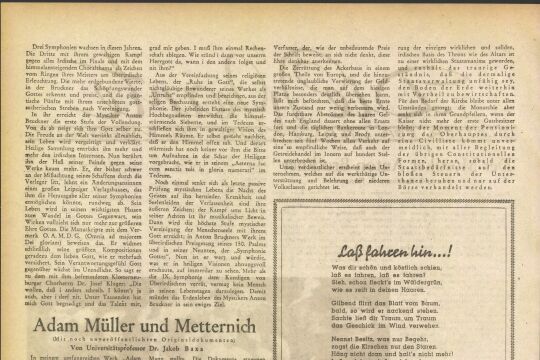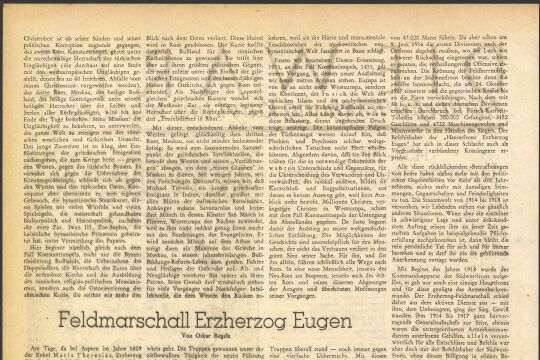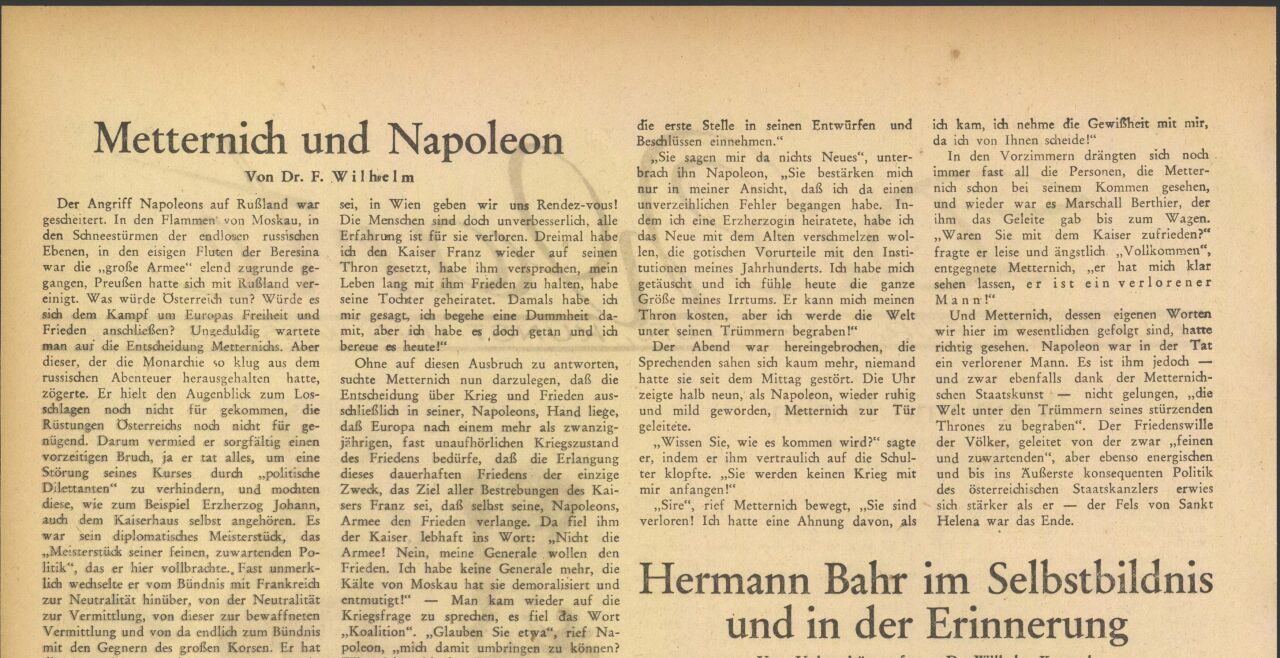
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Metternich und Napoleon
Der Angriff Napoleons auf Rußland war gesdieitert. In den Flammen von Moskau, in den Schneestürmen der endlosen russischen Ebenen, in den eisigen Fluten der Beresina war die „große Armee“ elend zugrunde gegangen, Preußen hatte sich mit Rußland vereinigt. Was würde Österreich tun? Würde es sich dem Kampf um Europas Freiheit und Frieden anschließen? Ungeduldig wartete man auf die Entscheidung Metternichs. Aber dieser, der die Monardiie so klug aus dem russischen Abenteuer herausgehalten hatte, zögerte. Er hielt den Augenblick zum Losschlagen noch nidit für gekommen, die Rüstungen Österreichs noch nicht für genügend. Darum vermied er sorgfältig einen vorzeitigen Bruch, ja er tat alles, um eine Störung seines Kurses durch „politische Dil cttanten“ zu verhindern, und mochten diese, wie zum Beispiel Erzherzog Johann, auch dem Kaiserhaus selbst angehören. Es war sein dipiomatisdtes Meisterstück, das „Meisterstück seiner feinen, zuwartenden Politik“, das er hier vollbrachte.. Fast unmerklich wechselte er vom Bündnis mit Frankreich zur Neutralität hinüber, von der Neutralität zur Vermittlung, von dieser zur bewaffneten Vermittlung und von da endlich zum Bündnis mit den Gegnern des großen Korsen. Er hat die Art seines Vorgehens wenig später in einem Brief an seinen ehemaligen Erzieher, Höhn, selbst ausgezeichnet geschildert.
„Ich habe ein großes Werk begonnen“, sdireibt er, „lange und sachte bin ich vorge-sdiritten, alle Kräfte mußten gesammelt, der Zeitpunkt abgewartet werden. Wir müßten moralisch recht haben, um dieses Redit materiell durchfechten zu können. Der Himmel hat das Unternehmen gesegnet, er hilft uns. weil wir uns helfen, und in kurzem wird es der französischen Obermacht wie der Zeder iuf dem Libanon ergehen! Die Lebenskrart Napoleons ist gelähmt, das Riesengebäude ist im unaufhaltsamsten Sinken. Ohne Armee führt auch der beste Feldherr keinen Krieg und die Armee Napoleons ist keine Armee mehr. Wir gehen langsam, weil wir sicher gehen wollen; wir wollen kein Werk für den Augenblick, sondern eine gründliche Kur — keine heroischen, aber sichere Mittel. Daß ich, wenn Gott mir Lehen und Gesundheit schenkt, das Werk durchführe, dafür sei Ihnen nicht angst. Das Schwerste ist überstanden. Nun gilt es Beharrlichkeit und festen Willen, den geraden Weg zu gehen — und wir haben die erstere und auch den Willen!“
Diesen festen Willen hatte Metternich bereits im Vorjahre bei der prunkvollen Dresdner Tagung bewährt, als es ihm im Verein mit der Kaiserin Maria Ludowika gelungen war, den völlig von Napoleon ein-gewidtelten Kaiser Franz daran zu verhindern, daß er sich persönlich dem Kriegszug nach Rußland anschließe. Nun, fast genau nach einem Jahre, stand Metternich wieder m Dresden dem Imperator Aug in Auge gegenüber, aber wie hatte sich seither alles gewandelt! Heute, am 26. Juni 1813, war er gekommen, um in persönlicher Aus-spradte mit Napoleon den Übergang Österreichs von der Neutralität zur Vermittlung zu vollziehen. Als er an diesem denkwürdigen Tag um elf Uhr vormittags das Mar-colinische Gartenpalais in der Dresdner Friedrichstadt betrat, fand er die Vorgemächer erfüllt von einer goldbetreßten Schar von Marschällen und Hofchargen, von zivilen und militärischen Würdenträgern, die in peinlicher Besorgnis nur auf das Ergebnis dieser Audienz zu warten schienen. Der Fürst von Neufchatel (Marschall Berthier), der erst vor zwei Jahren als Brautwerber Napoleons in Wien gewesen, geleitete Metternich zur Tür des kaiserlichen Salons, wobei er ihm zuflüsterte: „Bringen Sie uns den Frieden? Seien Sie vernünftig! Ihr braucht das Ende des Krieges genau so notwendig wie wir!“
Metternich sah sich nicht veranlaßt, darauf zu erwidern, trat ungesäumt in . das Zimmer des Kaisers ein. Napoleon stand in der Mitte des Gemachs, in seiner gewohnten gemessenen Flaltung, den Degen an der Seite, den Hut unter dem Arm. Aber schon nach der ersten Begrüßung und den üblichen Erkundigungen nach dem Befinden des Kaisers warf Napoleon seine Zurückhaltung ab. Er trat unvermittelt vor Metternich hin: „Sie wollen also den Krieg?“ sagte er drohend. „Gut, Sie sollen ihn haben! Idi habe die Russen, die Preußen geschlagen — auch Sie wollen an die Reihe kommen? Es sei, in Wien geben wir uns Rendez-vous! Die Menschen sind doch unverbesserlich, alle Erfahrung ist für sie verloren. Dreimal habe ich den Kaiser Franz wieder auf seinen Thron gesetzt, habe ihm versprochen, mein Leben lang mit ihm Frieden zu halten, habe seine Tochter geheiratet. Damals habe ich mir gesagt, ich begehe eine Dummheit damit, aber ich habe es doch getan und ich bereue es heute!“
Ohne auf diesen Ausbruch zu antworten, suchte Metternich nun darzulegen, daß die Entscheidung über Krieg und Frieden ausschließlich in seiner, Napoleons, Hand liege, daß Europa nach einem mehr als zwanzigjährigen, fast unaufhörlichen Kriegszustand des Friedens bedürfe, daß die Erlangung dieses dauerhaften Friedens der einzige Zweck, das Ziel aller Bestrebungen des Kaisers Franz sei, daß selbst seine, Napoleons, Armee den Frieden verlange. Da fiel ihm der Kaiser lebhaft ins Wort: „Nicht die Armee! Nein, meine Generale . wollen den Frieden. Ich habe keine Generale mehr, die Kälte von Moskau hat sie demoralisiert und entmutigt!“ — Man kam wieder auf die Kriegsfrage zu sprechen, es fiel das Wort „Koalition“. „Glauben Sie etwa“, rief Napoleon, „mich damit umbringen zu können? Wie viele seid Ihr denn? Vier, fünf, sechs, zwanzig? Je mehr Euer sind, desto besser für mich! Ich nehme die Herausforderung an“, fuhr er mit erzwungenem Lachen fort, „aber Sie sollen sehen, im nächsten Oktober treffen wir uns in Wien!“
Metternich drängte darauf, daß nach Rußland und Preußen nun auch Frankreich die Vermittlung Österreichs annehme, da es unmöglich sei, die Armee länger in Böhmen zu verpflegen. Aber dies gab Napoleon Anlaß zu langen und umständlichen Erörterungen üoer den Stand und die mögliche Stärke der österreichischen Armee. Dann verbreitete er sich ausführlich über seinen russischen Feldzug, suchte darzulegen, daß nur die Elemente, nicht die russischen Waffen ihn besiegt hätten.
„Wohlan denn“, unterbrach ihn endlich Metternich, „machen Sie so vielen Wechselfällen ein Ende, Sire! Das Glück könnte ermüden, Ihnen treu zu bleiben, wie es Ihnen schon einmal untreu geworden ist. Mit was wollen Sie Ihre Kriege ausfechten? Sie haben eine Generation vorausgenommen. Ich habe Ihre Soldaten gesehen, es sind Kinder! Was wollen Sie tun, wenn auch diese dahin sein werden?“
„Herr“, fuhr ihn da Napoleon an, bebend vor Zorn und innerer Aufregung, „Herr, Sie sind nicht Soldat! Ich aber bin unter den Waffen aufgewachsen und ein Mann wie ich schiert sich den Teufel um das Leben von einer Million Menschen !“
Dabei schleuderte er voll Zorn den Hut zu Boden und begann mit heftigen Sdiritten das Zimmer zu durchmessen. Metternich, an die Ecke einer Konsole zwischen den Fenstern gelehnt, verlor keinen Augenblidi seine Ruhe und Kaltblütigkeit: „Warum sagen Eure Majestät m i r das? Hier zwischen den vier Wänden! Öffnen wir die Fenster und Türen weit, damit ganz Europa Ihre Worte höre! Die Sache, die ich hier vertrete, ist es nicht, die dabei verlieren wird!“ — Der Kaiser schien etwas betroffen. „Frankreich hat keinen Grund, über mich zu klagen“, sagte er in ruhigerem Ton, „es waren Deutsche und Polen, die ich für se:ne Sache haben bluten lassen. Es ist wahr, ich habe im russischen Feldzug 300.000 Mann verloren, aber es waren kaum 30.000 Franzosen darunter!“ — „Sire!“ rief da Metternich zutiefst bewegt. „Sie vergessen, daß Sie zu einem Deutschen sprechen!“
Der unglückselige Hut lag noch immer auf der Erde. Metternich übersah ihn geflissentlich. Voll Zorn stieß ihn der Kaiser mit dem Fuß zur Seite, bis er, mit Metternich auf und ab gehend, wieder in seine Nähe kam, ihn selbst aufhob und auf den Tisch warf. Wieder kam er nun auf seine Heirat zu sprechen. „Sagen Sie doch selbst, Metternich“, meinte er, „habe ich nicht eine furchtbare Dummheit gemacht, indem ich eine österreichische Erzherzogin zur Frau nahm?“ — „Da Eure Majestät meine Meinung wissen wollen, bekenne ich offen: Napoleon der Erobernde begeht eine!“ — „Der Kaiser Franz will also seine Tochter entthronen?“ — „Mein Herr, der Kaiser“, antwortete Metternich, „kennt nur seine Pflicht, und die wird er zu erfüllen wissen. Was immer das Sdiicksal seiner Tochter sein mag, der Kaiser ist in erster Linie Monarch und das Interesse seiner Völker wird immer die erste Stelle in seinen Entwürfen und
Beschlüssen einnehmen.“
„Sie sagen mir da nichts Neues“, unterbrach ihn Napoleon, „Sie bestärken mich nur in meiner Ansicht, daß ich da einen unverzeihlichen Fehler begangen habe. Indem ich eine Erzherzogin heiratete, habe ich das Neue mit dem Alten verschmelzen wollen, die gotisdien Vorurteile mit den Institutionen meines Jahrhunderts. Ich habe mich getäuscht und ich fühle heute die ganze Größe meines Irrtums. Er kann mich meinen Thron kosten, aber ich werde die Welt unter seinen Trümmern begraben!“
Der Abend war hereingebrochen, die Sprechenden sahen sich kaum mehr, niemand hatte sie seit dem Mittag gestört. Die Uhr zeigte halb neun, als Napoleon, wieder ruhig und mild geworden, Metternich zur Tür geleitete.
„Wissen Sie, wie es kommen wird?“ sagte er, indem er ihm vertraulich auf die Schulter klopfte. „Sie werden keinen Krieg mit mir anfangen!“
„Sire“, rief Metternich bewegt, „Sie sind verloren! Ich hatte eine Ahnung davon, als ich kam, ich nehme die Gewißheit mit mir, da ich von Ihnen sdteide!“
In den Vorzimmern drängten sich noch immer fast all die Personen, die Metternich schon bei seinem Kommen gesehen, und wieder war es Marschall Berthier, der ihm das Geleite gab bis zum Wagen. „Waren Sie mit dem Kaiser zufrieden?“ fragte er leise und ängstlich „Vollkommen“, entgegnete Metternich, „er hat mich klar sehen lassen, er ist ein verlorener M a n n !“
Und Metternich, dessen eigenen Worten wir hier im wesentlichen gefolgt sind, hatte richtig gesehen. Napoleon war in der Tat ein verlorener Mann. Es ist ihm jedoch — und zwar ebenfalls dank der Metternich-schen Staatskunst — nicht gelungen, „die Welt unter den Trümmern seines stürzenden Thrones zu begraben“. Der Friedenswille der Völker, geleitet von der zwar „feinen und zuwartenden“, aber ebenso energischen und bis ins Äußerste konsequenten Politik des österreichischen Staatskanzlers erwies sich stärker als er — der Fels von Sankt Helena war das Ende.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!