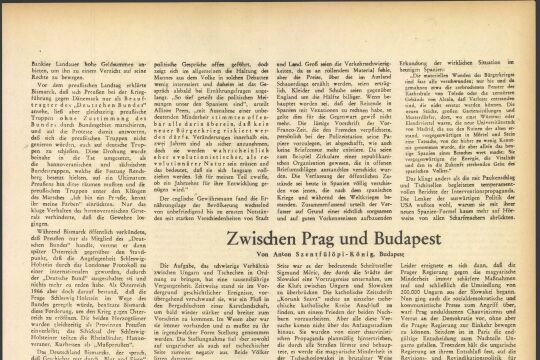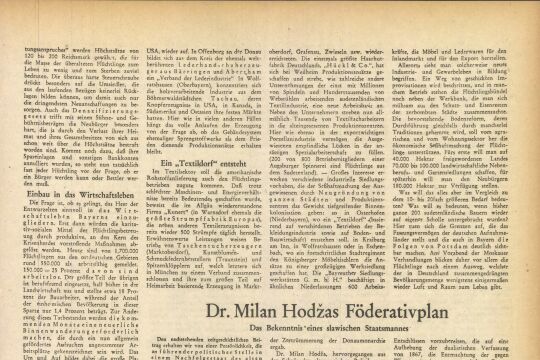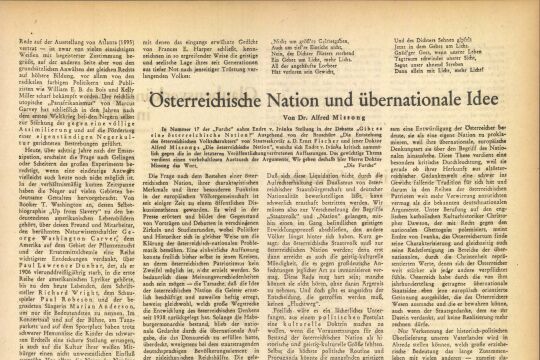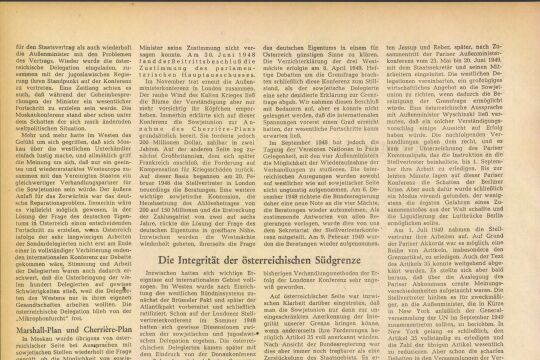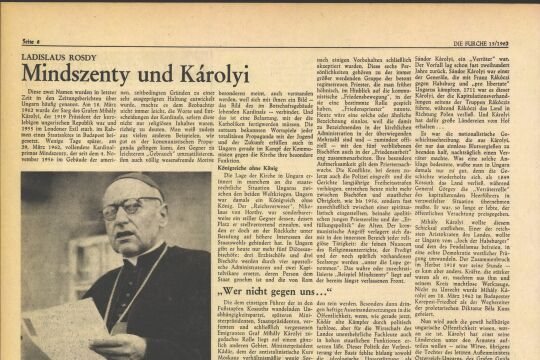Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ohne Verwandte und ohne Bekannte…
„Ohne Verwandte und ohne Bekannte’ steht nach einem Wort des ungarischen Dichters Ady das ungarische Volk in der europäischen Völkerfamilie. Setzen wir hinzu: in der Scheidelinie zwischen Ost und West. Als die magyarischen Heerscharen über den Vereczkepaß in das verheißene Land, die Tiefebene um Donau und Theiß, eindrangen, trafen sie eine schicksalsschwere Entscheidung. Sie hat, dies sei vorweggenommen, Europa zum Vorteil gereicht. Sie traten aber damit in einen Raum, der schon vor ihnen östliche Steppenvölker angezogen und ihnen nach rascher Machtentfaltung raschen Untergang bereitet hatte. Wie weit hatten ihre Pferde die Hunnen, die Awaren getragen, und wie schnell und spurlos waren ihre lockeren Verbände an den Mauern konsolidierter westlicher Staatsmacht zerschellt! Dieses Gebiet, in das sich die magyarischen Stämme einschöben, war von einer dünnen slawischen Schicht besiedelt. Arp£d und seine Scharen brachten diese Brücke zwischen Süd- und Nordslawen zum Einsturz. Mit Recht hat Palacky dies „als das größte Unglück bezeichnet, das das Slawentum im Laufe der Jahrtausende traf . Aber nicht nur für die Slawen wurde diese .Landnahme“ der Magyaren zum bestimmenden Schicksal. Diese selbst gerieten damit in eine ähnliche, aber weitaus drückendere Einengung wie die Germanen zwischen Slawen und Romanen. Zu schwach an nationaler Substanz, um den weiten Karpatenbogen auszufüllen, waren sie zu ewigem Vorwärtsdrängen gegen ihnen zahlenmäßig weit überlegene Völkergruppen gezwungen.
König Vajk, auf den Namen Stephan getauft und als der Heilige in die Geschichte der Kirche, seines Landes und Europas eingegangen, war und blieb der große konstruktive Staatsmann seines Volkes. Er traf die Entscheidung zwischen Ost und West und führte seine Nation dem katholischen Glauben zu. Seine Weisheit erkannte die Notwendigkeit der übernationalen Herrschaft im Donau- raum. In seinen „Ermahnungen“ — seinem politischen Testament — an seinen Sohn Emmerich zählte er die Fremden, die „Gäste und Ankömmlinge’ zu den Hauptstützen des Reiches. Denn: „Sie bringen verschiedene Sprachen, Gebräuche, Waffen und wissenschaftliche Kenntnisse mit sich, die jedem Lande zur Zierde gereichen.’ Und: „Das Land, wo nur einerlei Sprache und einerlei Brauch herrschen, ist schwach und gebrechlich.“
Das Lateinische wurde zur ungarischen Staatssprache und blieb es bis zum Gesetzesartikel XI vom Jahre 1836, der das Magyarische zur Sprache der Gesetzgebung, zum Artikel VI von 1840, der dieses zur obligaten Amts- und Kirchensprache für ganz Ungarn erklärte. (1844 wurde das von weit mehr als der Hälfte der Bevölkerung nichtverstandene Magyarisch dann für ganz Ungarn zur Unterrichtssprache erhoben.) Die Arpiden starben aus, ihnen folgten die Angiovi- nen. Sie brachten unter Ludwig dem Großen ein östliches „lateinisches“ Reich, dessen Zentrum in Ungarn lag. Von den Burgen in Visegrad und Buda aus umfaßte sein Herrschaftsbereich Polen, Ungarn und Teile Italiens. Wieder erwies sich der Kern als zu schwach. Nach einer nationalen SpätbliUe unter įlunyadi und Matthias Corvinu~, der in der Wiener Burg starb, brachen die Osmanen ein, unter denen sich die mittelungarische Ebene in die menschenleere „Puszta“ verwandelte. Das Land wurde geteilt und hat sein inneres Gleichgewicht damit verloren. Das nationalmagyarische Siebenbürgen und das „kaiserliche“ Westungarn fanden sich wohl wieder zur staatsrechtlichen Einheit zusammen, aber der tragende übernationale Gedanke Stephans des Heiligen ging in den Kämpfen der Bethlen, Bocskay, Bathöry und Raköczi in den Kuruzzenkriegen unter; die Stephanskrone hatte damit ihr glänzendstes Juwel, die Garantie ihrer Stabilität, verloren. Gewiß, von beiden Seiten sind damals und später schwerwiegende Fehler geschehen! Es sei nur an die unselige, überall gleich unheilvolle Germanisierungspolitik Josephs II. erinnert, dem diese nur ein taugliches Mittel zur Rationalisierung und Zentralisierung der Staatsgewalt und Verwaltung schien. Das Unrecht, das damals und später den Slawen wiederfuhr, konnte und sollte an Donau und Theiß kein Gegenstück finden! Aber noch war alles zu retten, neu zu gestalten.
Hier nun setzt jene Entwicklung ein. die jeden, der Ungarns Schicksal mitfühlend erlebt, mehr vielleicht noch jeden, in dessen Adern selbst magyarisches Blut rollt, wie ein Akt aus einer antiken Tragödie ergreift: diese Nation, deren ritterliche Großherzigkeit mit Recht sprichwörtlich ist, war in der Behandlung der Völker, mit denen sie das Geschick und letztlich ihr eigener Wille in eine unlösliche Gemeinschaft gebracht hatte, von einer verhängnisvollen Kurzsichtigkeit. War es das Gefühl, auf schwankem Boot im germanisch-slawischen Ozean zu treiben? Diese Überkompensation des Nationalen wurde dem Magyarentum zum Verhängnis, und es ist erschütternd zu sehen, wie die Augen auch wohlmeinendster und aufgeschlossener Ungarn von dieser Binde gehalten sind. Eine kurzsichtige Oligarchie, nicht „Wien“, wie Fekete- küty (S. 178), schreibt, „tat alles, um die Versöhnung zwischen Magyaren und Nichtmagyaren zu verhindern“. Diese Nichtmagyaren — bis zuletzt mehr als die Hälfte der Bevölkerung des eigentlichen Ungarn — hatten im Budapester Parlament sage und schreibe zusammen 25 Sitze. Kein verantwortungsloser Demagoge, sondern der königlich-ungarische Ministerpräsident Koloman v. Tisza hat ihnen in offener Sitzung das Wort entgegengeschleudert: „Ich werde sie mit Füßen treten!’ Die Zahl der deutschen Volksschulen in Ungarn ging von 1868 bis 1896 von 1200 auf 600 zurück, was der königlich-ungarische .Minister Wlas- sics als eine „sehr erfreuliche Tatsache bezeichnete, derselbe Minister, der die deutsche Sprache aus dem Lehrplan der ungarischen Mittelschulen strich. „Verderben wir die magyarische Intelligenz nicht mit einer fremden Sprache, die ein Bleigewicht ist beim Lernen und ein störendes Moment in der ganzen nationalen Kultur’, schrieb dazu, die Budapester Zeitung „Magyarorszag“. Wie den Deutschen, so noch schlechter erging es den Slowaken, den Ruthenen, den Rumänen. Muß hier noch an den Klausenburger Memorandumprozeß, an das Schulgesetz jenes Grafen Albert Apponyi erinnert werden, dessen staatsmännische Weisheit, wo sie von rein nationalistischen Komplexen nicht getrübt war, Europa bewundert hat? Dies eben ist die Tragik, daß auch die Augen solcher Männer „gehalten waren. Man wird an diese seltsame Befangenheit erinnert, wenn Feketeküty schreibt: „Die Magyaren taten kaum etwas in dieser Richtung“ (der Assimilierung, S. 176)! —
Der Ausgleich vom Jahre 1867 hatte der magyarischen Nation das potentielle Optimum an politischen Rechten gebracht — sehr zum Nachteil des Gesamtreiches. Eine einmalige geschichtliche Chance! Eingeborgen in eine immer noch mächtige Gesamtheit, in der sie eine nahezu selbständige, in vielen Belangen bevorzugte Stellung einnahmen, rieben sich die Magyaren an deren vergleichsweise geringfügigen Begrenzungen wund, um nach der durch ihr nationales Unverständnis mitverschuldeten. Zerstörung ins Nichts abzustürzen! Denn ihre Augen blieben „gehalten , für dasjenige, das ihre wohlmeinendsten Freunde längst erkannt hatten, so sehr „gehalten“, daß sie eben diese für ihre Feinde hielten.
Feketeküty ist ein ausgezeichneter — und dies sei ausdrücklich gesagt — weitgehend objektiver Kenner der Geschichte seines Landes, dem er mit jener unlösbaren Verbundenheit anhängt, die eine der schönsten Seiten des magyarischen Charakters ist. Die Einschränkungen, die im Vorstehenden gemacht werden mußten, können weder die Anerkennung seiner optima fides noch jene seiner unerschütterlich christlich-abendländischen Grundhaltung schmälern.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!