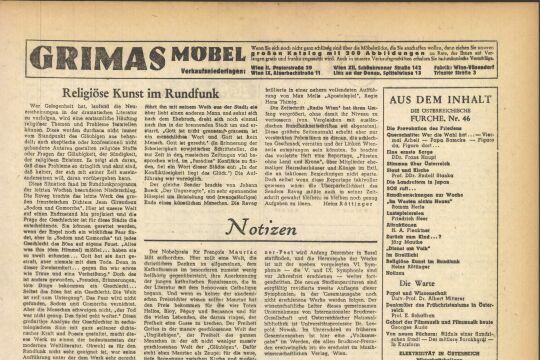Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Randhemerkungen zur woche
ZU STRASSBURG AUF DER SCHANZ hörten die europäischen Völker das Alphorn blasen, das sie an die große gemeinsame Heimat gemahnte und ihre alte Sehnsucht nach Einkehr in das europäische Vaterland erweckte. Aber die Klänge kamen aus der Ferne, nicht aus dem Europahaus in Straßburg, sie kamen aus den Herzen der Völker, nicht aus der Ministerversammlung und auch nicht aus der Konsultativver-sammlung. Sie erweckten in einigen Studenten den Wunsch, die Grenzschranken zu verbrennen, aber sie erweckten keinen Widerhall bei den Labour-Partisten, die, von Straßburg durch die Salzwasserzone des Kanals getrennt, ihr Herz mit einem Buchhalterbüro vertauscht hatten, wo die Vor- und Nachteile einer kontinentaleuropäischen Wirtschaftskonkurrenz gegen den Inselsozialismus abgewogen und für das Wohlergehen des eigenen Exports als zu schwer befunden wurden. In Gestalt eines belgischen Genossen wurde auch ein Festländer gefunden, der mit Zweifeln vom Kontinent her die Europaidee ins Irreale verwies und für einen stürmischen Schwanengesang der diesmaligen Europaversammlung sorgte. Was immer an Tragfähigem oder Nichttragfähigem dem Gedanken einer europäischen Integration zugrunde liegt, das braucht nach den Erfahrungen mit der jüngsten Europaversammlung zunächst gar nicht untersucht zu werden, denn nicht einmal die Form des Gedankenaustausches entsprach abendländischer Geistestradition. Was genügt, um die Enttäuschung voll zu machen.
DIE FESTSTELLUNG DER DEUTSCHEN
Bundeshymne hat kürzlich Bundeskanzler Dr. Adenauer unter Zustimmung seines Kabinetts in aller Stille vollzogen. Wie die „Westdeutsche Rundschau“ vermerkt, nötigte zu dieser Entscheidung die Biennale in Venedig. Dort sollten zwei deutsche Filme Preise für den „Dienst am Frieden“ bekommen. Diese Preise kann man aber zufolge allgemeiner Übung nicht ohne das Spiel der Staatshymne der Heimat der Preisträger verleihen. Dr. Adenauer und seine Minister entschieden sich für das bekannte alte Lied „Ich hab mich ergeben mit Herz und mit Hand“. Als Blüte des frühen Biedermeier 1820 entstanden, verfaßt von einem Führer der damaligen deutschen Turnerbewegung, einem Freunde Jahns, dem als Liederdichter fast vergessenen H. F. Maßmann, trägt das bescheidene Lied noch ganz die Art seiner Entstehungszeit an sich; die Bezeichnung Deutschland als „Hermannsland“ und die nicht eben schwungvolle Strophe: „Ach Gott, tu erheben — mein Herzensblut zu frischem freudigen Leben, zu frischem frohen Mut.“ Daß die westdeutsche Republik mehr Glück mit ihrer zur Staatshymne erkorenen dichterischen Ausgrabung hätte, als Österreich mit seinem ebenso altväterlichen und von dem Geschmack der Bevölkerung beharrlich abgelehnten Vereinskantus „Brüder, reicht die Hand zum Bunde“, kann man nicht mit Sicherheit behaupten.
•
DIE ÜBUNG DES AMERIKANISCHEN
Lebensstils, die Politik grundsätzlich vor der Haustür zu betreiben, hat in den letzten Tagen sogar das Erstaunen der asiatischen Kulis und die Besorgnis der amerikanischen Presse über einen neuerlichen Prestigeverlust bei den asiatischen Völkern hervorgerufen. Der amerikanische Prokonsul in Ostasien, General MacArthur, fand sich bemüßigt, an einen Veteranenkongreß in Chikago die Botschaft zu richten, die sich als richtiges strategisches Generalstabsexposi über die Bedeutung Formosas für die Verteidigung des amerikanischen Kontinents der überraschten Weltöffentlichkeit darstellte. Nicht genug an diesem vor das Haustor getragenen häuslichen Geheimnisse, wandte sich Präsident Txuman unter Wahrung aller Regeln der Publicity angesichts der versammelten Journalistik gegen die Formosadoktrin Mac Arthurs und sah sich gedrängten einem gleichfalls veröffentlichten Schreiben an den. eigenen Delegierten bei der UNO die außenpolitischen Richtlinien des Weißen Hauses im Falle Formosas bekanntzugeben. Die Stimme der Bürokratie Amerikas unterstrich natürlich die Kompetenz des Präsidenten in außenpolitischen Angelegenheiten, während die parlamentarische Opposition gegen den Präsidenten einen öffentlichen Angriff mit einem Wortschatz führte, den man sonst hur auf den Schallplatten der sogenannten Feindpropaganda hört. Bei köpf schüttelnder Betrachtung des ganzen Falles kommt der Normaleuropäer mit seinem natürlichen Schamgefühl gegenüber Familienzwistigkeiten zu dem Ergebnis, daß man in Washington offenbar einem optischen Irrtum unterlag: Man hat nicht bemerkt, daß vor den häuslichen Szenen des Wahlkampfes die Trennungswände zur weltpolitischen Arena längst weggezogen waren; man glaubt, noch unter sich zu sein, während längst dir letzte Kuh-hirte im fernen Belutschistan auf die Stimme Amerikas lauscht und vielleicht auch erahnt, daß nur im Zeichen der Würde die Freiheit das Maß einer in sich ruhenden, festgefügten Ordnung besitzt
DAS ABKOMMEN, DAS ERZBISCHOF
Dr. Grosz von Kalocsa mit der ungarischen Regierung schloß, in dem von Seiten der Kirche volle Anerkennung der Staatsordnung der ungarischen Volksrepublik, deren Unterstützung und das Vorgehen gegen andersstrebende Geistliche zugesichert wird — als Gegenleistung wird die Gestattung von acht katholischen Klosterschulen und das Weiterbestehen einer gewissen Anzahl religiöser Orden sowie ein Staatszuschuß für die Bestreitung der Kirchenbedürfnisse zugesagt —, enthält in seinem zweiten Teii die Erklärung der Regierung, daß sie „in Sinne der Verfassung der Volksrepublik den katholischen Gläubigen volle Glaubensfreiheit und der katholischen Kirche v olle Wirkungsfreiheit garantiert“. — Man wird in einiger Zeit sehen, wie diese Bürgschaft eingehalten wird. Danach wird man den Wert dieses Abkommens, das auf 18 Jahre geschlossen wurde, beurteilen müssen. Der Erzbischof von Kalocsa beruft sich darauf, daß er vom ungarischen Episkopat dazu beauftragt worden sei und „die Rechte des Heiligen Stuhles nicht verletzt wurden“. Rom ist anderer Ansicht: eine kurze Meldung stellt vorläufig fest, daß dieser Pakt iaeit über die Kompetenzen des ungarischen Episkopats hinausgehe.,
DIE STAATSGRÜNDUNG VON ISRAEL, unter Blutvergießen und Flüchtlingselend geboren, wird immer deutlicher zu einer drückenden Sorge für die Lenker des kleinen Gemeinwesens und dessen Bewohnerschaft. Die Frage nach der Lebensfähigkeit des Staates, soweit sie aus eigener Kraft und nicht durch Geldtribute der internationalen Judenschaft gesichert werden soll, kann schwerlich heute schon bejaht werden. In der Wochenschrift „Neue Welt und Judenstaat“ (Nr. 50) ergreift Ignacy Lipinski als Mann der Wirtschaft das Wort zu einer' recht kritischen Vorstellung an die Berufenen: Er sieht für den Judenstaat „schwerste Krisenerschütterun-g e n“ voraus, „die nicht vermieden werden können, wenn nicht ausländisches Kapital und ausländische Fachleute in viel größerer Zahl als bisher ins Land gezogen werden. Dies hat aber zur Voraussetzung“ — fährt der Autor unmißverständlich fort —, „daß die Haltung des Staatsapparats Israels gegenüber dem Unternehmer sich ändere, von den Ministerien bis zu den Konsulaten. Solange man das Unternehmertum im Grunde ablehnt und das Kapital verabscheut und nur zähneknirschend Maßnahmen wie die zur Förderung der ausländischen Investitionen beschließt, wird der Erfolg auf sich warten lassen.“ Mit anderen Worten: Der doktrinär-kommunistische Zug in der Führung des kleinen Staates ergänzt die bedrohliche wirtschaftliche Entwicklung, mit der. das kleine Staatswesen ohnehin zu ringen hat; seine agrarische Eigenproduktion deckt nur 2 0 Prozent des Eigenbedarfes. Und dies trotz der anerkennenswerten Leistungen land-wirtschaftlichenSiedlungswesens,dessenKol-lektivSiedlungen fast drei Viertel des jüdischen Bodenanbaues bestreiten. Von den in der letzten Anbauperiode kultivierten 121.400 ha wurden nur 63 Prozent von Juden bebaut; zwar war dies eine Vermehrung um 41.400 ha gegen das Vorjahr, aber diese Zunahme wurde vornehmlich erreicht durch die arabische Bevölkerung, die der Krieg von den Heimstätten verjagt hatte, und die nach ihrer Rückkehr ihre Bodenbearbeitung um 250 Prozent steigern konnte. Der jüdische Nationalstaat, der die bodenständige arabische Bevölkerung so hart angefaßt hat, muß jetzt froh sein, die Araber zu haben. Er wird noch viel dazu-lernen müssen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!