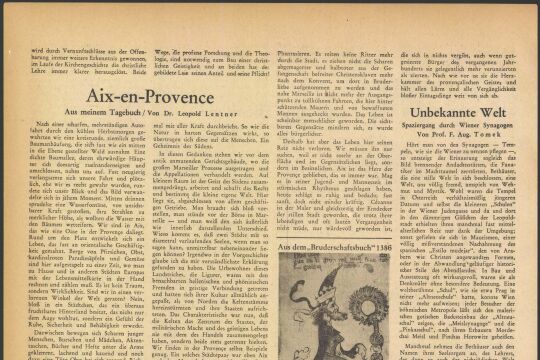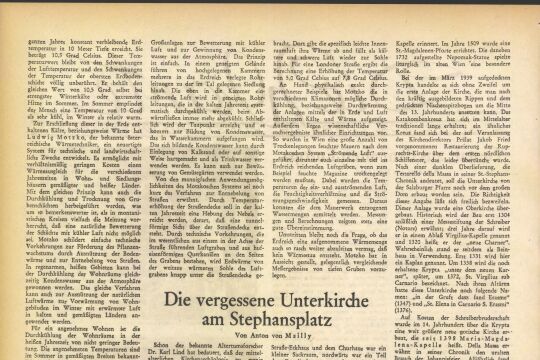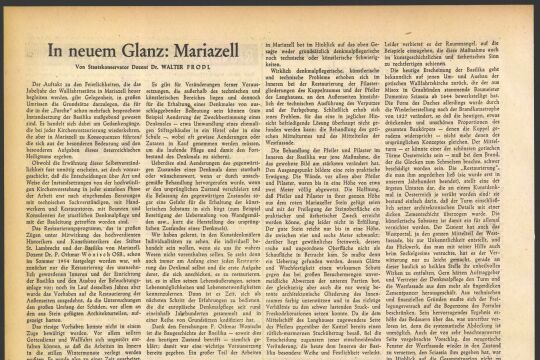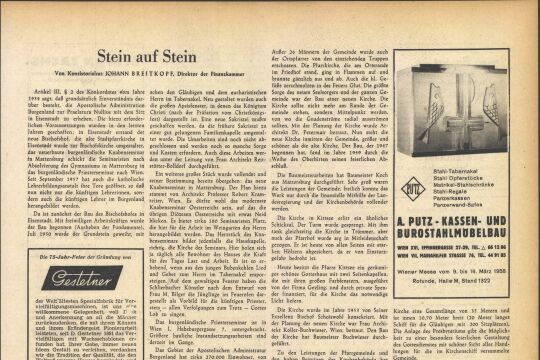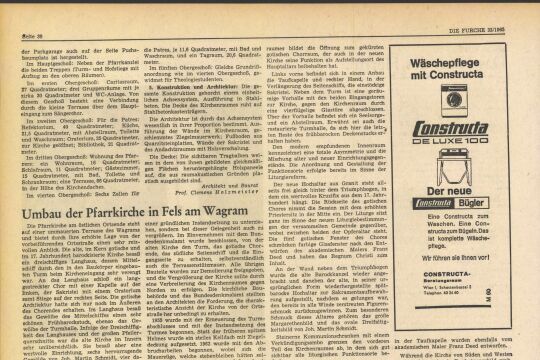Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
St. Veit an der Glan
Daß die ehemalige Klosterkirche von St. Veit an der Glan vor drohendem Verfall bewahrt wurde und in neuem Glanze wiederersteht, ist vor allem der unermüdlichen Energie des Pfarrherrn von St. Veit, Dechant Dr. Fössl, zu verdanken. Noch vor wenigen Jahren schien das Schicksal dieses altehrwürdigen Baues besiegelt, denn seit dem Auszug der letzten Franziskanermönche aus dem Kloster zu Beginn des 19. Jahrhunderts verfiel das Klostergebäude (das bereits 1850 als Ruine bezeichnet wurde); das zugehörige Gotteshaus, seiner Betreuer beraubt, verwahrloste zusehends. Noch vor gut 10 Jahren dachte man allen Ernstes daran, die prachtvollen, jedoch vom Holzwurm befallenen Schnitzaltäre durch Abgabe an andere Pfarrkirchen zu retten. Der am stärksten wurmbefallene — in der nordseitig an die Kirche angebauten Kapelle stehende — Altar gelangte auf diese Weise als Hochaltar in die Pfarrkirche von Nötsch im Gailtal. Der Versuch des Denkmalamtes, durch Sanieren und Restaurieren eines besonders wertvollen Schnitzaltares die Restaurierung der Kirche einzuleiten, schlug fehl. Diese auch von der Stadtgemeinde finanziell unterstützte Aktion erbrachte nicht den gewünschten Erfolg. Erst der tatkräftige neue Pfarrherr ließ sich trotz der ungeheuren Schwierigkeiten, die sich dem Vorhaben entgegenstellten, nicht davon ab- schrecken, unverzüglich ans Werk zu gehen.
Die ehemalige Klosterkirche, südwestlich vor dem alten Mauerring der Stadt stehend, wurde 1323 von Konrad von Aufenstein und seiner Gemahlin Diemut als Klosterkirche für Clarissinnen erbaut. Sie ist ein wohlproportionierter, sechsjochiger Saalbau mit dem hierzulande seltenen, aus vier Seiten des Sechseckes gebildeten Chorschluß; ein Raum, den ein Kreuzgewölbe auf hoch angebrachten Sporenabsätzen ziert, den keine Triumphbogenwand unterteilt.
Bereits in der Reformationszeit drohte diese frühgotische Bettelordenskirche zugrunde zu gehen. Das Kloster, aus dem die Clarissinnen ausgezogen waren, diente jahrzehntelang als Herberge. Als während der einsetzenden Gegenreformation Jesuiten Kirche und Kloster übernehmen sollten (1622), lehnten sie dieses Angebot wegen des desolaten Zustandes der Baulichkeiten ab. Damals traten die Franziskaner als Retter des gefährdeten Komplexes auf. Sie übernahmen ihn 1638, erbauten das Kloster weitgehend neu, setzten die Kirche instand, fügten ihr südseitig eine Kapellenreihe an, die durch hohe schmale Arkaden mit dem Kirchenschiff verbunden ist. An die Nordseite des Presbyteriums stellten sie eine große, später als Sakristei verwendete Kapelle (1667.). Sie ersetzten aber auch die gotischen Spitzbogenfenster durch breitere, mit geradem Sturz und schufen die heute noch vorhandenen — mit Ausnahme des Hochaltares — aus dem 17. Jahrhundert stammenden Schnitzaltäre.
Als 1962 die Arbeiten an und in der Kirche in Angriff genommen werden sollten, galt es zunächst, die überaus stark durchfeuchteten Mauern trockenzulegen, die wurmzerfressenen Altäre, vor allem den bereits einsturzgefährdeten Hochaltar, zu retten. Das Arbeitsprogramm erfuhr dadurch eine Erweiterung, daß eine Innenrestaurierung nur dann den erwünschten Erfolg erbringen konnte, wenn die in der Barockzeit verbreiterten, oben waagrecht abgeschlossenen Chorschlußfenster wieder auf die ursprüngliche, auf die gotische Form gebracht würden; wenn durch schmälere, entsprechend verglaste Chorschlußfenster die Blendwirkung gemildert, der raustau- rierte Hochaltar trotz seiner farbigen Fassung nicht mehr als ‘schwarze Silhouette vor den riesigen, hell verglasten Fensterflächen erscheint. Es lag nahe, dem Raumbild zuliebe auch die übrigen barockveränderten Fenster auf ihre ursprüngliche Form zu bringen.
Allein das Trockenlegen der feuchten Mauern schien zunächst undurchführbar. Um an der Südseite der Kirche einen Entfeuchtungsgraben anzulegen, galt es, dort einen vor Jahrzehnten angebauten Schuppen abzutragen. Diesem Vorhaben versagte der Besitzer des seinerzeit unerlaubt errichteten Anbaues seine Zustimmung; selbst die von ihm angerufene letzte gerichtliche Instanz Österreichs gab dem Schuppenbesitzer recht. Sie begründete ihr Erkenntnis damit, daß der störende, auf Privatgrund stehende Anbau nur von besagtem Privatgrund aus als störend empfunden werden könne, obgleich ein Ortsaugenschein dieses Urteil gewiß verhindert hätte. Daß es dennoch gelang, den Anbau zu entfernen, besagt genug über die Schwierigkeiten, die das Restaurierungsvorhaben schon zu Beginn beinahe zum Scheitern brachten. Nicht genug damit, für das Trockenlegen der durchnäßten, nordseitig tief in der Erde steckenden Kirchenmauer bot eine Firma aus Wien ein mit Garantie versehenes Injektionsverfahren an. Allein für dieses Vorhaben hatte der Pfarrherr S 120.000.— aufzubringen. Besagte Mauer, die innerhalb von acht Wochen ausgetrocknet sein sollte, blieb jedoch naß wie zuvor; der darauf angebrachte Putz trocknete nicht. Er wurde von besagter Wiener Firma wieder abgenammen und neuerlich eine garantiert wirksame Sanierung durchgeführt. Wie die gründliche, nach neuesten Erkenntnissen vorgenommene Untersuchung durch die
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!