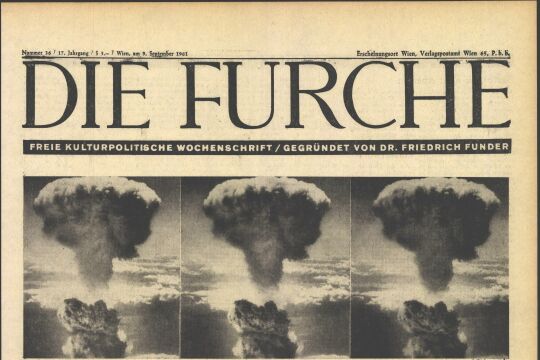In der politischen Auseinandersetzung hat der Pazifismus - leider Gottes - die Stimme verloren.
Während Österreich mit sich selbst - genauer: mit den Rüpeleien politischer Wortspender - befasst ist, bleiben die relevanten Diskussionen der Gesellschaft ungeführt. Der 11. September liegt zurück, und seine Auswirkungen scheinen zumindest den Alltag wenig zu betreffen.
Stellvertreter agieren: Die USA, Stellvertreter der demokratischen Welt, führten und führen mit stellvertretender Unterstützung einiger Bataillone Europas einen stellvertretenden Krieg in Afghanistan, einem Land, das stellvertretend für den Terrorismus steht. Auf diesen Krieg musste man sich, wird der Menschheit glauben gemacht, stellvertretend für den Weltfrieden einlassen.
Kein Wunder, dass man hierzulande und in Europa wieder zur Tagesordnung übergeht: Da Substituten, mit finanzieller wie moralischer Zuwendung ausgerüstet, in den Kampf gezogen sind, bleibt Zeit genug, sich in eigene Polit-Scharmützel zu verstricken. Das ist kein österreichisches Spezifikum, die Temelín-und-die-Folgen-Debatte scheint nur schillerndstes Beispiel obigen Befunds zu sein.
Auch in Deutschland ist kaum anderes zu konstatieren: Die große gesellschaftliche Debatte, wie auf die globalen Herausforderungen und Bedrohungen einzugehen wäre, wird bestenfalls leise geführt. Ein Indiz dafür ist nicht zuletzt das Verstummen der Grünen beim Nachbarn: Jene Partei, die den Pazifismus auf die Fahnen geheftet hat, ist - nach nur kurzen Eruptionen - auf die Linie eines "politischen Pazifismus" eingeschwenkt, wie es Ludger Volmer, grüner Staatsminister im Berliner Außenamt, Anfang Jänner in der Frankfurter Rundschau formulierte. Ein Euphemismus - gemeint ist nichts weniger, als dass sich auch die Grünen auf die militärische Option einlassen. Volmer: "Pazifismus heute kann militärische Gewalt als Ultima Ratio, als letztes Mittel nicht leugnen."
Volmers Chef, Außenminister Joschka Fischer, kann als Personifizierung dieses Prinzips gelten: Dass er, erstmals in der kurzen, bewegten Geschichte der Grünen, als Spitzenkandidat in den Bundestagswahlkampf zieht, hat auch mit dem endgültigen Paradigmenwechsel der Grünen hin zur Pragmatik zu tun, die beispielsweise Pazifismus und Militär unter einen Hut zu bringen imstande ist.
Derartige Entwicklung ist beileibe nicht auf die deutschen Grünen beschränkt, sondern hat den gesamten Diskurs in der Gesellschaft erfasst. Radikalpazifistische Positionen werden zur Zeit gering geschätzt. Ludger Volmers zitiertem Essay (Titel: "Was bleibt vom Pazifismus") folgte in der Frankfurter Rundschau eine mehrwöchige Debatte. Ein herausragender Beitrag dabei kam am 24. Jänner von Harald Müller, Vorstand der angesehenen Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung. Müller, persönlich keineswegs ein radikaler Pazifist, brach darin eine Lanze für einen "unbedingten Pazifismus": Die Mainstream-Position geht zur Zeit vom Recht, ja von der Pflicht zur Durchsetzung der Menschenrechte aus. Dazu - so argumentieren auch die Fischer und Volmer - kann Gewaltanwendung nötig sein.
Friedensforscher Müller aber meint in seinem Essay: Nicht nur die unbedingte Durchsetzung der Menschenrechte ist ein legitimes politisches Anliegen, sondern auch der radikale Gewaltverzicht, von der der unbedingte Pazifismus ausgeht.
Nachhaltig lösen
Zur Zeit haben sich die Gewichte eindeutig vom Pazifismus weg verschoben, und Müller dringt darauf, dass es wichtig sei, beide Pole - Streiten für die Menschenrechte, Streiten für Gewaltverzicht - als wichtig für den Diskurs über Sicherheit, Krieg und Frieden zu begreifen.
Pazifistische Positionen sind aber leise geworden. Dabei gäbe es genug Gründe, sie gerade jetzt zu Gehör zu bringen:
* Wer vermag noch zu glauben, dass die Gewalt als "Ultima Ratio" in der verzweifelten Lage in Israel und Palästina noch etwas zu lösen imstande ist?
* Konnten je nachhaltige Erfolge gegen den Terrorismus erzielt werden, ohne substanzielle Methoden gewaltfreier Konfiktlösung?
Zur Zeit sind es jedoch ganz wenige, die unermüdlich wider die Gewalt auftreten, die gehört werden, und die so auch ein Pol der politischen Auseindersetzung sind. Es wäre gefährlich, wenn auch sie verschwänden.
Präsident George W. Bush stellte dieser Tage den US-Verteidigungshaushalt 2003 vor - mit Mehrausgaben von 48 Milliarden Dollar: Darob entzündete sich nur eine schaumgebremste politische Debatte - der friedensbewegte Teil der Gesellschaft ist schwach und leise. Das sollte alarmieren.
Dennoch gibt es auch andere Zeichen: Vor einer Woche lud der Papst die Führer von Kirchen und Religionen nach Assisi, um für Frieden zu beten und zu sprechen. Diese Zusammenkunft hat keine unmittelbar realpolitischen Auswirkungen; dennoch war klar, dass viele der skizzierten Anliegen und einige der Akteure hier wiederzufinden waren (kein Zufall, dass die Frankfurter Rundschau, kaum kirchennah, den Papst jüngst als "einsamen Pazifisten" bezeichnete): "Basisbewegte", die seit Jahren im Hintergrund tätig sind; eine überzeugte und überzeugende Symbolgestalt wie Johannes Paul II., der gegen alle Widerstände im eigenen Haus die Idee durchsetzte - er und die anderen Religionsführer schworen jedem "Rückgriff auf Gewalt und Krieg im Namen Gottes" ab und verpflichteten sich, sich den "Schrei derer zueigen zu machen, die nicht vor Gewalt und vor dem Bösen resignieren".
Man darf gerade Letzteres auch als Appell nehmen, die Argumente des Pazifismus und die Methoden der Gewaltfreiheit wieder in die Auseinandersetzung einzubringen. Sie sind notwendiger denn je.