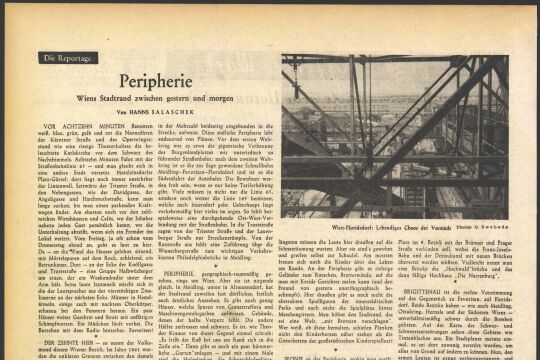Der gebürtige Wiener Heinz Jirout lebt seit über dreißig Jahren als Architekt in Berlin. Die FURCHE sprach mit ihm über die Unterschiede der beiden Metropolen.
"Friedrich Wilhelm IV. war ein großer Bauherr, überzeugt vom Gottesgnadentum.“ Heinz Jirout steht inmitten einer Gruppe von Besuchern, denen er eine architektonische Führung auf der Museumsinsel in Berlin angedeihen lässt. Er deutet auf die Statue hinter sich: "So wie hier auf dem Pferd sitzend dargestellt war der deutsche Kaiser wohl eher selten anzutreffen.“
Heinz Jirout, Jahrgang 1961, ist gebürtiger Wiener und Architekt. Die architektonischen Stadtführungen sind eines seiner Standbeine. Mittlerweile hat er mehr als die Hälfte seines Lebens in der deutschen Hauptstadt zugebracht. 1981 kam er hierher und begann mit dem Studium an der Technischen Universität. "Es war ein wilder Sommer“, erinnert er sich. "Mit Hausbesetzungen und Demos.“
Anfangs, in den 1980ern, wohnte er in einer "Riesen-WG“ in Kreuzberg: "In dem Haus gab es Säcke voll Biobrot, Badeöfen mit Briketts und Kaninchen in Ställen im Hof.“ Wien war in die Ferne gerückt, "mit seiner melancholischen Grundstimmung - da wäre ich heute noch nicht mit dem Studium fertig“. So war seine Heimatstadt erst einmal für ihn "lange gestorben“, sagt Heinz Jirout. "Von Atomkraft bis Glykol-Wein durfte man sich ja nicht äußern.“
Irgendwann setzt für jeden Auswanderer die Versöhnung ein. Ende 1990, als er den Zivildienst in Österreich nachholen musste, wäre Jirout sogar bereit gewesen, wieder daheim zu bleiben. Aber: "Das hat mir den Rest gegeben.“ Er war der Caritas zugeteilt worden, die damals in den Gärten Kagrans ein Flüchtlingsheim betrieb, und nennt heute zwei Phänomene, die ihn zur Rückkehr nach Deutschland veranlassten: "Irgendwann teilt man das Anliegen der Leute nicht mehr“, formuliert er vorsichtig und meint damit die schwarzen Schafe unter den Flüchtlingen, die lediglich auf persönlichen Vorteil aus sind. "Aber mit ihnen durch Wien zu gehen, zum Arbeitsamt, zur Fremdenpolizei - das war auch eine Aufgabe.“ Insbesondere die entwürdigende Behandlung der Menschen durch die Fremdenpolizei ließ Jirout seiner Heimat wieder den Rücken kehren.
Polyzentrisches Berlin
"Im Ergebnis ist es hier offener“, urteilt der Architekt über Berlin. "In Wien herrscht eine sehr allgemein formalisierte Oberfläche, die den Alltag erleichtert, aber die Grenzüberschreitung ist viel schneller da.“ In Berlin hingegen vermisst er heute das bürgerliche Element. Auch die Kaiserzeit ist aus der Stadt verschwunden und komplett untergegangen. Aber: "Die Gesellschaft war schon immer sehr heterogen.“
Womit Heinz Jirout wieder im angestammten Metier ist, bei der Architektur: "Bis in die Kaiserzeit gab es hier eine Kernstadt mit Städten rundum. Schöneberg baut noch zum Ende der Kaiserzeit dieses riesige Rathaus oder Charlottenburg das große Tor.“ Wesentlich sei der Referenzrahmen für die Menschen, die in einer Stadt lebten: "In Wien ist es der Stephansdom und der erste Bezirk. Hier ist es die Karl-Marx-Straße für die Neuköllner oder der Kurfürstendamm für die Charlottenburger.“ Die Subzentren hätten in Berlin eine viel stärkere Wirkung als der Gesamtbezug. "Das macht viel aus, wenn eine Stadt offener ist, weil man sich hier immer neu sortieren muss.“
Es gibt noch andere gewaltige Unterschiede zwischen beiden Städten: "In Wien ist viel mehr Geld da“, sagt der Architekt. "Was es da an Infrastruktur gibt, da schaut man nur mit großem Neid.“ In Wien würde der Bau mehrerer U-Bahnlinien zugleich begonnen, in Berlin werde eine einzige Linie derzeit nur deshalb gebaut, weil der Bund schon so viel vorfinanziert habe und eine Auszahlung die Stadt noch viel teurer zu stehen kommen würde. "Die Gegenüberstellung zu Wien macht einen sprachlos. Wie die Sachen nach Abschluss aussehen, das ist kein Vergleich.“
In Berlin arbeitet Heinz Jirout selbständig. Kurze Zeit war er angestellt bei der Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten: "Natürlich ist es schöner zu wissen, dass das Geld fix und die Rente einbezahlt ist, aber jeden Tag um halb neun in Potsdam sein zu müssen, ist der Preis der Freiheit.“So war er anfangs bei der Renovierung des Preußischen Landtags, heute Sitz des Berliner Landtags, dabei. "Das war spannend, weil es den Übergang von West-Berlin zu Neu-Berlin zeigte.“ Soll heißen: Die alte Westberliner Bau-Mafia war noch spürbar, aber es waren schon andere Zeiten nach der Wende angebrochen.
Verbindung von Alt und Neu
Später arbeitete Jirout für den Gewinner des Wettbewerbs zur Neugestaltung des Neuen Museums, David Chipperfield. Drei von zwölf Jahren Neu-, Um- und Ausbau. Bis in die 1980er Jahre war dieses Haus der Museumsinsel eine Nachkriegsruine mitten in der Stadt geblieben, obschon die DDR-Regierung lange eine Renovierung vorhatte, für die aber die Mittel fehlten.
Beim Gang durch die Museumsräume mit Heinz Jirout zeigt sich die ganze Leistung, die an diesem Haus vollbracht wurde, um Alt und Neu harmonisch zu verbinden. Da wurden, wie schon für den ersten Bau, Tontöpfe für die Decke nachgeformt, um den Druck auf die möglichst schmal gehaltenen Außenwände gering zu halten. Der Baumeister Friedrich August Stüler hatte damals neue technische Mittel eingesetzt. Vieles musste nun aufwändig nachproduziert werden. Heinz Jirout erzählt von der Farbe für den Boden eines Saals, der dem Museumsdirektor "zu gelb, zu vor-antik“ war. Es dauerte dann weitere eineinhalb Jahre, bis die gewünschte Mischung aus einem speziellen Steinbruch den antiken Gegenständen, die hier ausgestellt werden sollten, entsprach.
Boom - das Gegenteil von Qualität
Die Überlegung, Berlin, das nach der Wende zu einer einzigen Baustelle wurde, müsse ein Dorado für Architekten sein, wischt Heinz Jirout vom Tisch: "In den 1990er Jahren musste jedes europäische Büro hier eine Dependance eröffnen. Aber viele Geschäfte werden anderswo gemacht. Das war ähnlich wie mit der Kunst, den Galerien etwa.“ Mit der Krise um die Jahrtausendwende seien viele große Büros wieder verschwunden. Hinzu komme: "Boom ist ja immer das Gegenteil von Qualität.“ Sein Beruf habe sich sehr verändert, meint der Wiener in Berlin: "Weder die Außensicht noch die Innensicht entspricht tatsächlich dem Bild des Architekten.“
Heute wohnt Heinz Jirout mit seiner Frau in einer ruhigen Seitenstraße in Schöneberg. Der Altbau ist für einen Architekten wie ihn ein aufgeschlagenes Buch: Der Stuck an der Decke als typisches Merkmal Berliner Wohnens von einst, aber die merkwürdigen Staffeln unter den Türen zwischen den Zimmern. Auch der Bodenbelag ist in Wien anders: Während da Parkett oder Hölzer in bestimmten Mustern verlegt wurden, kennt man in Berlin nur grobe Dielenböden, in zwei Farben gestrichen: rostbraun oder grau. Es ist der andere Schnitt der Zimmer, der Einbau der Fenster, was Berlin von Wien unterscheidet. Auch die soziale Gliederung in den Gebäuden - von der Beletage bis zu den niedrigen Zimmern unter dem Dach - im Unterschied zu sozialen Unterschieden nach Stadtvierteln.
Den Begriff "Heimweh“ umschreibt Heinz Jirout mit einem Beispiel: "Es gibt manches, das einem fehlt. Der Park Charlottenburg wird mir nie so nah sein wie der von Schönbrunn, wo ich mich herum getrieben habe, wenn ich zu spät zur Schule gekommen bin.“ Ob er zurück gehen würde nach Österreich? "Durchaus, wenn es einen Auftrag gibt, auch für längere Zeit.“ Für immer? Schulterzucken. "Erst mal so - nein.“