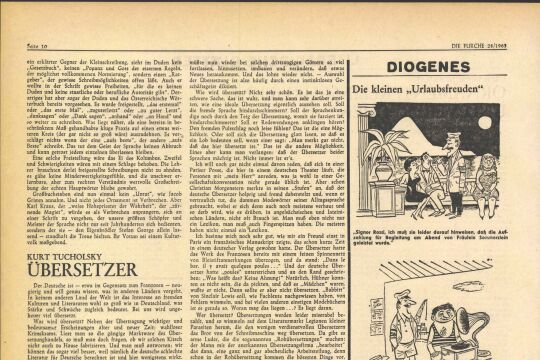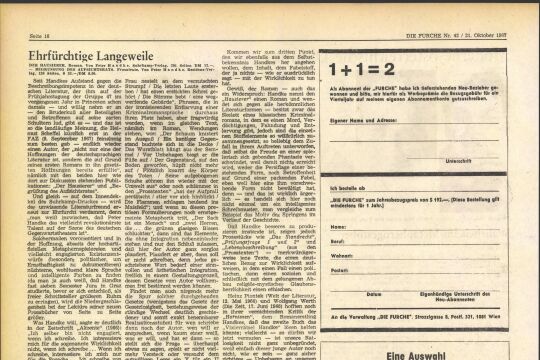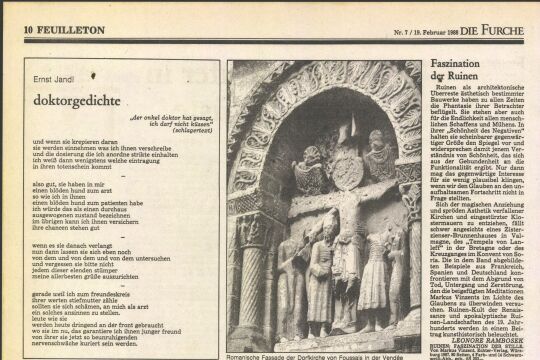Wie zeitgenössische Autoren Romane aus dem eigenen Leben machen und in der Fiktion der Wahrheit auf den Grund gehen.
Das Buch muss die "Axt sein für das gefrorene Meer in uns“, schreibt Franz Kafka. Natürlich spricht der Autor hier von sich selbst. Es ist das eigene Leben, aus dem er den Angststoff für seine Romane nimmt. Doch andererseits ist K. nicht Kafka, und der Roman "Der Proceß“ erzählt nicht das Leben des Autors, sondern das eines etwa gleichaltrigen Bankangestellten. Imitation und Simulation sind zwei Betrachtungsseiten lebensnaher Literatur. Wenn Autoren ihr eigenes Lebensleiden also episch in Form bringen, durchbrechen sie eine doppelte Eisschicht: die über der eigenen Seele und unsere oft allzu glatten Leserbenutzeroberflächen. Die alte Frage, wie man Dichtung und Wahrheit unterscheiden kann, verschiebt sich. Wie und warum eigentlich erzählt das Autor-Ich von sich als einem Anderen?
Inzwischen ist die Gegenwartsliteratur wieder beim Ich des Autors gelandet. Es begann mit Familienromanen. Nach dem Mauerfall entdeckten Autoren beim Stöbern in Familienalben den Stoff für opulente Erinnerungsbücher. Daneben gab es immer wieder mal eine Literaturbetriebsgeschichte als Schlüsselroman (z. B. von Thomas Glavinic) und saisonale Wellen autobiographischer Romane, die besten darunter stammen von Hanns-Josef Ortheil, von Arnold Stadler und Martin Walser.
Leben und Angst
Von etwas Neuartigem künden die Bücher, die David Wagner und Dirk Kurbjuweit geschrieben haben. Sie tragen nur ein Wort im Titel, das existentiell wuchtig und auf Anhieb verständlich ist, mit einem kaum zu steigernden Anspruch auf Allgemeingültigkeit: "Leben“ und "Angst“. Das geht jeden etwas an, zielt aber erst einmal nur auf den Autor und auf eine besondere Lebensepisode. Dennoch wollen Wagner und Kurbjuweit weder mit einer Autobiographie noch einer klassischen Romanfiktion auftrumpfen. Auch von der Spielfreude mit alternativen Selbstentwürfen - wie sie Felicitas Hoppes Roman "Hoppe“ inszeniert - sind ihre Bücher weit entfernt. Das erzählende Ich trägt ja nicht den Namen des Autors.
Beide Geschichten sind in der Ich-Form erzählt, sie handeln von Krankheit und Paranoia und lassen die schützende Distanz zwischen Fakten und Fiktionen schmelzen, aber nur soweit, dass man das Erzählte noch vom ungeschminkten Selbstgeständnis trennen kann. Man könnte diese Bücher Lebenserfahrungsgeschichten in Grenzsituationen nennen. Denn ihre Autoren sind als "interne Ermittler“ der eigenen Seele tätig, wie Salman Rushdie, der von den Schreckensjahren seiner Fatwa-Bedrohung in seinem Lebensroman "Joseph Anton“ erzählt (der Titel ist sein Deckname im Exil und eine Hommage an seine Lieblingsautoren Conrad und Tschechow).
Dirk Kurbjuweits "Angst“ erzählt von einer heftigen Stalking-Attacke. Mit seiner Frau und zwei kleinen Kindern zieht der Erzähler in eine gediegene Berliner Altbauwohnung, Hochparterre, ruhige Lage, die Sache hat nur einen Haken. Der Untermieter entpuppt sich alsbald als ein unausstehlicher Stalker, der die Ehefrau mit Zweideutigkeiten belästigt und das Ehepaar auf angeblichen Kindesmissbrauch verklagt. In solchen Fällen muss die Polizei dem Verdacht nachgehen. Die Verleumdung richtet Schaden im Alltag der Familie an, untergräbt das Ehevertrauen und lässt die Rachegelüste des Erzählers anwachsen. Von Polizei und Recht - den höheren Gewalten, auf die man sich in solchen Fällen zu verlassen glaubt - fühlt sich die Familie nun verlassen. Am Ende gibt es eine Pistole und einen tödlichen Schuss, der Vater des Erzählers - beide kennen sich mit Waffen aus - geht ins Gefängnis.
Kurbjuweits Buch ist ein Psychothriller mit wahrem Hintergrund. Der Autor hat bald nach Erscheinen in Interviews enthüllt, dass er die Geschichte vor etwa acht Jahren selbst durchgemacht hat. Das macht die Geschichte nicht glaubwürdiger, aber tiefgründiger. Dem paranoischen Plot hat der Autor eine psychologisch wasserdichte Verpackung und eine kriminalistische Struktur gegeben. Im Unterschied zum Buch ist das Leben gnädiger mit dem Stalker umgegangen. Kein tödlicher Schuss von der Kanzel der Selbstjustiz; Kurbjuweit ist aus der Wohnung ausgezogen. Die literarische Imagination erlaubt indessen, was im realen Leben nicht straflos ausgehen darf. Die tiefere Wahrheit des am Ende geänderten Plots besteht darin, wie Kurbjuweit in einem Spiegel-Essay schreibt, dass der Autor sich als einen anderen erfindet, der sagen kann, was ihm weh tut, und daraus Konsequenzen ziehen kann, die im realen Leben tabuisiert sind. "Wer einen Roman aus dem eigenen Leben schreibt, entscheidet sich gegen die Wahrheit, um der Wahrheit auf den Grund zu gehen“.
Gewissenserforschung
"Leben“ heißt das mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnete Buch von David Wagner, das sich der Gattungstaufe entzieht und deshalb sowohl zum Romanhaften wie auch zum Sachbuch neigt. Das autobiographisches Schreiben simulierende Ich erzählt die Geschichte einer Lebertransplantation. Es ist David Wagners eigene Lebens- und Krankheitsgeschichte mit einer Autoimmunhepatitis. Sie geht buchstäblich unter die Haut und verschont weder laienhafte noch fachkundige Leser mit den schmerzhaften und leidvollen Details der Krankheit. Dennoch ist "Leben“ kein reines Krankenhausbuch und keine Reportage über die Transplantationsmedizin. Es ist ein ethisches Buch, eine Gewissenserforschung in humanistischem Geiste, ohne je zum vordergründigen Weckruf für Organspenden zu werden.
David Wagner hat, sechs Jahren vor Erscheinen des Romans, eine fremde Spenderleber erhalten, was der Klappentext des Buches verschweigt, der 1971 geborene Autor aber selbst erläutert hat: "Alles war genauso und doch ganz anders“. Eine vielsagende Formel: "Leben“ beruht auf Selbsterlebtem, wenn auch das Leben die Literatur nicht erfindet, sondern gute Bücher ein interessantes Leben erst zu einem exemplarischen, erzählbaren Leben machen.
Nicht wehleidig oder mit der Wut des Nichtverstehens, vielmehr sachlich, wo nötig, und ironisch, wo möglich, manchmal auch mit satirischem Einschlag, etwa in einem Erzählreigen sonderbarer Todesarten, lesen wir von dem Leben des leberkranken jungen Mannes, dem es jahrelang relativ gut geht, weil er die Nebenwirkungen, von denen eine durch hohen Ammoniakspiegel verursachte Müdigkeit die hartnäckigste ist, zu beherrschen gelernt hat. Doch plötzlich kommt es zu einer heftigen Blutung in der Speiseröhre. Eine Odyssee durch Krankenstationen beginnt.
Wir erfahren, wie der Patient von Kopf bis Fuß vermessen und durchleuchtet wird. Welch große Wirkungen kleine Diagnosen haben. Zu welchen Zwecken Ärztinnen und Studenten an sein Bett kommen. Aber auch, dass ein Krankenhaus mit seinen Routineabläufen ein sterbenslangweiliger Ort sein kann, in dem man sich vor der ungefragt ins Ohr geklagten Krankengeschichte des Bettnachbarn graust und wo man sich insgeheim danach sehnt, dass der Flur einmal zu einem "Grand Boulevard“ wird.
Ethische Fragen
Am stärksten ist Wagners Buch da, wo es hinter der Sprache ärztlicher Bulletins soziale, moralische und auch philosophische Fragen der Organverpflanzung aufblitzen lässt. Was überhaupt ist ein Organ? Thomas von Aquin verstand es als Alleinbesitz einer Seele, im Unterschied zu einem für alles tauglichen "Instrument“; für Schelling war ein Organ ein Individuum, abhängig vom Gesamtorganismus. Wenn ein Organ also den Träger wechselt, würde dieser seine Identität verändern. Wer "Transplantationsgeschwister“ hat, lebt in anderen Menschen weiter. Das sind weitreichende Folgerungen, die sich zwangsläufig mit dem medizinischen Fortschritt stellen, der wiederum mit einer neuen bioethischen Situation einhergeht. Jürgen Habermas hat demgemäß vor den "transhumanistischen Zukunftsphantasien“ der Stammzellforscher gewarnt: "Das beunruhigende Phänomen ist das Verschwimmen der Grenze zwischen der Natur, die wir sind, und der organischen Ausstattung, die wir uns geben“.
David Wagners Buch bezieht keine kämpferische Position. Aus leiser innerer Überzeugung erzählt es vom dankbaren Überleben eines Menschen, den wir am Ende, so der medizinische Ausdruck im Epilog, "in einem hervorragenden Allgemeinzustand“ entlassen sehen. Mit einer Leber, die nicht die eigene ist, sondern die eines für ihn anonymen Toten. Insofern erzählt das Buch von mindestens zwei "Leben“. Der Mythos sagt, dass Prometheus die Leber wieder nachwuchs, die ihm ein Adler auf Geheiß beleidigter Götter anfraß. David Wagner lässt die Lebenshoffnung nachwachsen, weit über Krankenhausgeschichten hinaus.
Die Lebensexistenzromane von Kurbjuweit und Wagner rühren an den Kern dessen, was Literatur ist: ein "interaktives Speichermedium von Lebenswissen“ (Ottmar Ette), das authentische Fragen enthält, auf die Geistes- und Lebenswissenschaften noch keine Antwort haben. Wie löst man sich von seiner Angst? Was ist das Ich: ein Produkt des Zusammenwirkens menschlicher Organe oder eine Erzählung? Wie kann man das Andere der Literatur messen? Und kann die lange Leine der Fiktion, an der die Erzähler ihr selbsterlebtes Ich führen, reißen? Was unter der Oberfläche unseres technisch und global beschleunigten Lebens liegt, ist erfahrbar, wenn solche Bücher beim Leser eingeschlagen haben.
* Der Autor ist Leiter des Referates Literatur der Konrad Adenauer Stiftung
Leben
Von David Wagner,
Rowohlt 2013.
288 Seiten, gebunden, e 20,60
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!