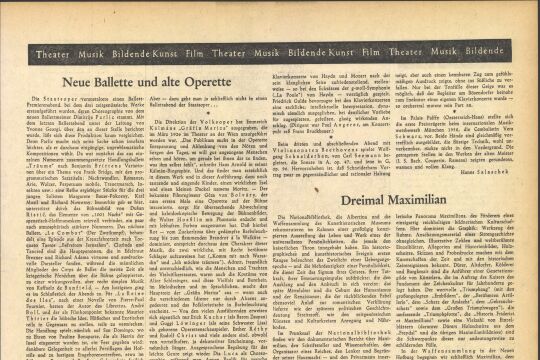Im babylonischen Sprachgewirr der Musik
Das steirische Musikfestival "styriarte" führt heuer vor, dass auch Musik keine Einheitssprache ist, die jeder versteht.
Das steirische Musikfestival "styriarte" führt heuer vor, dass auch Musik keine Einheitssprache ist, die jeder versteht.
Es heißt, Musik sei eine Sprache, die jeder versteht. Das ist ein großer Irrtum. Man frage nur einmal einen Musikvereinsabonennten nach seiner Meinung über Rock'n Roll oder einen Rapper nach seiner Haltung gegenüber Liedern von Schubert...
Dass es in früheren Zeiten nicht anders war, versucht die diesjährige styriarte zu belegen. Unter dem Motto "www.babel.vg" spürt das steirische Musikfestival von 22. Juni bis 30. Juli dem babylonischen Sprachgewirr der klassischen Musik von Claudio Monteverdi bis Kurt Weill nach. Bewundernswert, wie es Intendant Mathis Huber und Spiritus rector Nikolaus Harnoncourt immer wieder gelingt, ein ansprechendes und stringentes Konzept für die styriarte zu erarbeiten.
Schon in früheren Jahrhunderten war die angeblich einheitliche Sprache der Musik von Land zu Land, von Stadt zu Stadt, von Raum zu Raum verschieden. Was in Italien Furore machte, konnte in Paris untergehen, ein Erfolg in Rom garantierte noch lange keinen in Neapel, und für die Kirche musste ganz anders komponiert werden als für das mondäne Musiktheater. Paris war eine besonders harte Nuss: Richard Wagners "Tannhäuser" sorgte dort nur für Heiterkeit, und sogar der große Giuseppe Verdi musste für die Stadt an der Seine so manche Neufassung erstellen.
1778 schrieb Wolfgang Amadeus Mozart für dieses schwierige Publikum seine Pariser Symphonie. "Mozart hat sich mit den örtlichen Gegebenheiten genau befasst", erzählt Nikolaus Harnoncourt: "Er hat sich erkundigt, was den Leuten gefällt, was sie erwarten, und er hat mit dieser Erwartung gespielt, hat sie enttäuscht und den erwarteten Effekt an einer anderen Stelle gemacht."
Bach auf katholisch Mozarts Spiel mit einer ihm fremden musikalischen Sprache - von der gesprochenen meinte er, sie habe "der teufel gemacht" - wird Harnoncourt am 28. und am 29. Juni im Grazer Stephaniensaal dirigieren und zwar zusammen mit Joseph Haydns Ausflug ins englische Fach, der Londoner Symphonie, und Ludwig van Beethovens erstem Versuch im Wiener Idiom, seinem dritten Klavierkonzert (es spielt das Chamber Orchestra of Europe). Auch Johann Sebastian Bach war musikalisch polyglott - nur hatte der Thomaskantor im protestantischen Leipzig nicht die Möglichkeit, zu zeigen, was er draufhatte. Das beweist seine Messe in h-Moll, eine Komposition, mit der er sich um eine Stelle am katholischen Dresdner Hof bewarb. "Wenn ihr katholische Kirchenwerke wollt, bitte: Das kann ich auch!", deutet Harnoncourt die Intention der Komposition, die er am 4. und 5. Juli im Stephaniensaal dem Concentus Musicus anvertrauen wird (und einer erlesenen Schar von Solisten, unter anderen Barbara Bonney und Michael Schade). "Wenn Bach die Stelle in Dresden bekommen hätte, wäre er sicher auch Opernkomponist geworden", ist Harnoncourt überzeugt.
Schon im Barock gab es musikalische Welten, die voneinander so weit entfernt waren, wie heute volkstümliche Musik und zeitgenössische Oper. Die babylonischen Verhältnisse zwischen musikalischem Orient und Okzident fanden einen geradezu grotesken Niederschlag im Werk von Wojciech Bobowsky (1610 bis 1675), den es am 5. Juli im Grazer Minoritensaal, im Rahmen des Abends "Alla Turca", zu entdecken gilt.
Dieser polnische Kirchenmusiker war in osmanische Gefangenschaft geraten und verbrachte den Rest seines Lebens unter dem Namen Ali Ufki als Sklave am Hof in Konstantinopel. Dort entdeckte er die Mikrotöne und Rhythmen der orientalischen Musik und komponierte von nun an im Stil seiner nunmehrigen Herren - aber als Ausgangspunkt seiner islamischen Lieder benutzte er Gesänge der französischen Hugenotten.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!