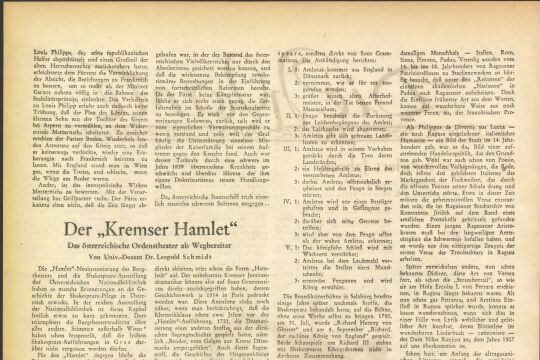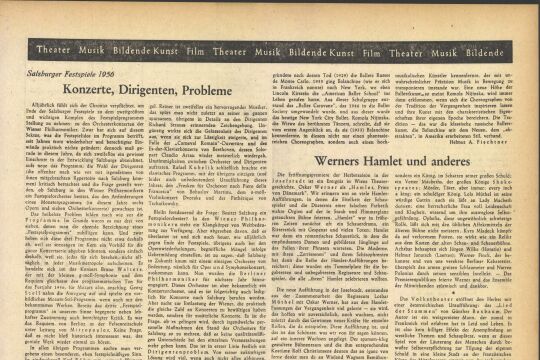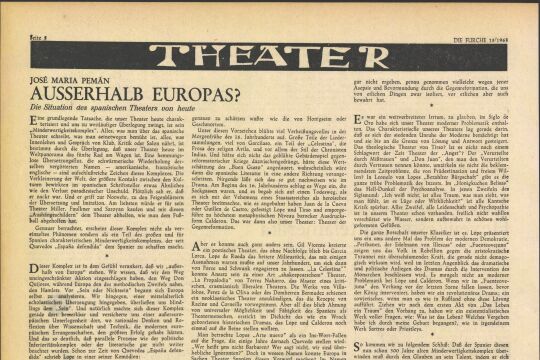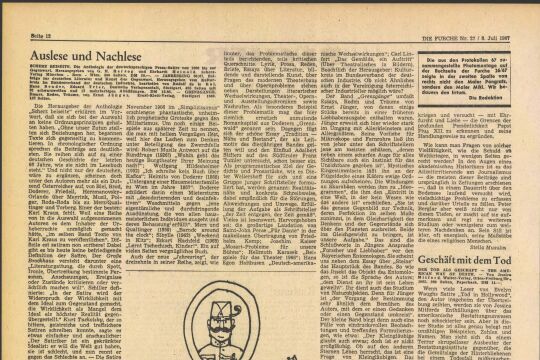Jeden Tag erscheinen weltweit 15 wissenschaftliche Studien und ein Buch - zu einem einzigen Autor, nämlich zu William Shakespeare. Diese unglaublichen Zahlen tut Übersetzer Frank Günther in seinem lesenswerten Buch "Unser Shakespeare“ (dtv 2014) kund und sie motivieren nicht gerade, dem weitere Zeilen hinzuzufügen. Wenn nicht einmal Shakespeare-Experten Überblick über die Fachliteratur haben, dann erst recht nicht Journalisten. Doch Shakespeares Texte gehören zum Interessantesten, was die Weltliteratur zu bieten hat, selbst Jahrhunderte nach ihrer Entstehung. Deshalb gebührt ihnen immer wieder Erinnerung. Und da man nicht alle Gründe für diese Meinung anführen kann, werden hier drei hervorgehoben, nämlich die Sprache, die Entdeckung des Ich und die Widersprüchlichkeit und Perspektivenvielfalt.
Anfang des 21. Jahrhunderts, in einer völlig anderen Zeit als dem elisabethanischen Zeitalter, setzen Shakespeares Dramen immer noch in Erstaunen, auch ohne banale Aktualisierungen. Was sie erzählen, scheint - so es nicht weginszeniert wird - irgendwie bekannt, oder anders und mit Jan Kott gesagt: Shakespeare erscheint als "unser Zeitgenosse“. Warum?
Ein Fest der Sprache
Da ist zunächst die grandiose Sprache, besser: die Sprachvielfalt mit Sprachspielen und Doppeldeutigkeiten, die freilich heute nicht einmal mehr in England verstanden wird, wie Frank Günther feststellt. Es schauen viele auch gar nicht genauer hin: Hans-Dieter Gelfert etwa widmet in seiner Monografie "Shakespeare“ der Sprache gerade einmal ein Kapitelchen von zwei Seiten.
Die Polyphonie der Texte wurde lange überlesen - Christoph Martin Wieland etwa versuchte die Dramen in deutsche Prosa zu übersetzen und übersah, dass Inhalt und Form bei Shakespeare besonders eng zusammengehören, dass es inhaltliche Gründe gibt, wenn jemand in Versen spricht und in welchen. (Und für das Grobe und Derbe der Shakespeare’schen Sprache entschuldigte sich Wieland in Fußnoten.)
Doch die Auseinandersetzung mit der Sprache geht tiefer und wer die jüngste Peter Stein-Inszenierung von "König Lear“ im Wiener Burgtheater gesehen hat, hat das vielleicht instinktiv gespürt. Wer dabei das Gefühl hatte, ein modernes Samuel Beckett-Stück zu sehen, hatte Recht: Da wurde einem nämlich der Boden unter den Füßen weggezogen, und zwar zuallererst der Boden der Sprache.
Denn der Sprache ist nicht zu trauen, wusste Shakespeare, der Sprachskeptiker. Und dieses Misstrauen bezog sich nicht nur auf verlogene politische Rhetorik. Hierzulande wird gerne Hugo von Hofmannsthals 1902 erschienener fiktiver "Brief des Lord Chandos“ an Francis Bacon zitiert, um jene Erfahrung zu beschreiben, dass Worte "im Munde wie modrige Pilze“ zerfallen und die Fähigkeit abhanden gekommen ist, "über irgend etwas zusammenhängend zu denken oder zu sprechen“. Doch dass Sprache und Dinge auseinanderfallen, das hat schon Jahrhunderte zuvor Shakespeare gesehen und auf der Bühne vorgeführt: Er zeigte die Sprache als Grund für Missverständnisse, als ungeeignetes Mittel, um Beziehungen zu klären (wie etwa bei "König Lear“), als Anlass zu Streit und Hass, als bewusst eingesetztes Täuschungsinstrument, etwa bei "Richard III“. "I moralize two meanings in one word“, heißt es da, und Frank Günther nennt diese Aussage des Königs sogar Shakespeares poetisches Sprachgestaltungsprinzip und das "Doppeldeuteln als die sprachliche Ursünde der Welt“ als sein Grundthema: "Ich nehme mir zwei Bedeutungen aus einem Wort“. Ein grandioses Fest der Sprache bereitet Shakespeares Werk und als ein solches muss es übertragen werden, das heißt Übersetzer müssen mit der Mehrdeutigkeit der eigenen Sprache arbeiten. Frank Günther versucht das in jenen Werken, die von ihm übersetzt seit 1995 beim Deutschen Taschenbuch Verlag (und in bibliophilen Ausgaben bei Ars Vivendi) erschienen sind.
Formierung des Selbst
Schülerinnen und Schüler lernen mit Arthur Schnitzlers "Leutnant Gustl“ (1900) den Stream of conciousness kennen, den Bewusstseinsstrom, der in das Innere einer Figur sehen lässt. Auch in dieser Hinsicht war Shakespeare bahnbrechend unterwegs. In den Monologen Hamlets "ereignet sich inneres Geschehen als Drama“. Der Zuschauer kann an diesen Prozessen teilnehmen und in Seelenlandschaften reisen, so beschreibt es Günther. "Man beobachtet die beginnende Formierung eines Selbst. Das war unerhört Neues.“
Im "Hamlet“ passiert der Abschied vom alten Theater. Statt der Maske tritt das Selbst hervor. "Die Figur Hamlet gilt als der erste Mensch der Neuzeit auf einer Bühne.“ Geburtsstunde der Individualität nannte Jacob Burckhardt die Renaissance und im "Hamlet“ kann man sehen, wie das Ich entsteht, das keineswegs stabil ist. Der Schauspieler Shakespeare nützte die Metapher des Theaters, erläutert Günther: Beim Spiel eines Schauspielers sieht Hamlet wie in einem Spiegel seine eigene Situation. So ist er Subjekt und Objekt zugleich, wird sich seiner selbst bewusst - und sich selbst problematisch. Und wir sehen Hamlet zu, wie er sich zusieht: "Theater auf dem Theater auf dem Theater wird gespielt - das Ergebnis ist ein verwirrendes Spiegelkabinett.“
Keine Autorstimme greift dabei ein und erzählt besserwisserisch eine Moral von der Geschicht’. Ganz im Gegenteil werden Zuseher mit den widersprüchlichsten Wahrheiten konfrontiert. Eine Figur spricht, und man kann ihr recht geben, eine andere spricht etwas ganz anderes, auch dem kann man folgen. Wo einer weint, lacht ein anderer. Die Welt, die Shakespeare entwirft, ist keine schwarz-weiße, keine, in der hier die Könige und da die Narren stehen. Einen "dialektischen Ironiker“ nennt Günther den Dramatiker: "Der Kontrapunkt ist Kompositionsprinzip.“ Das gilt selbst für die Charaktere, auch sie sind widersprüchlich. "Sie sind nicht, was sie sind. Sie bleiben nicht, was sie waren. Sie sind in ständiger Wandlung begriffen.“
Shakespeare hätte die Texte gar nicht selbst verfasst: Verschwörungstheorien wie diese feiern fröhliche Urständ. Vielleicht weil Shakespeares Leben so normal anmutet und es kaum Fakten zu berichten gibt, aber die findet man generell nicht üppig zu jener Zeit. Schon Mark Twain konstatierte daher, eine Shakespeare-Biografie zu schreiben, sei wie das Rekonstruieren eines Brontosaurierskeletts "aus 9 Knochen und 600 Fässern Gips“. Und Günther gibt folgende - im Shakespeare-Jubiläumsjahr besonders nützliche - Faustregel für eine neue Biografie: "Je dicker sie ist, desto freier ist sie erfunden.“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!