Graham Vicks Inszenierung von Verdis „Aida“ bei den Bregenzer Festspielen als – die Musik dominierendes – effektvolles Bühnen-Spektakel. Dazu überzeugende Sängerinnen, jedoch ein blasser Dirigent.
Der zum Tode verurteilte ägyptische Feldherr Radames und die von ihm geliebte äthiopische Sklavin Aida – sie hauchen ihr Leben dieses Mal nicht, wie eigentlich vorgesehen, eingemauert in einem Verlies aus, sondern entschweben auf einer Barke in den Nachthimmel. Dies das sehr poetische Schlussbild der Neuproduktion von Giuseppe Verdis Oper „Aida“ bei den Bregenzer Festspielen, aber auch eine Szene, die symptomatisch für diese Produktion ist: Die stimmungsvolle Bildwirkung zur leise verklingenden Musik Verdis wird empfindlich gestört durch die Laufwerke der Baukräne, die das Bühnenbild flankieren und eben die Todesbarke ins Jenseits befördern – ein Problem der ganzen Aufführung, denn immer wieder sind es nicht unerhebliche Geräusche, die die Entfaltung der Musik hemmen und stören, seien es die Baukräne, Motoren diverser Boote, ablaufendes Wasser von aus dem See gehobenen Kulissenteilen oder wie bei der Premiere am 22. Juli zumindest zeitweise von einer Konkurrenzveranstaltung herüberdringender Disco-Sound.
Dass man bei den Bregenzer Festspielen bei der ersten Auseinandersetzung mit Verdis großer Oper auf der riesigen Seebühne die abseits des allbekannten „Triumphmarschs“ aus vielen intimen Szenen bestehende „Aida“ nicht im traditionellen Ambiente realisieren würde, war absehbar – und doch wird es vielleicht manch einen Bregenz-Besucher verwundern, quasi eine Art Baustelle vorzufinden.
Trümmerlandschaft
Die Bühne (entworfen von Paul Brown) stellt eine Trümmerlandschaft dar. Von einer riesigen Statue sind nur mehr die monumentalen Füße existent, andere Teile – wie eine Hand mit Fackel oder der geborstene Kopf des Standbilds – werden später aus dem See gehievt und von den Kränen (ein Kompliment an deren Führer für ihre Präzision) wieder in schwindelnden Höhen zusammengesetzt; und spätestens dann sieht es jeder: Das geborstene Standbild stellt die New Yorker Freiheitsstatue dar – für manche das Symbol der Freiheit, für andere Sinnbild für Unterdrückung. Genau dieser Gegensatz wird in Graham Vicks Inszenierung auf vielfältige Weise mit aktuellen optischen Zitaten in allererster Linie zum Ausdruck gebracht, etwa wenn Prinzessin Amneris ihre Sklaven mit Säcken über den Köpfen an der Hundeleine führt oder die gefangenen Äthiopier an die Gefangenen amerikanischer Gefängnisse erinnern. Ob freilich Regisseur und Bühnenbildner mit solchen auf die USA konzentrierten Bildwirkungen die Assoziationen der Zuschauer nicht vielmehr einengen statt, wie eigentlich beabsichtigt, einen breiten Interpretationsraum zum Thema Freiheit und Unterdrückung zu schaffen, bleibt fraglich. Immerhin entstehen aber immer wieder opulente und imposante, freilich nicht durchgehend für die Handlung sinnbringende Bilder, auch dank einer acht mal vierundzwanzig Meter großen Spielfläche zwischen Bühne und Auditorium im Wasser, die höhenverstellbar bespielt werden und Ballett und Protagonisten mal höher, mal tiefer, ins Wasser befördern kann.
Der Regie ist dank enormen technischen Aufwands und eines Großaufgebots an Statisten und Stuntmen ein großes optisches Spektakel gelungen – ein Spektakel freilich, das die Musik zuweilen in den Hintergrund drängt, mag das Bregenzer Soundsystem mit seinem präzisen Richtungshören auch noch so vorzüglich sein. Carlo Rizzi am Pult der konzentriert und klangschön musizierenden Wiener Symphoniker marschierte recht hemdsärmelig im Eiltempo durch die zum Teil recht krude, auf pausenlose zweieinviertel Stunden Dauer gekürzte Partitur; er lieferte eine im Allgemeinen verbleibende, wenig sensible musikalische Umsetzung.
Weiblicher Gestaltungswille
Sehr viel mehr Wille zur Gestaltung verspürte man dagegen bei den Solisten, insbesondere den stimmlich mit Leidenschaftlichkeit und viel Nuancierungsvermögen agierenden Damen Tatiana Serjan (eine Aida im Putzfrauengewand) und Iano Tamar (Amneris). Beide wurden den lyrischen und dramatischen Seiten ihrer Rollen bestens gerecht. Iain Paterson war ein nachdrücklicher Amonasro von beachtlicher Stimmpotenz, Rubens Pelizzari dagegen ein Radames, dem zwar immer wieder beachtliche Forte-Höhen gelangen, dem dazwischen aber auch die Stimme brüchig wurde und einmal nahezu komplett zu versagen schien. Ohne Fehl agierten Kevin Short als König und Tigran Martirossian als Ramphis sowie das Chorkollektiv aus Katowice, Krakau und Bregenz – aber: Die großen Chorszenen sind in der Bregenzer „Aida“ häufig zur bloßen Begleitmusik für imposante Bühneneffekte degradiert.



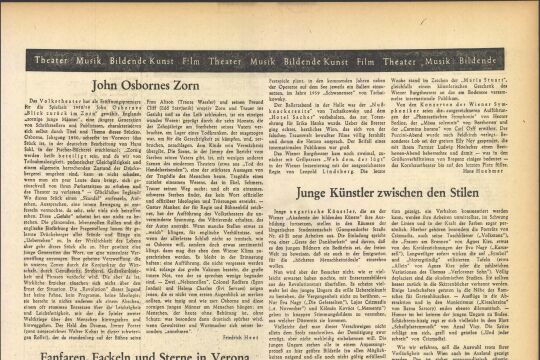




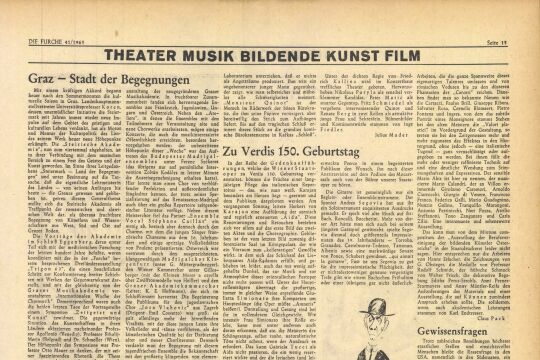






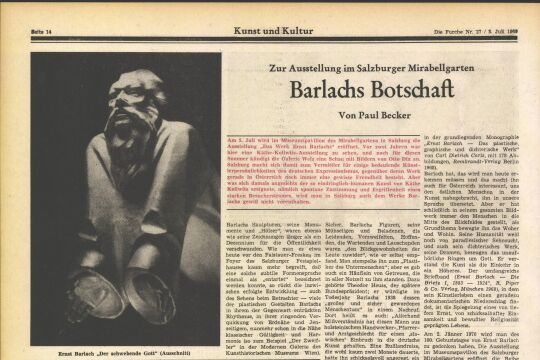

























%20OFS_Monika%20Rittershaus%20(16).jpg)





