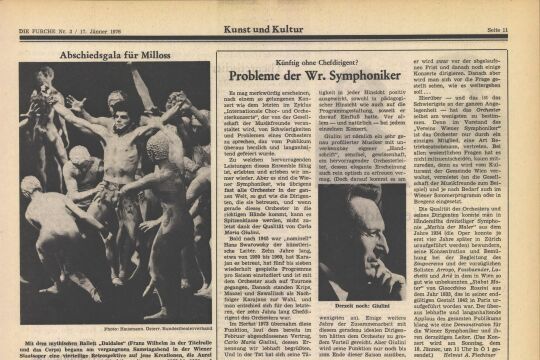"Barockoper ist heute überall üblich, die Geschichte der Oper hat ja nicht erst 1780 begonnen": Der designierte Staatsoperndirektor Dominique Meyer über sein grundsätzliches Rollenverständnis, Wiener Opernthemen, Besetzungsfragen und die Notwendigkeit internationaler Zusammenarbeit.
Die Furche: Herr Generaldirektor, wie konkret sind Ihre Planungen gediehen? Ihr Musikdirektor Franz Welser-Möst hat jüngst in einem Interview über eine Einem-Renaissance (s. S. 14) an der Staatsoper nachgedacht - hat er damit schon Konkretes verraten?
Dominique Meyer: Wir hatten Gespräche über die Vorhaben für die erste, zweite und auch schon die dritte Saison, aber es ist noch zu früh, um Titel zu nennen, das werden wir bei unserer Programmkonferenz im Frühjahr 2010 machen. Jedenfalls ist es bemerkenswert, wie Franz sich programmatisch einbringt.
Die Furche: Warum haben Sie sich für Wien beworben? Hatten Sie vom Stagione-System genug, wollten Sie die Herausforderung des größten Repertoiretheaterbetriebs?
Meyer: Es ist sicher interessant, die gleiche Symphonie oder das gleiche Klavierkonzert mit verschiedenen großen Künstlern zu hören. Aber ein Orchesterkonzert ist ganz schnell vorbereitet. Man macht drei, vier Jahre vorher den Termin fest, manchmal noch knapper, verkauft die Karten. Um sechs Uhr kommen die Künstler, um sieben Uhr machen sie eine kurze Anspielprobe, um acht beginnen sie das Konzert, um halb elf ist es zu Ende. Am nächsten Tag ist etwas anderes. Die Vorbereitung von einem Opernspielplan, allein von einer Produktion, dauert vier Jahre und ist immer wieder spannend. Nach dreizehn Jahren in einem Mehrspartenhaus wollte ich in die Oper zurück. Ich wollte ein großes Haus, wo ich die Künstler, die ich kenne, einladen kann. Wenn ich kein wichtiges Opernhaus gefunden hätte, wäre ich in meinem Theater in Paris geblieben. Wien ist etwas Besonderes, vor allem wegen des Orchesters, der Philharmoniker.
Die Furche: Die unterschiedlichen Besetzungen des Orchesters bei den einzelnen Vorstellungen sorgen gerade für Diskussionsstoff. Wird es auch gelingen, eine Lösung für die finanziellen Fragen zu finden?
Meyer: Ich habe mich in dieses Thema gut eingelesen, über eine Lösung können wir erst sprechen, wenn wir etwas weiter sind. Man muss die Doppelnatur des Orchesters berücksichtigen: In der Staatsoper tritt das Orchester als Staatsopernorchester auf, im Konzert als Wiener Philharmoniker. Ich habe die Philharmoniker oft nach Paris eingeladen und werde als künftiger Direktor der Wiener Staatsoper meine Wertschätzung nicht ändern. Darüber hinaus steht eine Geldfrage zur Debatte, die man jahrelang nicht gesehen hat, weil das durch die Einkünfte der Musiker aus dem Plattenmarkt überdeckt wurde. Auch hier wird man nach neuen Wegen suchen müssen.
Die Furche: Ihre Ankündigung, auch Barockoper zu machen, hat verschiedenste Reaktionen hervorgerufen. Der Intendant des Theaters an der Wien hat sich skeptisch dazu geäußert.
Meyer: Ich spreche nicht vom Theater an der Wien, das ist die Sache von Roland Geyer, ich rede über mein Haus. Ich habe der Frau Minister gesagt: Wenn Sie mich einladen, muss ich volle Verfügungsgewalt haben. Barockoper ist heute überall üblich, die Geschichte der Oper hat ja nicht erst 1780 begonnen. Die Staatsoper ist keinesfalls zu groß, das Palais Garnier in Paris ist größer, seine Bühne ist 16 Meter breit, die der Staatsoper 13 Meter. Es gibt auch keine akustischen Probleme.
Die Furche: Wann wollen Sie diese Barockopern spielen, während Tourneen der Philharmoniker?
Meyer: Manchmal ist es eine Hilfe für die Planung. Ich habe nichts dagegen, wenn sich wie in Zürich einige Musiker aus dem Orchester für dieses Repertoire finden. Wenn nicht, finden wir eine andere Lösung, wie etwa in Berlin. Barenboim war überhaupt der Erste, der ein Repertoirehaus, die "Lindenoper", für Barock geöffnet und dafür Ensembles, die sich auf Barockmusik spezialisiert haben, eingeladen hat. Das bedeutet aber nicht, dass wir ständig Barockmusik spielen, aber jedenfalls einmal in der Saison.
Die Furche: Stimmt es, dass sich aus den Ensembles immer weniger erste Besetzungen finden lassen?
Meyer: Spielt man "Walküre", kann sicher nicht jedes Haus behaupten, dass es einen ausgezeichneten Wotan in seinen Reihen hat. Aber es ist nicht so einfach, man kann nicht sagen, ich will das oder jenes mit dem Ensemble besetzen, man muss auch die Sänger dafür haben. Dazu haben sich die Zeiten geändert. Vor zehn, zwölf Jahren war es kaum möglich, eine Rossini- Oper gut zu besetzen, heute ist es fast einfach. Vor zwanzig Jahren war es ziemlich schwierig, eine gute Wagner-Besetzung zusammenzubringen, heute kann man gleichzeitig eine neue "Walküre" in Wien, einen neuen "Tristan" an der Scala und einen neuen "Tannhäuser" in Paris herausbringen. Komplizierter geworden ist die Besetzung für Verdi.
Die Furche: Wie sieht es mit dem Repertoire aus, wird man es aus Ihrer Sicht im bestehenden Ausmaß halten können?
Meyer: Ich werde es versuchen, jedenfalls, so lange man es auf hohem Niveau halten kann.
Die Furche: Soll man als Direktor der Wiener Staatsoper eine bestimmte Handschrift haben?
Meyer: Dieses Thema interessiert mich nicht, ich setze einen Schritt nach dem anderen. Wahrscheinlich werden wir einige Reihen machen, wir werden auch mit anderen Häusern kooperieren, es ist nicht mehr die Zeit, um alles alleine zu produzieren. Hätte ich in Paris nicht kooperiert, wäre pro Spielzeit nicht einmal eine Oper möglich gewesen. Wir haben beispielsweise Monteverdis "Poppea" in Paris gemacht, die Produktion ging weiter an die Staatsoper nach Berlin, dann nach Brüssel, jetzt nach Kopenhagen. In Paris war sie kein hundertprozentiger Erfolg, dafür ein großer in Berlin; so kann man auch sehen, wie verschieden eine Produktion aufgenommen wird. Alleine die Kosten, die man bei solchen Kooperationen in der Ausstattung spart, ermöglichen weitere Produktionen. Ich will das Haus pflegen wie ein Gärtner, mit einigen Modifikationen, aber nicht mit brutalen Änderungen.
Die Furche: Gibt es bereits Absprachen mit den anderen Wiener Opernhäusern wie Volksoper oder Theater an der Wien?
Meyer: Nein, aber ich kenne ein paar Projekte und wir werden uns natürlich regelmäßig treffen. Ich fühle mich in der Staatsoper schon wie zu Hause, wie wenn ich Jahre hier verbracht hätte, es ist sehr angenehm und ruhig. Vor allem habe ich sehr gute Mitarbeiter, sie sind sehr fleißig, arbeiten gut, sind freundlich - und das gefällt mir.
Das Gespräch führte Walter Dobner.
Von den Champs-Élysées an die Ringstraße
Es war die überraschendste kulturpolitische Personalentscheidung des vergangenen Jahres. Nicht, wie eilfertige Kommentatoren meinten und es voreilig auch publizierten, Neil Shicoff, der Kandidat von Bundeskanzler Gusenbauer, machte das Rennen um den künftigen Staatsopernchef, sondern Ministerin Claudia Schmied setzte ihre Wahl durch. Und die fiel auf einen der international profiliertesten Musikmanager: Dominique Meyer, Generaldirektor des Théâtre des Champs-Élysées. Denn gesucht wurde jemand, der gleichermaßen internationale Erfahrungen und Kontakte wie ökonomisches Verständnis besitzt. Wozu sich bei dem aus dem Elsass gebürtigen Diplomatensohn noch eine "polyglotte" Berufserfahrung hinzugesellt. Denn ehe er seine Pariser Aufgabe übernahm, wirkte er als Berater des französischen Kulturministers Jack Lang, war maßgeblich an der Einführung des Fernsehsenders "arte" beteiligt, arbeitete im Vorbereitungsteam für die Pariser Fußballweltmeisterschaft und leitete von 1994 bis 1999 das Opernhaus von Lausanne. Seit seiner Designierung als Staatsopernchef pendelt er zwischen Paris und Wien und steckt längst inmitten der Vorbereitungen für seine ersten Saisonen. Auch wenn er Details noch nicht nennen mag - dass auf seinem Arbeitstisch unter anderem Partituren von Opern von Hindemith und Schostakowitsch liegen, wird wohl kein Zufall sein … dob
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!