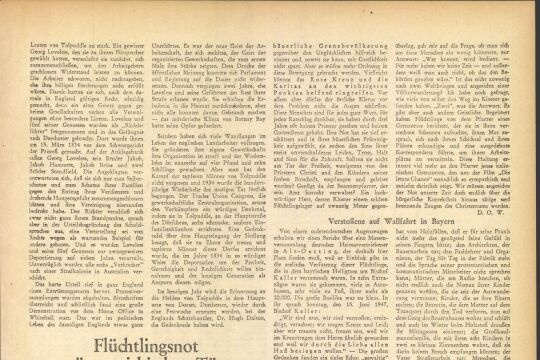Ob zu Fuß von Frankreich aus durch den Eurotunnel, per Schiff als blinde Passagiere oder mit Hilfe von Schlepperbanden - immer mehr Afghanen riskieren alles, um in Großbritannien ein neues Leben ohne Gewalt und Tod zu beginnen. Viele bleiben aber im französischen Flüchtlingslager Sangatte bei Calais hängen.
Zahir Shah? Der wurde gestürzt, noch bevor ich auf die Welt kam", erklärt Ahmed. 25 Jahre ist der Afghane alt, die 40-jährige Herrschaft des Monarchen und seine Absetzung 1973 gehören für ihn einer Vergangenheit an, die, obwohl rezent, doch unendlich ferne erscheint. "Ein geeintes, relativ friedliches und stabiles Afghanistan, eines, wo keine Fanatiker das Sagen haben, für mich ist das gar nicht vorstellbar", meint Ahmed. Natürlich, er würde den Sturz der Taliban nur begrüßen, aber was dann? "Vielleicht gelingt es ja, eine große Koalition unter Zahir Shah zu bilden, vielleicht schafft es der Ex- König, das Land wieder zu einen. Aber wenn nicht?"
Stundenlang debattieren Ahmed und andere Afghanen derzeit Tag für Tag über die Zukunft ihrer Heimat. Doch diese Heimat ist weit weg, und die allerdringendsten Frage für Ahmed lautet im Moment: "Wie geht es mit mir selbst weiter? Wo kann ich denn hin? Wie lange soll ich denn noch hier bleiben?", fragt er resigniert und deutet auf das große graue Gebäude im Hintergund - eine ehemalige Lagerhalle in Sangatte bei Calais, in der das Rote Kreuz im Herbst 1999 jenes Flüchtlingslager einrichtete, in dem Ahmed vor wenigen Wochen Aufnahme gefunden hat.
"Das ist kein Leben"
Während er sich eine weitere Zigarette anzündet, beginnt er zu erzählen, wie er eines Tages beschloss, sein weniges Hab und Gut zu verkaufen, um sich mit dem Geld auf den Weg Richtung Westen zu machen. "Als gebildeter Mensch und Lehrer hast du unter den Taliban keine Existenzberechtigung. Eine Weile, nachdem sie die Macht übernahmen, bin ich noch geblieben, aber das ist kein Leben", meint er. Mit einer neuen Zigarette in der Hand gibt er dann langsam seinen tiefen Groll zu erkennen. "Was haben denn die Sowjets und dann die USA und die von ihnen geförderten Taliban mit meinem Land gemacht? Ruiniert haben sie es, den Menschen die Lebensgrundlagen genommen. Und was tun sie für die, die keinen anderen Ausweg mehr sehen als zu flüchten?"
Über den Iran, die Türkei und Osteuropa ist er nach Deutschland gelangt, "aber da wurde ich abgewiesen", dann hat er es in den Niederlanden versucht, "keine Chance", nun ist er in Frankreich, "aber hier wird man frühestens nach sechs Monaten überhaupt registriert, bis dahin bist du eine Nicht-Person". Er würde ja gerne auch in die USA oder nach Kanada, rechnet sich aber wenig Chancen aus. So ist Großbritannien nun sein Ziel, denn "da soll es noch immer am besten sein. Irgendwie muss es mir gelingen, da hin zu kommen. Durch den Tunnel, mit einem Schlepper, als blinder Passagier auf der Fähre nach Dover. Irgendwie. Sonst kann ich mir nur mehr die Kugel geben."
Die Chancen stehen schlecht, das ist Ahmed bewusst. Täglich muss er mitverfolgen, wie andere Flüchtlinge - Afghanen, Kurden aus dem Irak oder Iran -, deren Versuch, nach England zu gelangen, scheiterte, von der Polizei ins Lager zurückgebracht werden. Einige wurden auch schon zu einer kurzen Haftstrafe verurteilt, weil sie illegal in den nur wenige Kilometer von Sangatte entfernten Eurotunnel eingedrungen waren. Wieder andere verloren ihr letztes Geld an Schlepper, die einkassierten und dann verschwanden. Aber Ahmed bleibt dabei: Er muss nach England, auch wenn er gehört hat, dass dort ein junger Afghane nach einem Überfall querschnittgelähmt ist. Es war offenkundig ein Racheakt an einem Muslim nach den Terrorangriffen in den USA vom 11. September. "Die Lage für die Muslime ist jetzt nirgends im Westen gut, aber ich muss nach England. Irgendwie. Andere habe es ja auch geschafft."
Tatsächlich leben bereits rund 40.000 Personen afghanischer Herkunft in Großbritannien, die meisten von ihnen in London, einige in Birmingham, Leeds und Glasgow, wohin sie im Zuge des äußerst umstrittenen sogenannten "Streuungsprogramms" der Regierung umgesiedelt wurden. Dieses Programm sowie das Coupon-System sind Teil einer Immigrationspolitik, deren Revision schon vor dem 11. September zur Debatte stand, nun aber noch zügiger vorangetrieben werden soll.
In der aktuellen Debatte stehen einander im wesentlichen zwei große Lager gegenüber: Die eine Seite stützt Innenminister David Blunkett, der im Zuge des Kampfes gegen des Terrorismus ein ganzes Paket neuer Maßnahmen einführen und notfalls das Menschenrechtsgesetz abändern will, sollte dieses rigorosen Schritten entgegenstehen. Die andere Seite, zu der neben diversen liberalen Gruppen und Menschenrechtsaktivisten auch Gewerkschafter und Kritiker aus den Reihen von New Labour gehören, warnen vor einer Beschneidung der Grundrechte und -freiheiten sowie vor einer menschenunwürdigen Immigrationspolitik.
Schon jetzt bezeichnet Gewerkschaftsboss Bill Morris das vor wenigen Jahren eingeführte Couponsystem, demzufolge neue Immigranten Zuwendungen kaum mehr in Bargeld, sondern vorwiegend in Form von Einkaufsgutscheinen für bestimmte Geschäfte erhalten, schlicht als Apartheid. Wer mit diesen Coupons bezahle, sei unweigerlich stigmatisiert und werde nicht selten belästigt. Der britische Ärzteverband verurteilte in einer kürzlich veröffentlichten Studie das Coupon- und Streuungsprogramm nicht nur als entwürdigend, derartige Regelungen "verursachen bei den Betroffenen schwerwiegende Gesundheitsprobleme", warnte der Verband.
Weg mit den Coupons, aus mit der Streuung lauten lediglich zwei der Forderungen von New Labour-Kritikern und Gewerkschaftern. Sie verlangen des weiteren, dass keine Immigranten mehr in der Zeit, in der ihre Asylansuchen geprüft werden, in Gefängnissen oder gefängnisähnlichen sogenannten "Empfangszentren" untergebracht werden. Mehrere Hundert Asylwerber sollen jeweils in sieben verschiedenen Haftanstalten einquartiert sein. Die "Empfangszentren" wurden mit der Begründung geschaffen, dass man durch die dadurch erreichte ständige Anwesenheit der Immigranten das Asylverfahren wesentlich rascher durchziehen könne. Für Aufregung sorgte jedoch kürzlich ein Gericht, als es der Klage von vier Immigranten stattgab, wonach diese Zentren illegal sind.
Härtere Asylpolitik
Innenminister Blunkett erregte sich erst kürzlich beim New Labour-Parteitag über Gerichte und Anwälte, die "den Rechten von Minderheiten zu viel Aufmerksamkeit schenkten". Zugleich kündigt er eine verschärfte Ausweisungs- und Abschiebepolitik für jene Personen an, die im Verdacht stehen, einer terroristischen Organisation anzugehören oder aus religiösen Motiven zum Hass aufrufen. Gewerkschafter Morris erinnert freilich daran, dass zumal Asylwerber, gegen die keinerlei Verdacht bestehe, "solange sie hier sind, würdig und menschlich behandelt werden müssen." Zahlreiche Analysten warnen vor überstürzten Maßnahmen, die lediglich in die Menschenrechte eingreifen, aber keinen nachweisbaren Nutzen im Kampf gegen den Terrorismus haben.
Knapp 80.000 Personen suchten im Vorjahr um Asyl in Großbritannien an. Es ist zu erwarten, dass auch von diesen die große Mehrheit abgewiesen wird. Nur selten ist es allerdings bisher zu größeren Ausweisungen gekommen. Es wird vermutet, dass die meisten, die nicht als Asylanten anerkannt werden, einfach untertauchen. Wie viele es sind, weiß keiner. Innenminister Blunkett sprach jüngst von mehreren Hunderttausend, eine Zahl, die von seinen Kritikern freilich in Zweifel gezogen wird.
Unerreichbar fern
Details der künftigen Immigrations- und Asylpolitik sollen erst in einigen Wochen bekannt gegeben werden. Angekündigt hat das Innenministerium aber bereits die Einführung einer neuen Green Card mit vier Gruppen von Berechtigten: "Hochqualifizierte", also etwa Ärzte oder Finanzexperten; ausländische Studenten, die sich bereits im Land befinden; Fremdarbeiter, die sich um Stellen in jenen Sektoren bewerben können, in denen ein Personalmangel besteht; unqualifizierte Saisonarbeiter für Farmen oder den Tourismus, denen aber nur eine zeitweilige Arbeitsbewilligung ausgestellt werden soll.
Die Neuregelung wird nur mehr für einen Teil der bereits in Großbritannien befindlichen Afghanen von Interesse sein. Viele sind schon seit Jahren hier, haben sich eine neue Existenz aufgebaut oder sind dabei, es zu tun. Die ersten kamen in den 80er Jahren nach der kommunistischen Machtübernahme in Kabul, eine weitere Gruppe in den neunziger Jahren, als diverse Mudschaheddingruppen einander bekämpften, die letzten seit 1996, als die Taliban die Kontrolle über den Großteil von Afghanistan erlangten. "Die meisten von uns haben einfach genug von Krieg und Gewalt und Tod. Was wir hier suchen, ist einfach ein ruhiges Leben," sagt Abdul, der seit fünf Jahren in London lebt. Ruhe, Sicherheit und eine menschenwürdige Existenz ist auch das, was Ahmed sucht. Wenn er vom Lager in Sangatte auf den Ärmelkanal hinaus blickt, dann verhärtet sich sein Blick: So nah ist England. Und doch vielleicht unerreichbar.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!