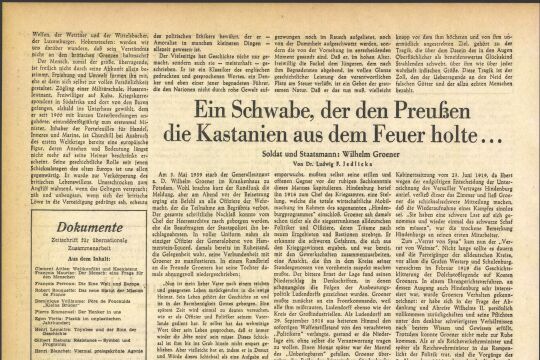Die USA nach 9/11: Jetzt ist die Zeit für harte Fragen
Die Welt erwartet von den USA jetzt nicht, dass sie sich in den Schmollwinkel zurückziehen, sondern dass sie ihre globale Verantwortung wahrnehmen.
Die Welt erwartet von den USA jetzt nicht, dass sie sich in den Schmollwinkel zurückziehen, sondern dass sie ihre globale Verantwortung wahrnehmen.
Es gibt keinen Zweifel. Der beispiellose Terroranschlag auf die beiden Türme des World Trade Centers in New York und das Pentagon in Washington hat das öffentliche Bewusstsein in den Vereinigten Staaten schlagartig und aller Wahrscheinlichkeit nach nachhaltig verändert. Dahin ist jene Lässigkeit und Leichtigkeit des Seins, die gerade in New York während der vergangenen Jahre von den zahlreichen Gewinnern des Aktienbooms - und nicht nur von ihnen - genüsslich zur Schau getragen wurden. An ihre Stelle sind Entsetzen, Schock und ein tiefsitzendes Gefühl der Unsicherheit gewichen. Zwar war man sich spätestens nach dem Anschlag auf das Bundesgebäude in Oklahoma City auch in den Vereinigten Staaten bewusst, dass das Land nicht unverwundbar war; und doch tat man so, als sei man unverletzlich. Gerade die beiden Türme des World Trade Centers reflektierten in den neunziger Jahren sowohl das wiedergewonnene Selbstvertrauen der Vereinigten Staaten und ihre scheinbar grenzenlose Selbstsicherheit als auch ihren erneuten globalen Machtanspruch. Zugleich ragten sie in ihrer Eleganz wie eine trotzige Herausforderung in den Himmel über Manhattan, symbolisierten wie kein anderes Gebäude den Anspruch New Yorks, die großartigste Stadt der Welt zu sein.
Unter den Trümmern des World Trade Centers ist nicht nur die Illusion gestorben, terroristische Gewalt gehe nur die anderen an, könne hier nicht geschehen, wie es die New Yorker Autorin Jane Kramer in der deutschen Wochenzeitung "Die Zeit" ausgedrückt hat. Am Höhepunkt seiner Macht wurde dem Land auf drastischste und grausamste Weise seine eigene Verwundbarkeit und Ohnmacht vor Augen geführt. Einer winzigen Gruppe von Terroristen gelang es, innerhalb weniger Minuten das gesamte politische, wirtschaftliche und finanzielle Nervensystem der amerikanischen Supermacht lahmzulegen und zu paralysieren.
Es ist eine Ironie des Schicksals, dass dies gerade unter der Regierung jenes Präsidenten geschehen musste, der wie kaum ein anderer seiner Vorgänger die dezidierte Verfolgung der eigenen Interessen zum alleinigen Maßstab der amerikanischen Außenpolitik erhoben hat. Und es ist eine weitere Ironie, dass sich gerade dieser Präsident jetzt um das Zusammenbringen einen weltweiten Allianz gegen den internationalen Terrorismus bemüht. Es ist zu hoffen, dass dies Zeichen einer Wende und eines Umdenkens ist, und nicht bloß temporäre Anpassung an das Unvermeidbare.
Welche langfristigen Auswirkungen der 11. September auf die amerikanische Politik haben wird, darüber kann man heute nur spekulieren. Eines ist sicher: Der Anschlag und seine unmittelbaren Auswirkungen haben die wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Landes deutlich verschärft. Unter diesen Umständen dürfte es die Bush Administration schwer haben, an ihren wirtschaftspolitischen Vorstellungen festzuhalten. Bereits vor dem Anschlag hatte sich ihr Herzstück, die Steuersenkung, als ein gravierender Fehler entpuppt. Die neuen, unvorhergesehenen finanziellen Belastungen des Staatshaushalts dürften die bereits existierende Probleme nur noch verschärfen. Bush läuft Gefahr, in einigen Monaten vor einem finanzpolitischen Trümmerhaufen zu stehen, der zum größten Teil durch seine eigene Politik verursacht wurde.
Außenpolitisch steht die Administration vor noch größeren Herausforderungen. Seit dem Ende des Kalten Krieges hat sich vor allem in Europa der Eindruck verstärkt, dass der Atlantik während der letzten Jahre breiter geworden ist. Ob Kioto oder Durban, ob in der Frage der Todesstrafe oder der des Kampfes gegen die Verbreitung diverser Waffen - das Trennende bestimmt immer mehr das Bewusstsein, das Bewusstsein des Verbindenden nimmt immer mehr ab. Dies ist eine gefährliche und besorgniserregende Entwicklung, der es entgegenzusteuern gilt, auf beiden Seiten des Atlantik. Ansonsten bleibt von der immer wieder feierlich beschworenen transatlantischen westlichen Wertegemeinschaft bald nicht viel mehr als leere Worthülse.
Wenn sich die Emotionen geglättet haben, wird man auch in den Vereinigten Staaten nicht umhin können, sich harte Fragen zu stellen. Vor allem danach, warum es so viele Menschen gibt, die anscheinend die Vereinigten Staaten so abgrundtief hassen. Wem dann nicht mehr einfällt als Freiheit, Demokratie und "our way of life", der macht es sich zu einfach. Terrorismus ist die Waffe der Schwachen gegen den überwältigend Starken, und damit immer ein Zeichen von Ohnmacht und Ausdruck ohnmächtiger Ressentiments. Diese Ressentiments bilden sich über Monate und Jahre, bis sie sich eines Tages entladen. In den Vereinigten Staaten wird man sich fragen müssen, wie es soweit kommen konnte, und was das Land dazu beitragen kann, dieser Entwicklung entgegenzusteuern. Das ist eine schwierige Aufgabe, denn sie bedeutet, dass die USA ihre Außenpolitik radikal überdenken und vollkommen neu ausstecken, nicht nur im Nahen Osten, sondern vor allem gegenüber dem Süden. Die Welt erwartet von den Vereinigten Staaten nicht, dass sie sich auf ihrer Insel in den Schmollwinkel zurückziehen. Sie erwartet, dass die Vereinigten Staaten ihre globale Verantwortung wahrnehmen und sich international engagieren, und das gerade im Namen jener Werte, die von ihren Politikern so gerne in den Mund genommen werden: "everything that is good and just." Es ist zu hoffen, dass sich diese Erkenntnis in den nächsten Wochen und Monaten in Washington durchsetzen wird.
Der Autor lehrt Politikwissenschaften an der York University in Toronto. Er lebte bis vor kurzem in Manhattan.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!