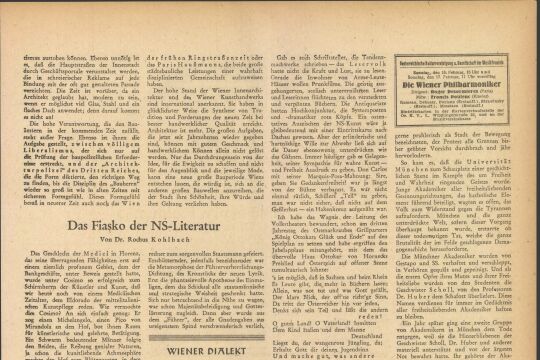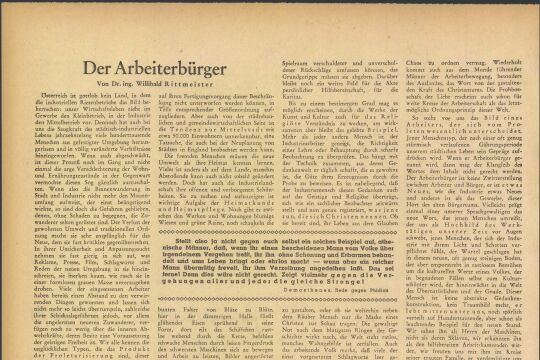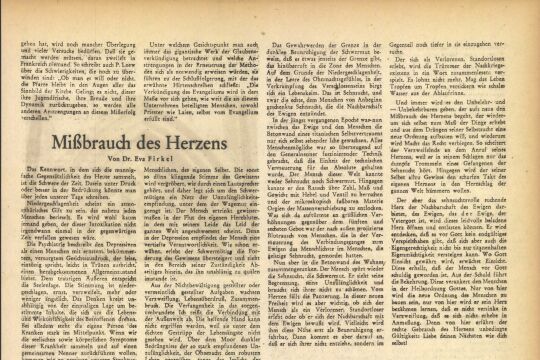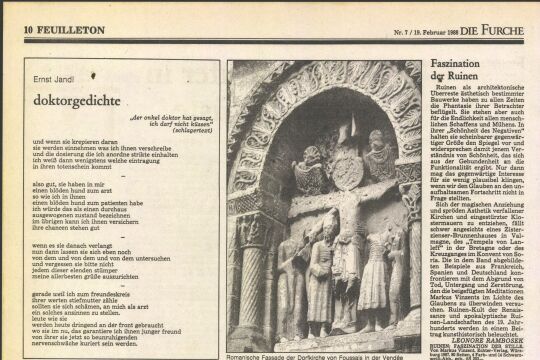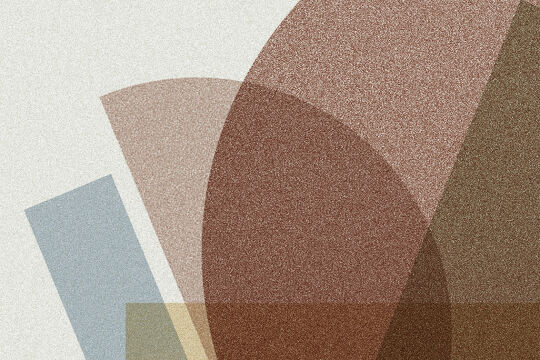Kein Kinderdorf-Idyll
Rudolf Habringer registriert die Verwundungen einer nur scheinbar behüteten Kindheit
Rudolf Habringer registriert die Verwundungen einer nur scheinbar behüteten Kindheit
Ein österreichisches Kinderdorfhaus am Waldrand, gesteckt in das zeitliche Szenario der 60er Jahre - vor diesen Kulissen entfaltet Rudolf Habringer ein bitteres Kindheitsmelodram. "Frei nach einem authentischen Bericht", heißt es zu Beginn seines Romans "LiebesKind", in dem eine wahre Geschichte in der Verfremdung zur eigenen wird, ja schließlich zur Erfindung mutiert, wie der Untertitel glauben läßt. Dazwischen leuchtet realistische Verankerung aus den Zeilen. Quer zu einer glücklichen Kinderdorfwelt erzählt Habringer, ein ambitionierter oberösterreichischer Autor, auf einfühlsame Weise das Aufwachsen eines Knaben bei Zieheltern und stülpt im Hervorziehen von Beschädigungen böse schillernde Facetten eines Jugendschicksals hervor.
Fritz, der Hauptakteur, ist durch ein nüchternes Leben unterwegs. Sieben Geschwister, Mutti, Vati. Nach außen klebt an vielem der trügerische Touch einer echten Familie. Aber Mutti schwingt ein totalitäres Zepter, und Vati vegetiert als armer Alkoholiker dahin. Der rauhe Ton frißt sich in die Gemüter der Kinder. Wirkliche Liebe, Verständnis oder Einfühlungsvermögen gibt es nicht. Wer nicht funktioniert, wird bestraft, hart und erbarmungslos - da versiegt der Widerspruch. Mit Gewalt wird geformt und geknetet. Man funktioniert, "wie eine Maschine, die auf Knopfdruck anspringt", das Damoklesschwert Erziehungsheim im Nacken. Die Wurzeln im geschädigten Herkunftsmilieu fein säuberlich abgehackt. Sehnsucht nach wirklicher Beheimatung nagt da ganz schön am Herzen.
Habringer verschweigt nichts, vor den Augen des Lesers entblättert sich eine Kindheitstristesse: leidvoll, beklemmend. Sukzessive entblößt der Autor das Netz der Unterdrückungsmechanismen und seziert geradezu das unmenschliche Erziehungsritual. Zwischen Gewalt, Angst, Lüge und Inhumanität bleibt kein Raum für kindliche Unbeschwertheit. Auch wer später einmal für einen kurzen Besuch "nach Hause" zurückkehrt, "gehört für Stunden wieder zum Inventar, so wie Mutti es sich durch die Jahre hindurch hergerichtet hatte". Erziehung fährt hier einen doppelbödigen Kurs: das fadenscheinige "Nur-das-Beste-Wollen" für das Kind im harten Durchgreifen bewirkt im Gegenteil nur Entwicklungslähmung.
Fritz wird zum Außenseiter, und das nicht nur in der Schule oder in der Berufswelt. "Das Kinderdorfkind riecht man gegen den Wind", ein Stempel, fest wie ein Stigma. Jeglicher emotionaler Raum, der sich für ihn auftut, vergiftet sich. Fritz wird Opfer sexueller Übergriffe seines eigenen Lehrers oder mißbraucht für pornographische Fotos. Unbeirrt zeigt der Autor das schamlose Ausnützen der Vertrauens- und Abhängigkeitsverhältnisse, die Mißachtung der Persönlichkeit des Individuums. Indem er zuweilen auch die Position der Stärkeren - eigentlich muß man hier von Tätern sprechen - in den Blickpunkt schleust, wenn sie bei den Opfern naiv um Verständnis heischen, enttarnt er das System in seiner ganzen Verlogenheit. In der Kinderdorfwelt apostrophiert die Ersatzmutti nur eine Scheinharmonie. Ständig ist "die Falschheit in der Luft gelegen". Denn "was in einer Familie wirklich passiert, geht keinen was an". Hier dienen starre Moral und veraltete Werthaltung zur Rechtfertigung des eigenen Vorgehens.
Irgendwann einmal bricht Fritz aus dem circulus vitiosus aus, er betreibt "Ursachenforschung" - das gibt seiner Entwicklung einen Kick, der ihn vom Ohnmachtskarussell abspringen läßt. Doch der Aufbruch in eine neue Welt bringt zwar die Begegnung mit seiner wirklichen Mutter, aber statt der erhofften Beziehungsnähe nur die Erfahrung der Fremdheit: "Wir sind uns fremd. Aus dieser Frau bin ich einmal herausgekommen, auf die Welt gefallen, vor achtzehn Jahren. Wie wenig ich über meinen Anfang weiß."
Deutlich zeigt sich hinter all dem die tief empfundene Isolation des einzelnen: "Jeder lebt für sich allein. Fressen und gefressen werden." Das hinterläßt schwelende Narben in der Vita, aber trotzdem noch immer Hoffnung auf eine lebbare Zukunft. Immerhin deutet sich das auch im offenen Schluß des Romans ganz zaghaft an. Zähe gestaltet sich nur noch der Erinnerungsprozeß. Kindheit verschwimmt, bis sie schließlich zur "Erfindung des Kopfes" wird. Der jähe Kausalitätsdrang, das plötzliche Wissenwollen um die Wurzeln und den Grund der Entwicklung versackt: "Der Schlüssel zur Kindheit bleibt verschwunden. Die Vergangenheit ist nicht mehr auffindbar, was bleibt, sind Spuren, Türklinken, geheimnisvolle Einkerbungen in Baumrinden, die ich nicht mehr deuten kann."
Mit der behutsamen Literarisierung der Geschichte erhält das Leiden dieses Buben ein subtiles Sprachrohr. Der Autor erzählt, ohne bittere Emotionen abzuladen. Jedenfalls entblößt das ungekünstelte, einfache Erzählen die Dimension der offenen seelischen Wunde in ihrer ganzen Tragweite. Mit diesem Buch ist Habringer ein sensibles Porträt gelungen, das berührend ein Schicksal freigibt, geradlinig und ungeschminkt - so, wie es im Leben passieren kann.
LiebesKind - Eine Erfindung Von Rudolf Habringer, Verlag Styria, Graz 1998, 296 S., geb., öS 291,-
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!