Die Wiener Volksoper enttäuscht mit ihrer Neuinszenierung von Carl Zellers Operettenklassiker „Der Vogelhändler“ szenisch wie musikalisch.
Carl Zeller beherrschte beides: Recht und Musik. Im k.k. Ministerium für Kultus und Unterricht brachte es der promovierte Jurist zum Ministerialrat und Leiter des Kunstreferates, in der Musik zum Komponisten zahlreicher Erfolgsoperetten, was ihm auch zahlreiche Neider bescherte. Als 1886 seine Operette „Der Vagabund“ im Wiener Carltheater Premiere hatte, beschied der Minister, dass der Komponist nach dem Ende der Aufführung nicht vor den Vorhand dürfe. „Mit Rücksicht auf seine Eigenschaft als Staatsbeamter“, wie es in der Begründung hieß. Wie wenn nur Politiker Recht auf Applaus hätten. Wenigstens hier hat sich bis heute nichts geändert.
Wohl aber auf der Bühne. „Ein flotter Herzog und ein ebenso flotter Vogelhändler aus Tirol sind die Helden, eine solide Kurfürstin und eine ebenso solide Briefträgerin von ländlicher Klugheit – die Heldinnen der Operette“: So beschrieb der Rezensent des Fremden-Blatts das Sujet des Werks am Tag nach seiner Uraufführung, dem 10. Jänner 1891 im Theater an der Wien. In der Volksoper zeigt man diesen Operettenklassiker, für so manchen Kenner eine der bestenfalls zehn Operetten, die seit ihrer Uraufführung ständig auf deutschsprachigen Bühnen zu sehen sind, nun in einer von Michael Schilhan, dem Intendanten des Grazer Jugendtheaters Next Liberty, erdachten Version. Er transferiert die ursprünglich in der Rheinpfalz zu Beginn des 18. Jahrhunderts spielende Handlung nicht weiter kommentiert in die 1950er Jahre, lässt die Kurfürstin und die gleichfalls in einem kitschigen Postwagen angekarrten Hofdamen in postblauen Kostümen auftreten und hat sich von Mignon Ritter ein bestenfalls für Studentenaufführungen taugendes, so billig wirkendes wie atmosphäreloses Bühnenbild bauen lassen.
Fehlen dürfen in einer solchen Inszenierung, die offensichtlich an den Wert und Gehalt des Stückes nur sehr bedingt glaubt, auch aktuelle Andeutungen, die häufig Klischees bedienen, nicht. So überrascht nicht, dass der Auftritt der beiden Professoren Süffle und Würmchen zum Höhepunkt des Abends gerät. Auch weil Gerald Pichowetz und Gerhard Ernst über das nötige Quäntchen Ironie und Charme verfügen, um diese Szene zu einem kabarettistischen Schmuckstück zu machen.
Regie setzt auf Zufall
Weniger erfreulich sieht es bei den übrigen Protagonisten aus. Und das nicht nur, weil die Regie zu sehr auf den Zufall setzt, den Versuch einer klaren Charakterzeichnung erst gar nicht unternimmt. Aber Musiktheater hängt nun einmal mit Musik zusammen. Und was nützt der beste Singschauspieler, wenn er sich auf die schauspielerische Gestaltung stets besser versteht als auf seine eigentliche Profession, den Gesang. Auffallend ist dieses Missverhältnis vor allem bei Carlo Hartmanns gestalterisch selbstbewusstem, vokal hörbar angestrengtem Baron Weps und Jörg Schneiders nicht selten kurzatmigem Graf Stanislaus.
Zwar kann sich Birgid Steinberger nach nervösem Beginn rasch fangen. Dass sie den Wechsel von der Briefchristel zur strahlend artikulierenden Kurfürstin Marie bereits geschafft hätte, vermochte sie mit ihrer nicht nur in den Höhen unsicheren Darstellung indes nicht zu beweisen. Nicht mehr als Routine sprach aus Regula Rosins Darstellung der von Hysterie und Standesdünkel geplagten, zur unschicken Matrone umfunktionierten wohlhabenden Baronin Adelaide. Daniel Prohaska in der Titelpartie versuchte vokale Defizite durch jugendlichen Charme und perfektes Tirolerisch auszugleichen. Andrea Bogner muss noch einiges von ihrer Unentschiedenheit und Unentschlossenheit aufgeben, um eine glaubwürdige Briefchristel abzugeben.
Noch zu früh waren auch die Vorschusslorbeeren für den bereits Volksopern-erfahrenen Premierendirigenten Henrik Nánási. Warum er an der Spitze des soliden Orchesters und des nicht immer wortdeutlichen Chors (Einstudierung: Michael Tomaschek) immer wieder derart harte Akzente forderte, den Sängern selten genügend Zeit ließ, ihre Phrasen ruhig und erfüllt auszusingen, er damit der Partitur viel von ihrem eigentümlichen melodischen Charme nahm, bleibt sein Geheimnis.
H. Nánási
Verfrüht waren die Vorschusslorbeeren für den Premierendirigenten Henrik Nánási. Warum er immer wieder derart harte Akzente forderte und den Sängern selten genügend Zeit ließ, ihre Phrasen ruhig und erfüllt auszusingen, bleibt sein Geheimnis.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!











































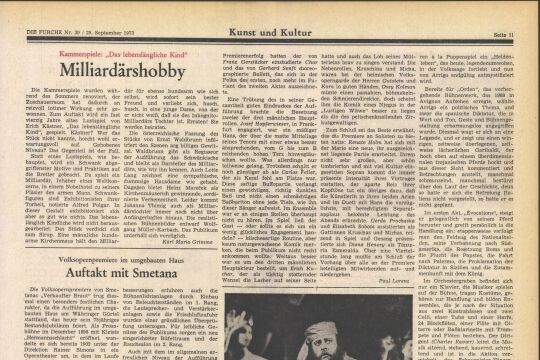






































%20OFS_Monika%20Rittershaus%20(16).jpg)


_RET.jpg)











_edit.jpg)
