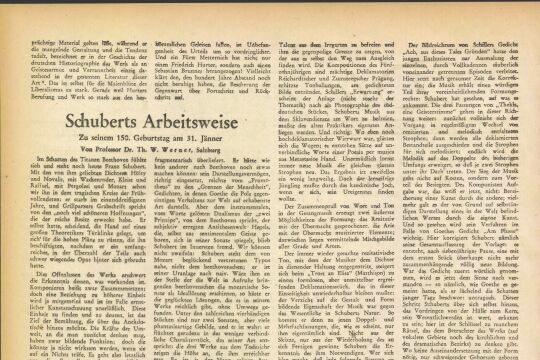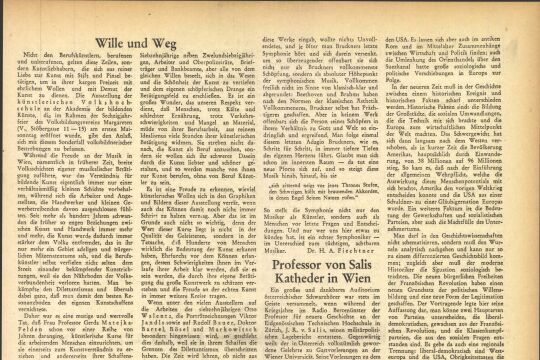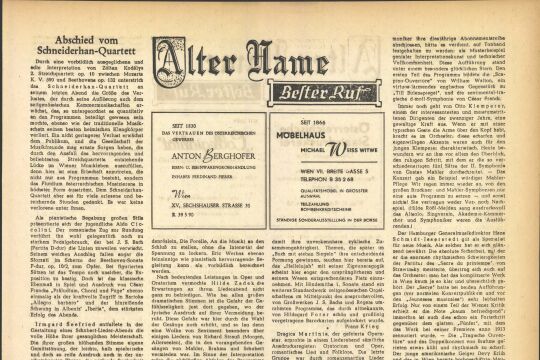Was im Theater an der Wien als Plädoyer für Schuberts "Lazarus“ gedacht war, ging gründlich daneben und wurde zu einem Ärgernis. Szenisch wie musikalisch.
Leicht hatte es Franz Schubert nie. Schon von den Zeitgenossen schwer verstanden, bedurfte es der Liedtranskriptionen von Franz Liszt, um den "Liederfürsten Schubert“ wenigstens mit einem Bruchteil seines Liedœvres ins öffentliche Bewusstsein zu bringen. Ein Fokus, der lange hinderte, auch auf seine übrigen kompositorischen Leistungen entsprechend aufmerksam zu machen, wie es im Laufe des vorigen Jahrhunderts mit unterschiedlicher Fortüne versucht wurde. Etwa aufzuzeigen, dass er mit seinem symphonischen Werk am Beginn einer Entwicklung steht, die direkt zu Bruckner und Schönberg führt, damit eine wesentliche Epoche österreichischer Symphonik einleitet. Spät erkannt wurde auch die Bedeutung seiner Klaviersonaten, die erst nach und nach zu einem festen Bestandteil des Repertoires bedeutender Pianisten wurde.
Schwierig ist es immer noch um die Anerkennung des Bühnendramatikers Schubert bestellt. Was nicht zuletzt darin seinen Grund hat, dass zahlreiche seiner Stücke unvollendet blieben oder zum Teil auf Sujets basieren, die sich aus heutiger Perspektive kaum oder nicht entsprechend auf der Bühne realisieren lassen. Gegenbeispiele schließt das nicht aus. Etwa die damals international umjubelte Wiener Festwochen-Produktion der Oper "Fierrabras“ durch Claudio Abbado in der faszinierenden Regie von Ruth Berghaus. Ein Stück, das auch kommenden Salzburger Festspielsommer auf dem Programm steht: mit Ingo Metzmacher am Pult und Regisseur Peter Stein.
Ob dies ein Anstoß für eine dauerhafte Neubewertung von Schuberts Bühnenschaffens sein könnte, bleibt abzuwarten. Der jüngste Versuch in diese Richtung ist nämlich alles andere als geglückt. Das lag nicht nur an der Wahl des von Tod und Auferstehung handelnden "Lazarus“, eines Oratorienfragments, das im Übrigen weit besser in die Osterzeit als in den Advent gepasst hätte. Vermutlich hatte man für diese Zeit nicht die gewünschte attraktive Besetzung zur Verfügung. Aber auch sie hielt nicht, was die Papierform versprach.
Einmal mehr dokumentierte Kurt Streit in der Titelpartie, dass seine Zeit ziemlich vorbei ist. Annette Dasch und Stephanie Houtzeel als seine Schwestern Maria und Martha hatten nicht nur in der Höhe ständige Probleme. Ladislav Elgrs Nathanael fiel, auch gestisch, vor allem durch Outrage auf. Ordentlich, nicht mehr, Florian Boesch als Simon. Die Liste ließe sich fortsetzen, denn auch die Wiener Symphoniker ließen ihre Klasse nur selten aufblitzen. Wozu sie durch Michael Boders ziemlich trockenes Dirigat, das kaum je vom Reiz Schubert’scher Poesie kündete, auch nur in Maßen gefordert wurden. Einzig der exzellente Schoenberg Chor fiel aus diesem durchschnittlichen Rahmen.
Erwartungen nach dem Tod
Sachlichkeit und Langeweile prägten das Konzept von Regisseur Claus Guth, das er im Wesentlichen auf der Treppe einer schmucklosen Flughafenhalle (Ausstattung Christian Schmidt) realisierte. Inspiriert durch den Zusammenbruch eines Fahrgastes auf einem japanischen Bahnhof wollte er am Beispiel dieses Schubert-Fragments - das er nach der Pause mit Schubert-Liedern, dem Sanctus der Es-Dur-Messe und Orchesterstücken von Charles Ives quasi "komplettierte“ - und anknüpfend an die Schubert stetig begleitende Wanderer-Thematik die Frage nach unseren Erwartungen nach dem Tod stellen, wie er im Gespräch mit seinem Dramaturgen Konrad Kuhn wortreichst paraphrasierte. Mit Darstellern, die sich wie Figuren bewegen oder sich zu statischen Bildern in der Anonymität einer sterilen Wartestelle fügen müssen, lässt sich diese Absicht nicht einmal skizzenhaft verwirklichen, wie dieser dann bald sehr lange Abend zeigte.
Lazarus
Theater an der Wien
20., 23. Dezember
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!