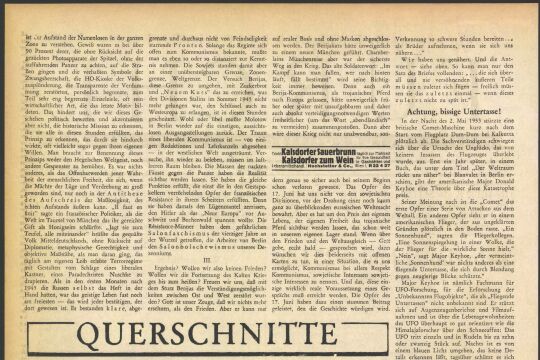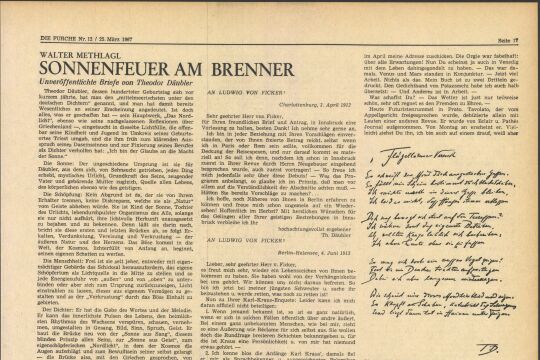Eine Gruppe von Besuchern wird in einen Raum geführt, wo das letzte Gedicht von Georg Trakl, "Grodek" rezitiert wird, ein finsterer Nachruf auf eine untergehende Welt. "Ein zürnender Gott" verbreitet hier ebenso Schrecken wie "das vergossne Blut" und der Schmerz, der "die ungebornen Enkel" meint. Es wird im Abstand mehrere Male von Band gespielt, dazwischen könnte betretene, angespannte Stille sein, wenn nicht im Hintergrund ein dezenter an Gefechtslärm gemahnender Geräuschpegel an so etwas wie Krieg erinnerte. Das sei nicht der Originalton einer tobenden Schlacht aus dem Ersten Weltkrieg, erklärt die Fremdenführerin durch das Reich der Finsternis, aber unheimlich sei es schon. Das war nur ein Missverständnis, das im Verlauf des Salzburger Young Directors Projects zu beobachten war. Wenn Regisseure versuchen, auf der Bühne Krieg zu spielen, fallen die Ergebnisse mickrig aus. Gegen die Wucht des Trakl-Gedichts -und um die zu verspüren, genügt schon die einsame Lektüre am Schreibtisch daheim -wirken die Anstrengungen, künstlich Schrecken zu erzeugen, nahezu kindisch. Auch Projektionen, die bedrückend wirken wollende Schatten und Schemen an die Wand werfen, retten das Unterfangen nicht. Dabei gab es andere Versuche, sich dem Ersten Weltkrieg zu nähern, die durchaus Beklemmung erzeugten.
Krieg auf der Bühne
Die Frage, um die es geht, ist eine prinzipielle: Wie bringt man einen Krieg, noch dazu einen, der als Urzelle aller Gewaltexzesse des 20. Jahrhunderts gilt, auf die Bühne? Der Terror eines Angriffs, den ein einfacher Soldat im Schützengraben auf sich zurollen sieht, ist nicht vermittelbar. Das Erschrecken über die Verwundeten und Toten lässt sich nicht unmittelbar in die Gefühlswelt von Menschen übertragen, die so etwas nie erlebt haben. Die Gefahr, dass konkrete Lebensgefahr draußen im Theater als exaltiertes Schauerstück für ruhelose Darsteller vermittelt wird, mehr King Kong als Zeitgeschichte, ist groß. Manchmal meint man, Theaterregisseure als passionierte Kinogeher zu erkennen. Es ist kein Fehler, sich von Kriegsfilmen beeindruckt zu zeigen, wenn nicht so oft diese Neigung zum Trivialen und Überdeutlichen durchschlagen würde. Theater, das nicht auf Reflexion setzt oder auf Distanz geht, hat schon verloren. Mit der reinen Empathie, in der Hoffnung, die Leute erschüttern zu können, läuft hier gar nichts.
"36566 Tage" heißt das ambitionierte Projekt, das Studierende des Mozarteums Salzburg erarbeitet und unter der Leitung von Hans-Werner Kroesinger auf siebzehn Stationen aufgeteilt haben. Der Titel spricht die Zahl der vergangenen Tage vom Attentat auf Sarajevo zum Tag der Premiere an. Die Ergebnisse erweisen sich zu einem guten Teil als beachtlich und staunenswert. Das gesamte Gebäude des Thomas Bernhard Instituts wird in Beschlag genommen, und jeder Raum öffnet einen neuen Blick auf das Phänomen Weltkrieg. In Kleingruppen aufgeteilt bekommt man eine Auswahl dessen, was erarbeitet worden ist, zu sehen.
Das Team der Mozarteum-Studenten hat ein paar denkwürdige Episoden aus dem Leben der Menschen aus Salzburg in Zeiten des Ersten Weltkriegs gehoben. Zwei Brüder ziehen in den Krieg, die Schwester bewirtschaftet den Hof jahrelang allein. Der jüngere Bruder kehrt aus dem Krieg zurück und übernimmt den Hof umgehend. Als nach zwei Jahren der für tot gehaltene Älteste der Geschwister aus der Gefangenschaft heimkehrt, gehören ihm als Hoferben alle Rechte. Das Aufbegehren der beiden Jüngeren ist berechtigt, aber erfolglos.
Der junge serbische Regisseur Milos Loli´c hat sich Ernst Tollers Drama "Hinkemann" angenommen. Lassen wir es als Jugendsünde durchgehen, wenn ihm ganz warm ums Herz wird, wenn er an den Attentäter von Sarajevo denkt, an Gavrilo Princip, weil er "ein echter Romantiker war"? Ein Doppelmord als romantische Attitüde? Das könnte man als Fantasie eines Wirrkopfs abtun, wenn er nicht einen Auftritt bei den Salzburger Festspielen bekommen hätte. Was ist also von einem Schwärmer zu halten, der sich über das Stück eines Autors hermacht, der eine gewichtige Rolle in der kurzlebigen Münchner Räterepublik einnahm?
Katastrophe und Schrecken
Das Leben ein Ringelspiel. Dieses steht in der Mitte der Bühne vor pechschwarzem Hintergrund und ist vor allem eine Metapher. Es dreht sich, die Leute drehen sich mit, es ist Schicksal, auf welcher Seite des Geräts man sich befindet. Das schafft eine seltsam verspielte Atmosphäre, die so gar nicht passt zum Leiden, das die Menschen heimsucht. Heimsuchung wäre tatsächlich der passende Begriff für jenes schicksalhafte, unergründbare Aus-der-Welt-Fallen, das sie alle trifft und dem sie nichts entgegenzusetzen haben. Eugen kommt entmannt heim aus dem Krieg -was heißt schon Heimkehr für einen, der fortan gesellschaftlich geächtet wird. Um etwas vom Schrecken, der die ganze Gesellschaft erfasst, erahnbar zu machen, fließt Blut, wenn sich Eugen, um bei seiner Frau noch punkten zu können, als Jahrmarktsattraktion lebenden Ratten den Kopf abbeißt. So hofft er, die beiden durchzubringen. Für Toller, den Anarchisten, war der Krieg eine Katastrophe, für Loli´c ein Glück, "weil er die Südslawen endlich vereinte." So steht es im Programmheft. Toller und Loli´c, die beiden passen einfach nicht zusammen.
Als Auftragsstück für die Salzburger Festspiele hat Walter Kappacher "Der Abschied" geschrieben, ein Drama für drei Personen. Aus Spargründen musste er es zu einem Monolog umarbeiten, dieser wurde noch einmal zusammengestrichen. Was Regisseur Nicolas Charaux daraus gemacht hat, lässt sich schwer sagen, das Stück wurde zur Lektüre nicht frei gegeben. Dieses Gebaren erinnert an eine Geheimsache der höchsten Stufe. Autoren sind dem Schauspielchef Sven-Eric Bechtolf ohnehin nicht wichtig, sie sind klein gedruckt im Programmheft versteckt.
Achtung Symbol
Georg Trakl höchstpersönlich wird auf die Bühne gestellt, auf dieser steht ein schwarzer Kasten -Achtung Symbol! -, aus dem muss sich Trakl erst gewaltsam mit einer Axt befreien. Wir erleben die letzten Tage des Dichters, der psychisch schwer gezeichnet ist von all den Verwundeten, die er heillos überfordert als Sanitäter zu versorgen hat. Jetzt ist er weggesperrt in der Psychiatrie, wo er seinen letzten Leidensgang antritt. Der schwarze Kasten steht auch für den Gefühlspanzer, er bedeutet mehr inneres Gefängnis als körperliches Eingesperrtsein. Trakl bediente sich bevorzugt der Lyrik, um sein beschädigtes Ich zum Sprechen zu bringen. Auf der Bühne sehen wir einen, der ununterbrochen von sich redet, und vollzieht sich eine nicht unproblematische Historisierung. Wer kann sich schon in Trakls Kopf mogeln, um aus diesem heraus seine Welt zu erklären? Mit dem Roman "Der Fliegenpalast" hat Kappacher bewiesen, dass er fremde Gestalten wie Hofmannsthal nahezubringen vermag. Mit einer sanften Ironie schuf er jene Distanz, die ihn davor bewahrte, Hofmannsthal nur zu mimen statt zu deuten. Mit Ironie ist bei Trakl nichts zu machen, aber auch sonst findet sich keine Abwehr, die Paul Herwig davor bewahrt, als Trakl-Zwilling zu agieren. Dabei ist die Vorgangsweise durchaus kühn. Die Quellen sind karg, Selbstzeugnisse rar, die meisten Informationen stammen aus zweiter Hand, und dazwischen viele Leerstellen für einen fantasiebegabten, einfühlsamen Dichter.
So friedlich, wie Trakl am Ende still in eine Nische schlüpft, die ihm sein Grab wird, haben wir uns den Tod des poetischen Radikalmelancholikers nicht vorgestellt. Jetzt warten wir noch auf Kappachers Text.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!