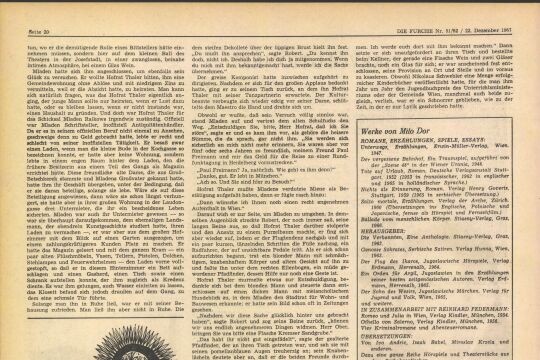Auch der junge Nabokov verstand es bereits gut, zu unterhalten und zugleich zu irritieren.
Vor einem roten Schloss grünte eine von prächtigen Ulmen umstandene junge Rasenfläche. Am frühen Morgen glättete sie der Gärtner mit einer steinernen Walze": Große Prosa, die so anhebt, konnte nach den zwanziger- und dreißiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts wohl kaum mehr entstehen. Viel früher aber auch nicht. Dies wiederum lässt uns nämlich das köstliche Bild "Magor räusperte sich, bleich wie ein Embryo in Spiritus" vermuten. Ein "riesiger schwarzer, nagelneuer Rolls Royce", dem im Halbdunkel der Garage "ein Geruch von Benzin und Leder entströmte", könnte allenfalls freilich auch ein Modell aus der Zeit vor 1914 sein. Gegen Ende der Geschichte wird man das Gefährt am Bahnhof finden, mit einem Abschiedsbrief des Sohnes an den "lieben Vater" auf dem Sitz: "Du wolltest in Deinem Hause keine Romanzen, deshalb reise ich ab und nehme die Frau mit, ohne die ich nicht leben kann."
Leider schweigt sich der Verlag über das Entstehungsjahr der Novelle "Die Venezianerin" ("Wenezianka") von Vladimir Nabokov aus. Nicht das kleinste Vor- oder Nachwort in dem schmalen, eleganten Büchlein der "indigo"-Reihe von Manesse. Wir tippen auf die Berliner oder Pariser Jahre des mit seiner Familie den Bolschewiki entkommenen Aristokraten, dessen Vater, einer der Führer der liberalen russischen Demokraten, in Berlin von einem Rechtsradikalen erschossen wurde, als er einen anderen Mann decken wollte. Im selben Jahr 1922 schloss der 23-jährige Vladimir Vladimirowitsch, der von der Zoologie auf die Literaturwissenschaft umgesattelt hatte, seine Studien am Trinity College in Cambridge mit glänzenden Zeugnissen ab.
Die Entschiedenheit, mit der Nabokov später jeden Einfluss des Verbrechens auf seine literarische Arbeit weit von sich wies, obwohl der irrtümliche Mord öfter bei ihm vorkommt, lässt im Gegenteil vermuten, dass Nabokovs ausgeprägter Sinn für Balanceakte zwischen Ironie und Tragik mit dem frühen Verlust des Vaters sogar sehr viel zu tun hatte.
In der "Venezianerin" allerdings hallen eher die Eindrücke der Studienzeit in England nach. Schauplatz ist das Schloss eines pensionierten britischen Obersten. Mit subtiler Ironie beschreibt Nabokov, der seine ersten Gedichtbände noch in Russland veröffentlicht hatte und ab 1925 von der Lyrik zur Prosa überwechselte, eine skurrile Gesellschaft, die von der schönen Maureen gründlich durcheinandergebracht wird. Da wäre der Gastgeber, der Oberst mit dem fleischigen Gesicht, "das aussah, als hätte es jene schweren, grauen Schnurrbarthaare, die sich über seiner Oberlippe bauschten, eben erst ausgespuckt". Da wäre der Sohn Frank mit dem "gelassenen Lächeln auf seinem glattrasierten, braungebrannten Gesicht, das eine dichte Reihe blendendweißer Zähne zeigte" (damals durfte man als Dichter einen Menschen noch ohne Gefahr der Disqualifikation als Zahnpasta-Reklame beschreiben). Da wäre der Studienfreund des Sohnes "mit sanftmütigen, aber etwas irren Augen, die wie ermattete, himmelblaue Schmetterlinge hinter den Gläsern seines Kneifers blinkten und blinzelten" (Nabokov hielt es schon immer mit den hochtrabenden Vergleichen). Da wäre Magor, ein etwas dubioser "alter Restaurator noch älterer Gemälde, dem die Welt als reichlich garstige, mit unbeständigen Farben auf eine vergängliche Leinwand gemalte Studie erschien". Und da wäre Magors Frau Maureen, die auf frappierende Weise der im 15. Jahrhundert porträtierten Dame gleicht, deren Porträt der Major mit Magors Hilfe soeben erworben hat. Die Atmosphäre ist dicht, zu des Majors Missvergnügen knistert es vernehmbar zwischen Frank und Maureen.
Das Buch liest sich bequem in zwei Stunden und hinterlässt einen angenehmen Abgang von Schlosspark, moderndem Laub und Düften "nach Myrte und Wachs und ein klein wenig nach Zitrone", die den empfangen, der es versteht, in ein altes Bild hineinzugehen. Die kunstvoll antiquierte Erzählkunst des frühen Nabokov vermittelt ähnliche Empfindungen wie die niemals renovierte Halle eines Luxushotels der zwanziger Jahre. Das kleine, von keinem der zu Rate gezogenen Lexika erwähnte Werk vermittelt einen guten Eindruck von der Meisterschaft des jungen Nabokov, der sich mit Russisch-, Englisch- und Tennisstunden sowie gelegentlichen Filmauftritten durchschlug und die Honorare für seine in winzigen Auflagen in exklusiven Kleinverlagen erscheinenden Bücher in die Jagd nach seltenen Schmetterlingen investierte, über die er eine ganze Latte wissenschaftlicher Publikationen schrieb. Und der auch später in den usa mit keinem Buch mehr als wenige hundert Dollar verdiente, bis die "Lolita" dem 56-Jährigen den Weltruhm bescherte.
Er lebte mit Frau und Sohn noch eine Weile so weiter, wie sie immer gelebt hatten, indem sie die Häuser der zu längeren Forschungen nach Europa reisenden amerikanischen Professorenkollegen hüteten. 1959 kehrte Nabokov nach Europa zurück und zog als reicher Mann in ein schäbiges Hotel in Montreux, wo er 1977 starb. Nur noch "im imaginären Staat der Erinnerungen und der Kunst" beheimatet, verweigerte er nach dem Verlust seiner Heimat jede Sesshaftigkeit. Die Beheimatung im imaginären Staat der Kunst ist auch bereits das eigentliche Thema der "Venezianerin". Sie und das Hereinspielen des Unerklärlichen in die sichtbare Welt. Denn obwohl die seltsamen Ereignisse um das Damenbildnis von Sebastiano Luciani völlig unmystisch aufgeklärt werden, bleibt ein unaufgelöster und irritierender Rest. Denn die verschrumpelte Frucht, die unter dem Fenster im Garten liegt, ist dem Bild der Venezianerin entfallen, stammt also aus einer etwas anderen Welt.
DIE VENEZIANERIN
Von Vladimir Nabokov
Aus dem Russischen von Gisela Barker
Manesse Verlag, Zürich 2001 (Manesse indigo)
88 Seiten, geb., e 9,90 (D)
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!