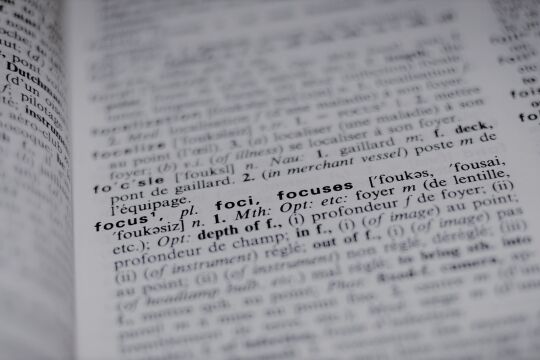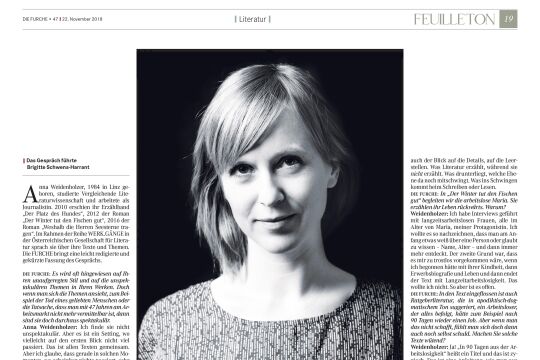Hans Eichhorn: "Sprache, mit der ich die Welt sehen kann"
Fischer am Attersee, Autor von Lyrik, Prosa und Dramoletten: Was der oberösterreichische Schriftsteller Hans Eichhorn als aufmerksamer Beobachter seiner Umgebung am See und anderswo wahrnimmt, findet seit vielen Jahren auch Wege in die Literatur.
Fischer am Attersee, Autor von Lyrik, Prosa und Dramoletten: Was der oberösterreichische Schriftsteller Hans Eichhorn als aufmerksamer Beobachter seiner Umgebung am See und anderswo wahrnimmt, findet seit vielen Jahren auch Wege in die Literatur.
Seit über 20 Jahren ist Hans Eichhorn als Schriftsteller tätig. Der folgende Text ist eine redigierte Kurzfassung eines in der Österreichischen Gesellschaft für Literatur geführten Gesprächs über seine Werke.
DIE FURCHE: Sie werden immer auch als Berufsfischer vorgestellt? Stört Sie das oder passt das Fischen ohnehin zum Schreiben?
Hans Eichhorn: Ich wollte eigentlich anfangs mit der Literatur von der Berufsfischerei wegkommen. Aber im Lauf der Jahre habe ich bemerkt, dass ich das Fischen und die Atmosphäre des Fischens auch ganz gut in die Literatur integrieren, mich davon anregen lassen kann. Insofern ist es jetzt eher befruchtend, als dass es ein Gegensatz wäre. Aber natürlich ist es auch ein Gegensatz.
DIE FURCHE: Wie fing es denn überhaupt an - das Schreiben?
Eichhorn: Ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, wo es eigentlich keine Bücher gegeben hat. Trotzdem war dieser Drang da, etwas mit der Sprache zu machen. Ich habe mir schwergetan, in der Schule einen Stoff aufzunehmen. Der Widerwille dagegen war sehr groß und auch beim Studium habe ich bemerkt: Eigentlich geht mich dieser Stoff gar nichts an, wenn ich nicht vorher eine Sprache habe für mich, mit der ich die Welt sehen kann. Ich dachte, ich muss mir zunächst selber eine Grundlage schaffen, um das alles aufnehmen zu können.
DIE FURCHE: Der Titel von Ihrem ersten Lyrikband "Das Zimmer als voller Bauch" scheint geradezu programmatisch. Zimmer ist das, was mich unmittelbar umgibt, wo ich drinsitze und alles Mögliche sehe. Ihre Gedichte wären strikt gegenständlich und strikt alltäglich, habe ich einmal gelesen. Empfinden Sie das als eine passende Zuschreibung?
Eichhorn: Ja, alltäglich sicher. Es stimmt, was Sie erwähnt haben: Ich versuche, von den mich umgebenden Dingen und Gegenständen auszugehen. Ich befrage sie: Was will dieser Sessel von mir? Was will dieses Glas Wasser von mir? Ich versuche darauf zu horchen, was die Dinge sagen. Und was meine Antwort darauf wäre oder sein könnte. Und so entwickelt sich eine Art Dialog mit dem, was mich umgibt. Dann versuche ich das eventuell in einen größeren Zusammenhang zu stellen oder diesen größeren Zusammenhang zu ignorieren oder zu ironisieren - und daraus entwickelt sich ein Gebilde, das man dann vielleicht Gedicht nennen könnte. Diese Alltäglichkeit ist sicher gegeben. Das Gegenständliche wird aber nicht ganz eingelöst. Es verschwimmt manchmal in der Syntax, wird ein bisschen ins Abstrakte geschoben.
DIE FURCHE: Mir scheint, Sie interessiert auch in der Prosa nicht der Plot, sondern vor allem die Sprache, der Satz?
Eichhorn: Das stimmt absolut. Ich lege meine Karten nicht auf den Tisch. Ich trete eine Reise an und denke mir: Vielleicht kann jemand einsteigen, damit etwas anfangen. Ich habe das Gefühl, ich habe nichts zu erzählen, denn wissensmäßig weiß eh jeder mehr als ich. Ich kann nur versuchen hineinzuhorchen, was mich interessiert, wohin mich dieses Sprachbild bringt. Und vielleicht kommen Momente, wo ich mir sage: Ja, so habe ich es noch nicht gesehen! Das ist dann aber eher ein Glücksfall, ein Zufall für mich, dass ich das gesehen habe und sehen kann. Ich kann nicht auf einen bestimmten Punkt hin erzählen, denn dann wäre schon im Vorhinein etwas fixiert - und wenn ich diesen Weg schon vorgezeichnet habe, dann kann ich ihn nicht gehen.
DIE FURCHE: "Der Ruf. Die Reise. Das Wasser" ist aber in der Nacht entstanden ...
Eichhorn: Die Kinder waren noch klein. Ich konnte mich untertags wenig konzentrieren aufs Schreiben, aber in der Nacht war es halbwegs ruhig und das Buch ist so zwischen zwei und vier Uhr nachts entstanden.
DIE FURCHE: Die gleiche Zeit, der gleiche Ort und eine dennoch immer neue Wahrnehmung spielt auch eine Rolle in Ihrem "Logenplatz-Projekt".
Eichhorn: Das entstand, als ich die Fischerei und die Landschaft, wo ich aufgewachsen bin, verstärkt mit hereinnehmen wollte in die Sprache, in die Literatur. Einen Sommer lang habe ich mich jeden Tag direkt ans Seeufer gesetzt, bevor ich zu den Fischernetzen ausgefahren bin, und habe notiert. Und zwei Sommer lang habe ich mich auf den Balkon des Fischerhauses gesetzt und habe beobachtet, wie die Sonne aufgeht, die Veränderungen, die Farben, und war sehr beeindruckt, was da in Sekundenbruchteilen passiert rundum, wenn man sich einfach hinsetzt und nur schaut. Dann habe ich versucht, das irgendwie in Sprache zu bringen. Man hat die bekannten und auch kitschigen Landschaftsbilder vor Augen und ist doch überwältigt davon: Wie kann man das transportieren, wie kann man das in Sprache bringen? Das war der Reiz daran. Das hat mich drei Sommer lang jeden Tag beschäftigt.
DIE FURCHE: In "Circus Wols" haben Sie sich mit dem Künstler Wols auseinandergesetzt. Biografien zu schreiben, ist ein heikles Unterfangen, Sie haben aber eine bestimmte Form dafür gefunden.
Eichhorn: Die ältereren Kinder haben gerade mit der Schule angefangen und ich dachte, so eine Art Schulegehen sollte das werden. Dass man von Anfang an Buchstabieren lernt. So ähnlich möchte ich mich an diese Biografie, an diese Bilder und an diese Fotos annähern. Ich versuchte anhand der Chronologie, des Lebensabrisses, den ich vorgefunden habe, mir in einer Art Tagebuch zu vergegenwärtigen und für mich zu deuten: In welcher Situation war er, wie könnte das gewesen sein, wie könnte das anders gewesen sein?
Das Buch besteht aus vielen Fragen. Das entspricht vielleicht auch ein bisschen dem, was ich von seinen Zeichnungen herauslese. Damals habe ich auch mein Postkartenprojekt mit Richard Wall angefangen. Gerade dieses Kleinformatige, das Wols auch gemacht hat, weil er ja in Gefangenschaft und im Lager keine großen Formate ausfüllen konnte, hat mir gefallen. Wols hat gesagt, die Welt kann man auch in einem handtellergroßen Blatt abbilden.
DIE FURCHE: Ihr Buch "Die Liegestatt. Manifest" nannten Sie eine Reverenz an Samuel Beckett. Wie verträgt sich Manifest mit Beckett?
Eichhorn: Das ist natürlich eine Irreführung, eine Provokation. - Naja, es ist schon so eine Art Appell für einen poetischen Text, für Poesie. Ich wollte beharren auf meiner kleinen Form, auf den kleinen Texten, auf dem Poetischen in den Texten. Es ist ein Buch, das völlig im Liegen zustande gekommen ist, im Bett -und da hat man nur den Plafond über sich. Und diese kurzen Notate: Das ist mein Manifest.
DIE FURCHE: Inwieweit war Beckett wichtig für Ihr Schreiben?
Eichhorn: Ich habe eine Zeitlang sehr viel Beckett gelesen. Und die längeren Texte, die Romane, waren für mich immer eine Literatur, die versucht hat, sehr zögerlich und auch sehr überlegt Schritte zu machen und auch wieder in Frage zu stellen. So ähnlich habe ich das dann entwickelt. Einen Schritt vor und zwei zurück oder zwei vor und einen zurück, je nachdem. Immer auch mit in Frage zu stellen, wohin der nächste Satz führt.
DIE FURCHE: 2013 erschien dann mit "Und alle Lieben leben" eine sehr innerliche Prosa.
Eichhorn: Dieses Buch ist insofern persönlich, als darin eine Erkrankung von mir thematisiert wird. Ich war im Krankenhaus, ich habe dort auch notiert. Diese Texte sind im nachhinein entstanden und insofern ist die Erfahrung vorhanden. Ich hoffe, sie ist nicht überwiegend und nicht erdrückend. Schon vom Titel her habe ich versucht, etwas Erfreuliches zu bringen, er ist eine Zeile aus einem Handke-Gedicht. Das Buch beginnt in einem Haus, wo zwei Personen leben, die beide auf ihre Art schwer miteinander kommunizieren können. Es ist aber eigentlich ein Morgenbuch - und der Versuch, dieses Bedrückende in Sprache zu bewältigen und aufzulösen. Inwieweit es gelungen ist, weiß ich nicht.
DIE FURCHE: Mir scheint, dass Sie versuchen, dass die Hoffnung durch die Sprache selbst kommt. Der Satz "Und alle Lieben leben" wird etwa immer wieder wiederholt, als ob er performativ dann auch wirklich würde - je öfter ich den Satz spreche, desto wahrer wird er dann?
Eichhorn: Es ist vielleicht ein bisschen Beschwörung drinnen, ein bisschen Gebet, ja.
WERK.GÄNGE
In dieser Gesprächsreihe spricht Brigitte Schwens-Harrant mit Autorinnen und Autoren über deren Werke und über Literatur und Poetik.
Nächster Gast: THOMAS STANGL 15. Februar 2016,19 Uhr Österreichische Gesellschaft für Literatur Herrengasse 5,1010 Wien. www.ogl.at
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!








































































.jpg)