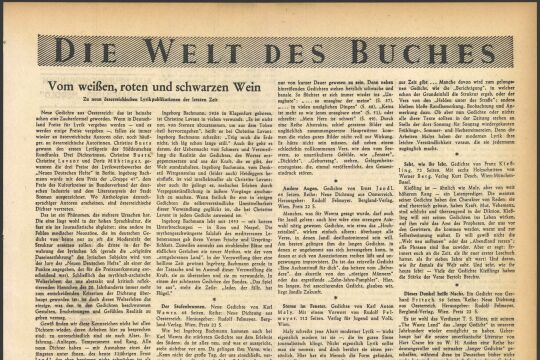Ilse Aichinger: "Schreiben ist sterben lernen"
Mit ihrem Roman "Die größere Hoffnung" begann die österreichische Nachkriegsliteratur, als Formkünstlerin machte Ilse Aichinger Furore. Ein Nachruf.
Mit ihrem Roman "Die größere Hoffnung" begann die österreichische Nachkriegsliteratur, als Formkünstlerin machte Ilse Aichinger Furore. Ein Nachruf.
In einem ihrer letzten Texte zitierte Ilse Aichinger Viktor Frankl: "'Am Ende steht der Sinn.' Aber am Ende steht naturgemäß nicht der Sinn, sondern das Bestattungsinstitut Perikles." Zwischen dem Titel dieser Glosse, "Trotzdem Nein zum Leben sagen", und dem ihres ersten Buches "Die größere Hoffnung" (1948) scheint sich eine Kluft aufzutun. Für Ellen, das halbjüdische Mädchen in Aichingers berühmtem Roman, der immerhin gleich bei S. Fischer erschien, ist die größere Hoffnung jene hinter der großen Hoffnung des Überlebens. Sie ist eine, die frei macht, die Utopie des Todes, es bedarf eines Anlaufs, eines Sprunges, um sie zu verwirklichen. Von Sinn ist in dem Buch nicht die Rede, aber es hat, ohne jede Sentimentalität, das Pathos des Trostes.
Poesie und Präzision
Aichinger beschreibt das als Silhouette erkennbare Wien der Nazizeit als ein prekäres Königreich der Kinder, die bis zuletzt spielen, während mit ihnen ein grausames Spiel gespielt wird, bei dem es darum geht, die richtigen Großeltern zu haben. Ellen schließt sich den Verfemten an, brüstet sich mit dem gelben Stern, der ihr nicht zusteht. Mit "Die größere Hoffnung" begann die österreichische Nachkriegsliteratur: mit einem Buch, das sich der neuen Nüchternheit versagte und das, in seiner Balance zwischen Poesie und Präzision, noch immer zu Tränen zu rühren vermag. Damals wie heute verwechselten Kritiker den Reichtum an Bildern mit uneigentlichem nebulosem Sprechen vom Schrecklichen. Aichinger aber redete nicht in Rätseln, sondern von ihren Erlebnissen als Kind, dessen Mutter (die Eltern waren lange geschieden) nur durch seine Existenz geschützt war, dessen Zwillingsschwester nach England verschickt wurde, dessen Großmutter in Minsk umkam - und das die Parteinahme für die Ausgestoßenen ein Leben lang nicht revidieren sollte.
Mit dem Schreiben hatte Aichinger begonnen, ehe sie das Medizinstudium - ihre Mutter war Ärztin - an den Nagel hängte. Schon 1946 veröffentlichte sie in Otto Basils Zeitschrift Plan mit dem "Aufruf zum Mißtrauen" einen Schlüsseltext der jungen Literatur, ein Plädoyer gegen die neue alte Selbstgerechtigkeit des Pharisäers: "Und wir beruhigen uns wieder. Aber wir sollen uns nicht beruhigen!" Nicht als Unruhestifterin, sondern als Formkünstlerin machte Ilse Aichinger 1952 bei der "Gruppe 47" in Deutschland Furore, erhielt deren Preis für die "Spiegelgeschichte", in der sie ein Leben im raffiniert gebrochenen Rückwärtsgang erzählt, von der Bahre bis zur Wiege, vom Todeskampf nach einer mißglückten Abtreibung bis zum - "Sei geduldig! Bald ist alles gut" - ersten Atemzug, auch dies eine Apotheose des Verschwindens in der Nichtexistenz, wo Geburt und Tod in eins fließen. Nun erst entdeckte der Betrieb die "Größere Hoffnung", das "Fräulein Kafka" aus Wien mit seinen Parabeln über Schmerz und Ohnmacht galt selber als Hoffnung, als literarische, und leistete es sich zu enttäuschen.
"Meine Sprache und ich"
Ein zweiter Roman blieb aus, früh übte sie das Wenigerwerden mit kurzen Erzählungen, Traumberichten. 1953 heiratete Aichinger den Lyriker Günter Eich und veröffentlichte ihr erstes Hörspiel "Knöpfe", surreale Literatur der Arbeitswelt: Arbeiterinnen verschwinden und hinterlassen bloß Knöpfe mit ihren Namen. Mit ihrem Mann (Eich starb 1972) und ihren beiden Kindern lebte die Autorin in Großgmain, zwischen ihren Publikationen verstrichen Jahre. Die Prosasammlung "Schlechte Wörter"(1976), ihr sperrigstes, abstraktestes Buch, beginnt mit einer Absage an das Virtuose und an die Idee der Komposition: "Ich gebrauche jetzt die besseren Wörter nicht mehr". Und: "Niemand kann von mir verlangen, daß ich Zusammenhänge herstelle, solange sie vermeidbar sind."
Zwei Jahre später fasst Aichinger ihre persönliche Musil-Nachfolge in "Meine Sprache und ich", dem Titeltext eines Erzählbandes, zusammen: "Meine Sprache und ich, wir reden nicht miteinander, wir haben uns nichts zu sagen. Was ich wissen muß, weiß ich, kalte Küche ist ihr lieber als warme (...). Ich überstürze mich nicht, wie zu Beginn."
In Wahrheit scheint Ilse Aichinger auch noch den frugalsten Speisezettel zu reduzieren und in Schweigen zu verfallen, erst 1987 erscheint der Prosaband "Kleist, Moos, Fasane" (nach dem virtuellen Raum der Gassennamen in Wien Landstraße), den Wilhelm Genazino zu seinen Lieblingsbüchern zählt: Er kenne kein Buch seit Kafka, "in dem die Entblößung des modernen Ichs rückhaltloser eingestanden wird als hier". Tatsächlich sagt Aichinger hier zum ersten Mal ganz unverstellt Ich, findet sie zurück zu den dunklen Orten ihrer Kindheit und stellt sich dem schonungslosen Nachdenken über die Existenz: "Schreiben ist sterben lernen."
Dennoch entschwand die Dichterin, die nach einem Frankfurter Zwischenspiel seit 1989 wieder in Wien lebte, fast ganz aus der öffentlichen Wahrnehmung, ehe sie sich, animiert von Richard Reichensperger, mit dem "Journal des Verschwindens" im Standard regelmäßig zu Wort meldete. Ihre lebenslange Leidenschaft für das Kino als einen Ort des gnädigen Sichverlierens wird zum Schreibmotor, manchmal geht sie viermal täglich, nulla dies sine cinema: 2001 erscheint "Film und Verhängnis - Blitzlichter auf ein Leben".
Weltumfassende Mieselsucht
Vom schwer Begreiflichen hat Ilse Aichinger zum unverrätselt Lakonischen gefunden, auch zum verpönten Zusammenhang, gerade im Beiläufigen, scheinbar Zufälligen. In ihrer Glossen pflegte Aichinger, das ewige Wiener Kind, eine weltumfassende Mieselsucht und einen düsteren Witz. Auf Schicksalsschläge, die das Frankl'sche Sinngebot frivol erscheinen lassen - den Tod ihres Sohnes, des Schriftstellers Clemens Eich, und ihres Lebensmenschen Richard Reichensperger - reagierte sie mit Obstinatheit und Renitenz. Die klingt schon in "Nachruf" an, einem Gedicht aus dem einzigen, wunderbar wortkargen Lyrikband "Verschenkter Rat"(1978): "Gib mir den Mantel, Martin, / aber geh erst vom Sattel /und laß dein Schwert, wo es ist, / gib mir den ganzen." -
Sie, die große Dichterin, die allen großen Worten abhold war und um den Preis des guten Rates wusste, ging immer aufs Ganze, auch mit dem kleinsten Zipfel Wirklichkeit. Aichingers Zauberwort war Genauigkeit, als Gegensatz nicht zum Flüchtigen, sondern zum allzu Kunstvollen: "das Genaue ist meist weniger schön", meinte sie einmal abfällig über die Bachmann. Daher kam es, dass sie die Welt als fremd darstellen musste, um wahrhaftig zu sein, ja dass sie das Nicht-Schreiben als die eigentliche Herausforderung ihres Berufes sah: "Ich verdächtige alles, was man mit Recht sagen kann, schon lange."
Dem Tod und dem Nichts begegnete sie mit kaltschnäuziger Koketterie, Cioran, der Prediger der Verneinung, war ihre Bibel. Von ihm lernte sie wohl ihre unheimliche Gelassenheit. Auf die Frage, was von ihrer Literatur bleiben solle, meinte sie einmal: "Es muß gar nichts bleiben. Hauptsache, es kommt eine neue."

Liebe Leserin, lieber Leser,
Mit einem Digital-Abo sichern Sie sich den Zugriff auf über 40.000 Artikel aus 20 Jahren Zeitgeschichte – und unterstützen gleichzeitig die FURCHE. Vielen Dank!
Mit einem Digital-Abo sichern Sie sich den Zugriff auf über 40.000 Artikel aus 20 Jahren Zeitgeschichte – und unterstützen gleichzeitig die FURCHE. Vielen Dank!
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!