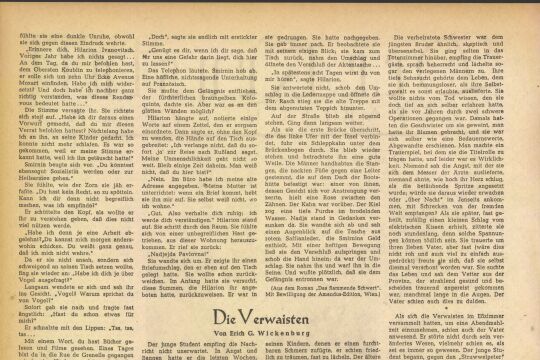Mein Elternhaus
Die Schriftstellerin Getrude le Fort erzählt über wechselnde Wohnsitze, den Kriegsgeist ihres Vaters und über eine bedeutungsvolle Geschichte ihrer Ahnen.
Die Schriftstellerin Getrude le Fort erzählt über wechselnde Wohnsitze, den Kriegsgeist ihres Vaters und über eine bedeutungsvolle Geschichte ihrer Ahnen.
Mein Elternhaus war nicht, wie das der meisten Menschen, gleichbedeutend mit der Heimat: es war nicht jenes sichtbare Haus, das sich nur einmal auf Erden findet, in einem einmaligen Ort, eine einmalige Landschaft gestellt — eben in die Heimat, sondern es stand im Laufe der Jahre hier und dort, wie der wechselnde Dienst meines Vaters es mit sich brachte. Es hatte vielfache und zufällige Gestalt — was es zum Elternhaus machte, waren Vater und Mutter: von ihnen muß ich sprechen, wenn ich von meinem Elternhaus erzählen soll. Freilich, neben dem wechselnden Wohnsitz gab es auch eine Heimat, wohin wir jedes Jahr für einige Zeit und schließlich für ganz zurückkehrten als zu dem Ruhepunkt in der Erscheinungsflucht der verschiedenen Wohnsitze: meine Eltern selbst waren beide Kinder der Scholle, innig verbunden den Landschaften, in denen die Güter ihrer Familien lagen: mein Vater jenem kleinen, bezaubernden und — in meiner Jugend noch — verzauberten Land, das sich Mecklenburg nennt, meine Mutter — sie war aus dem Geschlecht von Wedel — der herberen Mark. Beide waren von der Heimat geformt, beide trugen aber auch einen Einschlag im Blut, der die Grenzen dieser Heimat sprengte: die Mutter von ihrer würzburgischen Mutter her, der Tochter des genialen Miterfinders der Schnellpresse, mein Vater durch die ungewöhnlich lange und reiche Geschichte der Le Forts: der Ruhepunkt in der Erscheinungsflucht der wechselnden Wohnsitze, zu dem wir immer wieder zurückkehrten, war seinerseits der Ruhepunkt auf der langen Wanderschaft, welche die Familie meines Vaters durch halb Europa zurückgelegt hatte, bevor sie mein erweitertes .Vaterhaus, bevor sie Deutschland fand.
Meine frühen Erinnerungen an meinen Vater sind erfüllt von den Eindrücken, welche der Beruf meines Vaters mit sich brachte. Ich höre, wenn ich an meine Jugend zurückdenke, den Klang der alten historischen Märsche und das Klirren der Kavallerieschwadronen über weitem Manövergelände, ich vernehme, wie aus weichen dunklen Sommernächten, den Choral des Zapfenstreichs: „Ich bete an die Macht der Liebe.“ Es ist heute wenig genehm, sich zu solchen Erinnerungen zu bekennen, aber eben dies bedeutet für mich Antrieb und Verpflichtung, es mit Freudigkeit zu tun, verkörpert doch die edle Gestalt meines Vaters noch den Geist jener alten deutschen Armee, deren eigentliches Berufsethos nicht sowohl am Gedanken des Angriffs als an dem der Verteidigung des Friedens hing.
Mein Vater gehörte zu jenen geistvollen und hochgebildeten Offizieren der alten Armee, die vom Studium der Kriegsgeschichte zum Studium der Geschichte überhaupt gekommen waren. Mein Interesse flog ihm hier früh und leidenschaftlich entgegen — er fühlte es und pflegte es bewußt. Schon als kleines Mädchen machte es mich überglücklich, wenn er mir Geschichtliches erzählte. Dabei ging er in höchst sinnvoller Weise immer vom Nächstliegenden, also von der eigenen Familiengeschichte aus. Denn die Le Forts waren eigentlich überall dabei gewesen. Ging es um das Zeitalter der Glaubenskriege, so erschien Calvin, der unsere aus Savoyen geflüchtete Familie in Genf aufnahm, wo auch ihr deutscher Zweig noch immer sein unverlierbares Bürgerrecht besitzt. Wandte man sich der Französischen Revolution zu, so erblickte man die drei Le Forts, die als Offiziere Ludwigs XVI. in den Tuilerien mitgekämpft hatten und von denen der eine den letzten Fluchtplan der unglücklichen Marie Antoinette entwarf. Sprach man von den Freiheitskriegen, so gedachte man des Turnvaters Jalwi, der in der Familie der Le Forts Hauslehrer gewesen war. Wenn man auf dem Gut am Müritzsee das Archiv öffnete, so fesselte die in Gold gefaßte Miniatur Peter des Großen, nach dem jedes Mitglied der Familie noch heute auf den Namen Peter oder Petra getauft wird. Vor allem aber fesselten die beiden kaiserlichen Urkunden aus Wien, von denen die ältere die Unterschrift Kaiser Leopolds trug. Mein Vater prägte mir früh ein, daß wir Freiherrn des alten Reichs seien. Wie er selbst bei aller Liebe zu seiner engeren Heimat doch weit über diese hinausgewachsen war, so blieb auch sein Auge nicht an dem gegenwärtigen Reich haften, sondern er bekannte sich zum Ganzen der deutschen Geschichte und deren Zusammenhang mit der europäischen Geschichte. Gerade in dieser Hinsicht öffnete er mir historische Horizonte, die, einmal mit Bewußtsein erblickt, nie wieder verlorengehen konnten.
Mein Vater hatte spät geheiratet. Nicht mehr jung als Vater seiner Kinder, selbst ernst veranlagt, kam er uns zumeist auf ernsten Gebieten nahe. Ganz anders geartet war meine Mutter. Bedeutend jünger als er, wirkte sie stets noch viel jugendlicher als ihre Jahre. Es lag das äußerlich an der sehr großen Regelmäßigkeit der berühmten Wedeischen Züge, die — wie jede wirkliche Form — dem Wandel wenig unterworfen schien. Es lag aber auch an ihrer inneren Jugendlichkeit. Zu der Unerschöpflichkeit ihrer mütterlichen Liebe kam die Unerschöpflichkeit ihrer künstlerischen Anlagen, durch die sie uns entzückte und verwöhnte. Wie ihre sämtlichen Geschwister besaß sie von dem* genialen Erbe der würzburgischen Mutter her ein ungewöhnliches, zeichnerisches und malerisches Talent, das sie in ihren Mädchenjahren ausgebildet hatte, und das sie als Frau und Mutter in tausend kleinen Künsten verströmte und verstrahlte, die unsern Haushalt mit Anmut und unsere Kindheit mit Phantasie beschenkten. Alles, was durch ihre Hände ging, nahm einen ganz bestimmten persönlichen Reiz an. Sie besaß außerdem viel Humor. Wie oft versicherte man mir lange noch nach ihrem Tode, daß man mit niemand so gut habe lachen können wie mit ihr. Ihrem Humor entsprach eine große Vorliebe für Reuter, den sie glänzend vorlas. Es entsprach ihm allerdings auch — als Kontrast — eine eigentümliche Schwermut, in die sie zeitweilig versinken konnte, die aber eigentlich nicht wesensgemäß zu ihr gehörte, sondern mehr durch äußere Umstände, wie einen Wechsel des Wohnsitzes, hervorgerufen wurde. Zu bodenständig, um solche Veränderung leicht zu ertragen, fühlte sie dann oft lange Zeit ein uns alle bedrückendes Heimweh nach dem verlassenen Ort. Meine Mutter blieb eben im Grunde immer die Landedelfrau, zu der sie geboren war: sie blieb es in ihrem unüberwindlichen Drang zu ländlich großen Vorräten. Sie blieb es in ihrer Zuneigung zu einfachen Leuten und in der prachtvollen Art, mit ihnen umzugehen. Sie blieb es in der Art, Arme zu beschenken, die eigentlich immer ihre Mittel überstieg, hierinnen einig mit dem Vater, dem das gleiche Bedürfnis innewohnte. Als verabschiedeter Offizier versagte er sich jahrelang das Reitpferd, um einem verarmten Verwandten hilfreich zu sein. Meine Eltern mußten stets rechnen,aber es gab in ihrem Haus keine Verehrung des Geldes.
So verschieden meine Eltern auch waren, so begegneten sie einander doch sehr stark in ihren Neigungen. Beide lehnten eine große, laute und kostspielige Gesellschaft ab, wir lebten immer so still, wie es die Umstände irgend gestatteten. Denn meine Eltern gehörten zu jenen, die ganz für ihre Kinder lebten, die aber auch ihre Kinder für sich beanspruchten: mein Vater ging mit dem Wunsch, die Erziehung selbst in den Händen zu halten, so weit, daß er, wenigstens für seine beiden Töchter, die Schule lange ablehnte. Seinen Sohn allerdings gab er früh in das Kadettenkorps. Diese Unabhängigkeit von der Schule bedeutete natürlich ein sehr großes Maß von Freiheit, Sorglosigkeit und Ferien. Wir waren zuweilen monatelang auf dem Lande. Da rutschte man die Strohmieten herunter, da saß man beim Einfahren oben auf dem Heuwagen, man wurde nach altem Schnitterbrauch während der Roggenernte „gebunden“, man half junge Enten hüten und die Habichte vertreiben, man fütterte. Fohlen und Hirsche, man fuhr mit dem Ponywagen durch die meilenweite Monotonie der Kiefernwälder, über deren Lichtungen sich die Teppiche der blühenden Erika breiteten. Man fuhr zuweilen auch mit dem Wagen tief in die Müritz hinein, die weithin flach, wie das Meer zur Ebbezeit, im Mittagsdunst verschwand, scheinbar uferlos wie jenes. Am Ende der Allee lag das alte weißschimmernde Herrenhaus, wo im Innern die vielen schönen Stutzuhren tickten, bei derem sanften Schlag die Zeit nicht, wie an andern Orten, zu eilen, sondern Atem zu schöpfen schien.
Mein Vater, den ich früh verlor, konnte, um seiner Überzeugungen willen, schroff und heftig werden, es war nicht leicht, seine Verzeihung zu finden, wenn man ihn erzürnt hatte. Er wäre aber niemals zu einer Ungerechtigkeit fähig gewesen, auch nicht, wenn es sich um die Abwehr eines Gegners handelte. Ehrfurcht vor dem Gegner gehörte für ihn zur Selbstachtung. Und er besaß Gegner, wie jeder aufrechte Mensch. Die Unbeugsamkeit seiner Grundsätze war ihm, wie ich später erfahren sollte, zuweilen im Leben hinderlich gewesen, sogar in seiner beruflichen Laufbahn — hier zeigte sich das uralte Erbe der Familie, die eher auf einen Erfolg verzichtete als auf ihre Überzeugung. Auf dieser Unbeugsamkeit der Gesinnung beruhte aber auch der unauslöschliche Eindruck, den die Persönlichkeit meines Vaters hinterließ. Die Kantsche Philosophie war die Voraussetzung für die religiöse Haltung meines Vaters. Die große heroische Tradition der Familie bedeutet für ihn in erster Linie die unbedingte Pflicht, zu seiner Überzeugung zu stehen. In diesem Sinn nannte er seinen einzigen Sohn nach jenem Le Fort, der um seines Glaubens willen auswanderte. Eine starke kirchliche Bindung besaß mein Vater nicht, aber er besaß ein hohes Maß der Ehrfurcht vor dem religiös Gewordenen, er besaß die religiöse Reife zur Bejahung der überkommenen Form: so weit ich zurückzudenken vermag, nahm mein Vater stets am Kirchgang und am Abendmahl teil, er hielt bei seinen Kindern auf das Tischgebet. Die eigentliche religiöse Seele unseres Hauses war die Mutter. Ihre Frömmigkeit ruhte durch und durch auf Erfahrung, sie war sehr unmittelbar, zart und verschwiegen. Salbungsvolle Reden liebte meine Mutter nicht, sie mokierte sich darüber. Wenn man auf ihre fleißigen Kirchgänge anspielte, sagte sie, sie wolle doch nicht bei ihrem Begräbnis „erleben“, daß ihr der Pastor eine schlechte Note gebe. — Die Bibel meiner Mutter ist voll am Rande vermerkter Daten, die den Trost und die Kraft bezeugen, die sie bei den verschiedensten Anlässen ihres Lebens in der Heiligen Schrift suchte und fand. Neben der Bibel gehörten unzertrennlich zu ihr die „Lesungen der Brüdergemeinde“, die sie täglich las, die „Nachfolge Christi“ und der „Liederschatz“, eine alte Sammlung evangelischer Kirchengesänge. Dieser „Liederschatz“ war ihre besondere religiöse Gabe an uns. Die täglichen Morgenandachten, die sie mit ihren Kindern hielt, bestanden nicht aus langen Betrachtungen, sondern aus der Vorlesung eines dieser kraftvoll-schönen Lieder. In der großen Liebe meiner Mutter für das ewangelische Kirchenlied vereinigte sich ihre Frömmigkeit mit ihrem ausgesprochenen Sinn für Poesie überhaupt. Ich habe niemand gekannt, der so viele Gedichte auswendig wußte wie sie. Wenn wir den „Liederschatz“ nicht zur Hand hatten, sprach sie seinen Inhalt aus dem Gedächtnis. Einen besonderen Platz in ihrem Herzen nahm das Lied ein: „Befiehl du deine Wege.“ Mit ihm bezwang sie die schwersten Stunden ihres Lebens bis in das Dunkel ihrer letzten Jahre, der schweren Kriegsjahre.
Mein Vater lebte damals nicht mehr, aber er hatte uns noch in seine Heimat zurückgeleitet: die letzte der vielen Gartenerinnerungen meiner Jugend verliert sich unter den unzähligen Lindenbäumen der kleinen mecklenburgischen Sommerresidenz Ludwigslust. Die Kriegsjahre brachten wir auf dem Gut an der Müritz zu, das nach dem Tod der beiden unverheirateten Onkel auf meinen Bruder übergegangen war. Hier kostete meine Mutter die letzte große Freude ihres Lebens, wieder ganz auf der Scholle beheimatet zu sein. Hier kostete sie aber auch die Sorge um den im Felde stehenden Sohn bis zur Neige. Unvergeßlich gehört zu ihrem Bilde dieser bangen Tage der Spruch Paul Gerhardts:
Alles Ding währt seine Zeit,
Gottes Lieb in Ewigkeit.
Dieser Spruch bedeutet das tiefste religiöse Vermächtnis meiner Mutter: die Offenbarung der in Ewigkeit währenden Gottesliebe war ihr Christus. Im Glauben an ihn, dessen Name ihr Mund mich zuerst sprechen lehrte, liegt die einheitliche Linie meines eigenen religiösen Lebens, das, wie vielleicht durch meine Bücher bekannt ist, später seine Heimat in der katholischen Kirche fand. Es liegt darinnen die unlösbare Verbindung mit dem christlichen Geist meines Elternhauses und der großen religiös betonten Tradition meiner Familie.
Meine Mutter starb wenige Tage nach dem Zusammenbruch des ersten Weltkrieges. Mit ihrem Leben verlosch das Leben einer ganzen Epoche. Heute ist das alte Haus am Müritzsee schmerzliche Vergangenheit geworden, ein fremdgewordenes Land umgibt die Einsamkeit des elterlichen Grabes. Doch die Welt des Herzens wird von allen diesen Stürmen kaum berührt: das Elternhaus bedeutet für mich keine wehmütig-süße Erinnerung, sondern lebendige Gegenwart. Es gehört zur Tragik des Lebens, daß wir die unendlichen Verpflichtungen gegen unsere Eltern meistens erst spät in ihrer vollen Bedeutung erkennen, es gehört aber auch zur Tiefe dieses Lebens, daß wir sie erkennen, je reifer wir werden. Zuletzt dankt alles, was wir selbst zu geben meinten, nur der Pflege ihrer treuen Hände und auch unser Eigenstes wird ihr Geschenk.
Aus: „Die Krone der Frau“, im Verlag der Arche, Zürich.