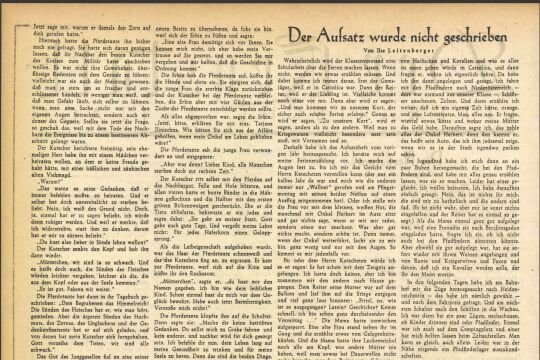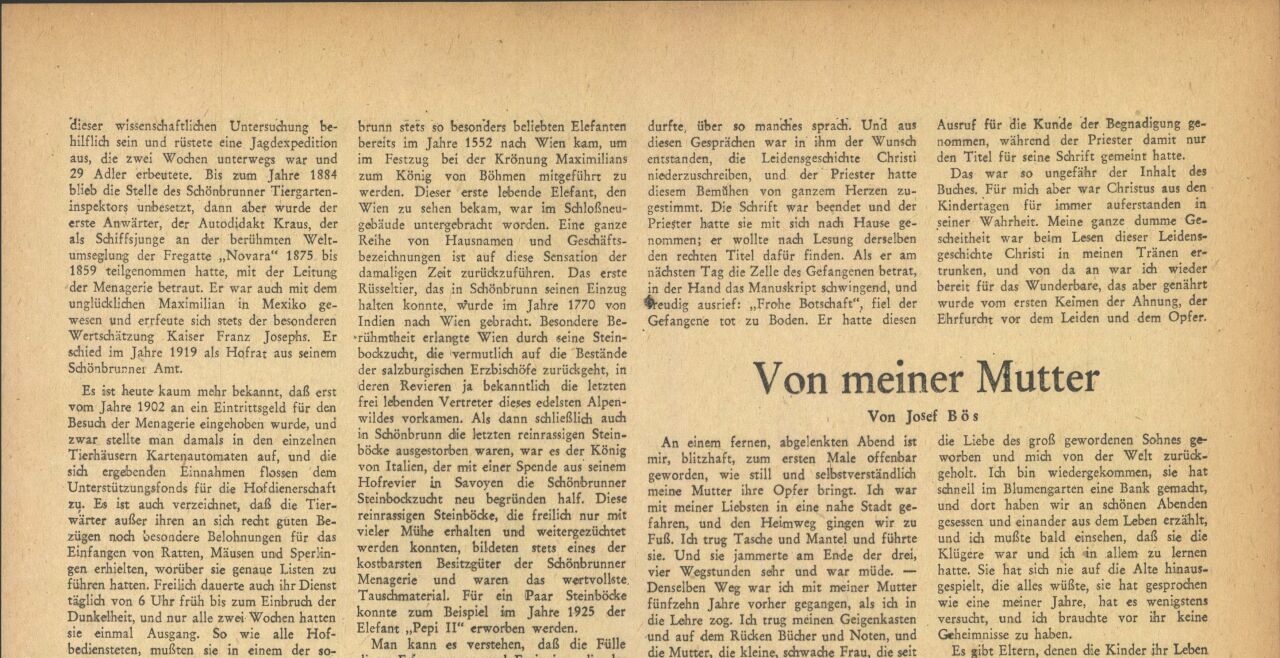
Von meiner Mutter
Josef Bös über Hingebung, Armut und das Vertrauen zwischen Mutter und Sohn.
Josef Bös über Hingebung, Armut und das Vertrauen zwischen Mutter und Sohn.
An einem fernen, abgelenkten Abend ist mir, blitzhaft, zum ersten Male offenbar geworden, wie still und selbstverständlich meine Mutter ihre Opfer bringt. Ich war mit meiner Liebsten in eine nahe Stadt gefahren, und den Heimweg gingen wir zu Fuß. Ich trug Tasche und Mantel und führte sie. Und sie jammerte am Ende der drei, vier Wegstunden sehr und war müde. — Denselben Weg war ich mit meiner Mutter fünfzehn Jahre vorher gegangen, als ich in die Lehre zog. Ida trug meinen Geigenkasten und auf dem Rücken Bücher und Noten, und die Mutter, die kleine, schwache Frau, die seit ihrer Jugend Schmerzen in den Beinen hat, trug Betten und Kleider und hatte sicher schwer. Wir gingen über den „schwarzen Berg” und sie klagte nicht; wenn wir ruhten, gab sie mir gute Lehren und weinte dazu und sagte nicht warum. So hat sie es ihr ganzes Leben gemacht, ist für mich über schwarze Berge gegangen, hat schwer getragen und viel geweint dazu.
Wir mußten damals zu Fuß gehen, Vaters Lohn reichte nicht weit, die Eltern sparten mehr als andere, weil sie nicht Schulden machen wollten; „zweimal langt’s nie”, sagten sie, und ein „Büchel” gab’s- nicht.
Als ich zur Welt kam, soll Mutter sehr gelitten haben, und dann war ich drei Jahre krank und sie betete mich dem Himmel ab. Schon im ersten Krieg mußte sie hamstern, wollte sie uns gesund erhalten; also hamsterte sie und holte fünfundzwanzig Kilo Rüben auf dem Rücken von Goldenfluß, das ist über zwei Stunden und geht über sieben Berge.
Und alles das und vieles andere hatte ich vergessen. Zwischen fünfzehn und zwanzig, wenn man sich von der Eltern Lebensart entfernt, sich klüger dünkt, weil man mehr und neuere Bücher gelesen, selbständig wird und das Kostgeld verdient, in jenen Jahren der zweiten Menschwerdung kommt eine Entfremdung zwischen Eltern und Kinder. Man will sich nichts mehr sagen lassen, wird schroff, und die Alten kriechen entweder eingeschüchtert in ihr Haus zurück oder es wird gestritten.
Meine Mutter zog es vor, still zu sein; nicht böse, nicht trotzig, nur still. Und dann hat sie das große Kunststück getroffen, das nicht alle, können, hat ohne Vorwurf gewartet, mein neues Leben zu ergründen gesucht, und sie, die aller Liebe wert, hat ängstlich und scheu und immerwährend um die Liebe des groß gewordenen Sohnes geworben und mich von der Welt zurückgeholt. Ich bin wiedergekommen, sie hat schnell im Blumengarten eine Bank gemacht, und dort haben wir an schönen Abenden gesessen und einander aus dem Leben erzählt, und ich mußte bald einsehen, daß sie die Klügere war und ich in allem zu lernen hatte. Sie hat sich nie auf die Alte hinausgespielt, die alles wüßte, sie hat gesprochen wie eine meiner Jahre, hat es wenigstens versucht, und ich brauchte vor ihr keine Geheimnisse zu haben.
Es gibt Eltern, denen die Kinder ihr Leben lang das Beste verschweigen müssen. Die nie einsehen, daß ein Sohn, eine Tochter ein anderer, eigener Mensch werden will und muß, die nicht wissen, daß die Welt in dreißig Lebensjahren neue Wege baut, die nur die alten Maßstäbe haben und nicht vergeben, wenn am Kinde ein Zug nicht nach ihrem Ebenbilde ist. Die keine Sünde verzeihen, auch die nicht, die sie selbst einmal gemacht, an die sie sich nicht mehr erinnern wollen. So gehen gute Kinder mit übervollem Herzen an guten Eltern schweigend vorbei und beiden wird bitter schwer. Sie brauchen einander und können den Weg nicht finden.
Ich konnte meiner Mutter auch einen Liebesbrief vorlesen, und sie lächelte fein und rühmte mir dann den oder jenen Satz und wurde warm dabei. Und dann ertappte ich sie, wie sie im geheimen schon ein Weihnachtsgeschenk (im September) für meine Liebste vorbereitete, eine blaugepunkte Schürze und eine Schachtel süßes Zeug.
Im Grunde bin ich der Ansicht, daß reiche Leute nicht glücklicher sind als arme. Aber wenn ich das Leben meiner Eltern bedenke, komme ich immer wieder in Zweifel. Sie hatten keine Plage als die Armut und manchmal eine Krankheit, aber die Plage der Armut war groß. Sie haben sich der Armut nicht geschämt, sie haben auch oft gewußt, daß ihre Arbeit mehr als das wert war, was sie bekamen. Mein Vater war nie in politischen Versammlungen. Das war vielleicht nicht richtig und nicht klug. Er ist ein stiller Mensch, der große Säle scheut — er hat sich nur viel geschunden.
Auch Mutter hat viel arbeiten müssen. Ich habe es ihr oft angesehen, wie schwer es ihr fiel, wenn sie an trüben Abenden beim vielleicht auch nicht nur mit Ofenbehaglichkeit zusammen, wenn Erwachsene und ältere Leute sich zum Weihnachtsfest Schnee wünschen, sie wissen es nur nicht zu erklären, daß in diesem naiven Wunsch etwas von dem in ihnen weiterlebt, was sie in ihrer Kindheit als das Wunderbare erlebt haben.
Aber wir wachsen aus den Kinderjahren heraus und werden leider älter und gescheiter, und auf dieses Gescheiterwerden müssen wir uns natürlich etwas einbilden; der Schnee schmilzt eben und die Erde kommt dunkel unter ihm hervor, und so mannigfaltig ist ihr Sprossen und Fruchten. Wir werden keck und wollen nicht mehr alles glauben, wollen wissen. Und als ich das vierzehnte Jahr erreicht hatte, da half auch mir nichts, auch ich mußte gescheiter werden, und es begegnete mir in den Gesprächen der Großen und in Büchern so manches, was mich sehr beeindruckte, so daß mir das, was ich in der Biblischen Geschichte so gläubig aufgenommen, nicht mehr recht stimmen wollte, weil ich die Tiefe dieser hohen Wahrheiten ja noch nicht anders denn als Märchen empfangen hatte. In diesem Alter fragt man nicht die Großen, und leider kommen ihrerseits die Großen nicht mit Fragen entgegen, so ist man allein für sich mit allen neuen Fragen, und die Gefahr, immer gescheiter zu werden, ist groß.
Zu meinem Glück fiel mir, als ich fünfzehn Jahre alt geworden, ein Buch in die Hand, es war von Peter Rosegger und hieß „Frohe Botschaft”. In diesem Buch wird von einem jungen politischen Gefangenen erzählt, der zum Tod verurteilt war und in der Zeit seiner Haft und des Hoffens auf Begnadigung, im tiefsten seines jungen Lebens erschüttert, mit dem Priester, der ihn besuchen
Fenster Knopflöcher umnähte oder am Samstag vor dem Feste noch spät den Fußboden wusch. Ich habe ihr dann immer geraten: „Ach, Mutter, mach doch Feierabend, du verdirbst dir die Augen”, und mich im stillen gewundert, warum sie das nicht einsehen wollte. Heute weiß ich, daß solche Ratschläge an arme Leute nichts wert sind, wenn man nicht das Geld dazulegt, das die trüben Stunden am Fenster bringen. Ich sehe ein, daß Mutter am Heiligen Abend erst nach sieben ruhen durfte, weil sie an den Abenden vorher, wenn ich schlief, mein blaues Sammetgewand, nähen mußte und dadurch in ihren Arbeiten zurückblieb.
Und sie hat sich die guten Augen verdorben, sie kann nicht mehr ohne Brille „Leberecht Hühnchen” lesen, aber sie kann noch auf den Grund meines Wesens sehen, und da entdeckt sie mit tiefer Sorge, daß ich nicht mehr so bin, wie sie mich gewollt hat, nicht so gläubig wie sie, nicht so ehrlich in Gedanken, Worten und Werken. So sind wir jahrelang in leisen Streit gekommen, bis ich es aufgegeben habe und — indessen — mich im stillen zurücksehne zum festen Vertrauen in die Güte und Allmacht über uns und zur vorbehaltlosen Redlichkeit, wie sie die Mutter hat.
Nur in einem Punkt konnte ich sie in Verlegenheit bringen. Ihr Gottvertrauen hat sie niemals sorglos machen können. Mit vierzig hat sie schon Geld zurückgelegt und Dinge auf den Dachboden getragen für die „alten Tage”, und immer war ihr Streben darauf gerichtet, sich selbst zu erhalten. Sie hat nicht um Brot für das Alter gebetet, sondern um Kraft, sich dieses Brot immer verdienen zu können. Sie hat nicht an Pensionen geglaubt und nicht daran, daß man durch Versicherungspolizzen das Schicksal überlisten könnte.
Neben ihrer Sorge und Arbeit um mich, die nie aufhörte und ohne die ich nicht wäre, erscheint es kaum besonderer Erwähnung wert, daß sie mich auch zwei- oder dreimal aus Todesgefahr errettet. Ich weiß nicht, wieso sie immer noch im letzten Augenblick dazukam, wenn es mir an den Kragen gehen sollte. Es waren doch noch allerhand andere da, die mich lieb hatten: die Großeltern, der Vater, der Nachbar Müller; aber nur die Mutter war da, wenn ich mit dem Kopf im Brunnen stedkte oder von der Bodenstiege fiel. Gerade, während ich fiel, kam sie und fing mich noch auf. Sie saß neben der Wiege, als ich Lungenentzündung hatte, und sie wartete später ebenso besorgt nächtelang, wenn ich so unbegreiflich vom Hause wegblieb.
Nun ist sie siebzig und lebt .in einer dunklen Flüchtlingsbaracke in Bayern, näht noch immer für die Leute und hat recht behalten mit ihren Zweifeln in Pensionen und Versicherungsscheine. Der Vater neben ihr ist siebenundsiebzig und geht Holz machen. Mit zwei Koffern sind sie aus dem Haus gegangen, in dem sie ein langes Leben hindurch allerlei Gut und allerlei Lächerlichkeiten aufgestapelt hatten. Nichts wurde weggeworfen: „Man kann nie wissen, wie es noch kommt auf der Welt.”
Ja, das kann man freilich nie wissen. — „In Gottes Namen denn”, schrieben sie ihrem Sohn in die unerreichbare Fremde und gingen dann selbst auf die bittere Wanderschaft.
Jetzt wäre die Gelegenheit für diesen Sohn gekommen, von seiner Schuldrechnung abzuzahlen. Die in ihrer halben Armut von gestern stolzen Menschen hätten nichts genommen; in ihrer ganzen Armut von heute wären sie, vielleicht, bereit, etwas anzunehmen. Und nun kann dieser Sohn n.dit zu ihnen, und wenn er es könnte — er hat auch leere Hände. Er möchte wohl zahlen und kann wieder nur danken. Diesmal danken dafür, daß Mutter ihm in frühen Jahren die Armut tragen gelehrt. Schier meinte er, in vorübergehender Wohlhabenheit diese hohe Kunst vergessen zu haben, und beglückt merkt er, daß die Wissenschaften des Vaterhauses unverlierbar sind; unverlierbarer selbst als das Haus aus Holz und Stein.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!