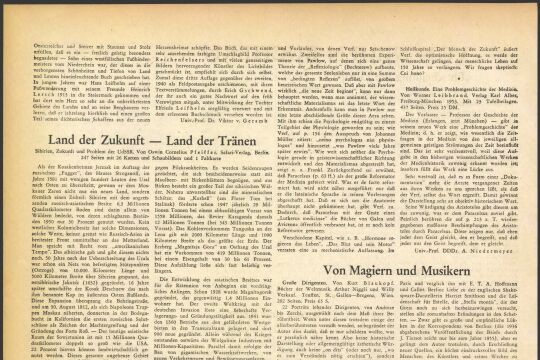"Markant wie ungewöhnlich"
Am 8. März gedenkt die Musikwelt des 150. Todestages von Hector Berlioz. Ob man ihn und sein Schaffen nach diesem Jahr anders sehen wird?
Am 8. März gedenkt die Musikwelt des 150. Todestages von Hector Berlioz. Ob man ihn und sein Schaffen nach diesem Jahr anders sehen wird?
"Welche der beiden Mächte kann den Menschen in die höchsten Sphären erheben, die Liebe oder die Musik? ... Das ist eine schwere Frage. Dennoch könnte man sie vielleicht so beantworten: Die Liebe kann keine Vorstellung von der Musik vermitteln, wohl aber kann die Musik eine von der Liebe vermitteln ... Warum auch die eine von der anderen trennen? Sie sind die beiden Flügel der Seele", schreibt Hector Berlioz im Schlusskapitel seiner erst in der jüngeren Vergangenheit neu edierten "Memoires", die tiefen Aufschluss über seine Persönlichkeit und sein musikalisches Denken geben.
Liebe und Musik, das führt zum bis heute weltweit populärsten Werk dieses Komponisten: zu seiner 1830 in Paris entstandenen, von seiner Leidenschaft zur irischen Shakespeare-Darstellerin Harriet Smithson, die er drei Jahre später heiratete, inspirierten "Symphonie fantastique" - die Programmsymphonie schlechthin. Zugleich ein Bespiel, was Berlioz unter einer dramatischen Symphonie verstand. Sie ist "noch immer dieses fiebrig erregte Meisterwerk romantischen Feuers, bei dem man sich wundert, dass die Musik so übersteigerte Seelenzustände wiedergeben kann, ohne außer Atem zu geraten, das ist aufwühlend wie der Kampf der Elemente", zeigte sich Claude Debussy 1912 von diesem Werk begeistert.
Aber ist Berlioz ein französischer Komponist, gar der bedeutendste nach Couperin und Rameau? Dem wollte Debussy, wie er anlässlich eines Interviews 1904 betonte, nicht zustimmen. "Berlioz ist ein Ausnahmefall, ein Monstrum, er ist überhaupt kein Musiker; er gibt mit Verfahren, die der Literatur und der Malerei entlehnt sind, die Illusion von Musik. Übrigens sehe ich wenig ausgesprochen Französisches an ihm. Der musikalische Genius Frankreichs, das ist so etwas wie die Phantasie der Empfindlichkeit", lautete sein Befund.
Im Spiegel der Nachwelt
Seine Schwierigkeit mit Berlioz hatte auch Peter Iljitsch Tschaikowski, wie man einer seiner Kritiken aus 1873 entnehmen kann. Er attestierte seinem französischen Komponistenkollegen zwar "in der Geschichte der Kunst eine ebenso markante wie außergewöhnliche Erscheinung zu sein", zeigte sich aber ebenso "fest davon überzeugt, dass seine Musik niemals in die Massen eindringen wird in dem Sinne, wie die Musik Mozarts, Beethovens, Schuberts, Schumanns, Mendelssohns und Meyerbeers zum Allgemeingut geworden ist und es Wagners Musik ohne Frage in nicht ferner Zukunft werden wird". Aus seiner Sicht dominiere bei Berlioz die "leidenschaftliche dichterische Phantasie über die rein musikalische Invention". Vor allem sei er "durchaus kein Meister in der Kunst der Harmonisierung". "Abstoßend" und "für das Ohr unerträglich" nannte Tschaikowski Berlioz' Harmonik. Berlioz, so sein apodiktisches Resümee, "kann Interesse wecken, vermag aber selten zu ergreifen".
Nichts dagegen ließ Tschaikowski über Berlioz' Instrumentationskunst kommen. Mit seiner 1844 publizierten "Grand traité d'instrumentation et d'orchestration modernes" hat er die bis heute maßstäbliche Instrumentierungslehre verfasst. Als man Richard Strauss Anfang des vorigen Jahrhunderts ersuchte, dieses Werk für eine Neuausgabe zu bearbeiten, konnte er sich auf einige wenige Aktualisierungen beschränken, so umfassend und vorausschauend ist dieses Standardwerk. Alleine damit hätte sich Berlioz seinen Platz in der Musikgeschichte gesichert.
Wie steht es tatsächlich heute um ihn? Wird der vom Pariser Opernchef Philippe Jordan initiierte Berlioz-Schwerpunkt an der Pariser Oper dazu beitragen, nicht nur die Originalität von Berlioz endlich zu erkennen, sondern auch deutlich machen, dass so manches der Urteile speziell über sein Opernschaffen wenn schon nicht überzogen, so zumindest einseitig ist und einer genaueren Überprüfung nicht standhält? Jordan, designierter Wiener Opernchef und Chefdirigent der Wiener Symphoniker, gestaltet in dieser Saison mit seinem Wiener Orchester und anderen Dirigenten im Wiener Musikverein und Konzerthaus auch eine orchestrale Berlioz-Retrospektive. Schon, um darauf hinzuweisen, dass sich die Bedeutung des Symphonikers Berlioz nicht, wie es der Konzertalltag meist darstellt, auf ein oder zwei Werke beschränkt. Das bietet Gelegenheit, sich auch mit der Fortsetzung der "Symphonie fantastique", "Lélio", auseinanderzusetzen, nachzudenken, wie viel Autobiographisches sich hinter der Symphonie für Solobratsche und Orchester "Harold in Italie" verbirgt, die nach den Worten des Komponisten von Niccolò Paganini angeregt worden sein soll, die Ouvertüren näher kennenzulernen oder sich von der dramatischen Kraft seiner großen Chor-Orchesterwerke, wie "Roméo und Julia","Grand Messe de Morts" oder "La damnation de Faust", hinreißen zu lassen. Dass man mit Berlioz Erfolge erzielen kann, hat erst jüngst die Wiener Staatsoper mit ihrer "Les Troyens"-Produktion bewiesen, mit der dieses monumentale Werk im Haus am Ring erstmals in vollständiger Gestalt zu hören war. Über Wien, wo er als Dirigent gastierte, schreibt Berlioz übrigens auch kenntnisreich in seinen "Memoires". Er lobt die Qualität des Musiklebens der Stadt und ereifert sich gleichzeitig, wie wenig man hier von Gluck kennt.
Zu jenen, die Hector Berlioz als Dirigent erlebt haben, gehört auch Charles Hallé, Gründer des nach ihm benannten englischen Klangkörpers, der konstatierte: "Er war der perfekteste Dirigent, den ich jemals erlebt habe; er verfügte über das absolute Kommando über seine Leute, er spielte mit ihnen wie ein Pianist auf einer Klaviatur." Tatsächlich ist die Berlioz-Verehrung bis heute in Großbritannien am größten. Dirigenten wie Colin Davis oder John Eliot Gardiner haben maßstäbliche Einspielungen von vielen seiner Werke vorgelegt, Gardiner vor einigen Jahren auch Berlioz' wiederentdeckte "Messe solennelle" aus der Taufe gehoben. Der in Kassel beheimatete Bärenreiter Verlag zeichnet für die kritische Gesamtausgabe des Berlioz'schen Œuvres verantwortlich. Damit haben Interpreten Partituren zur Verfügung, die dem letzten Stand der Berlioz-Forschung entsprechen.
Ein Zeitgenosse der Zukunft
Dennoch ist nicht zu übersehen, dass man nach wie vor Berlioz Dinge vorwirft, die man bei späteren Komponisten, beispielsweise Gustav Mahler, als bemerkenswert hervorhebt. Wie "Expressivität des Ausdrucks, ungewöhnliche Instrumentierung, Einbeziehen des Raums, Brüche im musikalischen Verlauf, Zitate und 'Collagen'", wie es einer der führenden Berlioz-Kenner der Gegenwart, der zuletzt in Hamburg lehrende deutsche Musikwissenschaftler Wolfgang Dömling, wiederholt hervorgehoben hat. Ob sich nach diesem eben erst begonnenen Berlioz-Jahr die Sicht auf ihn und sein Werk ändern wird? Ob man endlich zur Kenntnis nimmt, dass auch für Berlioz längst gelten sollte, was Mahler für sich in Anspruch genommen und letztlich durch die Rezeption in den letzten Jahrzehnten auch erfüllt bekommen hat: ein Zeitgenosse der Zukunft zu sein? Wie brachte es doch Camille Saint-Saëns auf den Punkt: "Mit all seinen Bizarrerien ist er wundervoll. Er ist es, dem meine ganze Generation ihre Formung verdankt, und ich wage zu sagen, sie ist gut geformt worden."