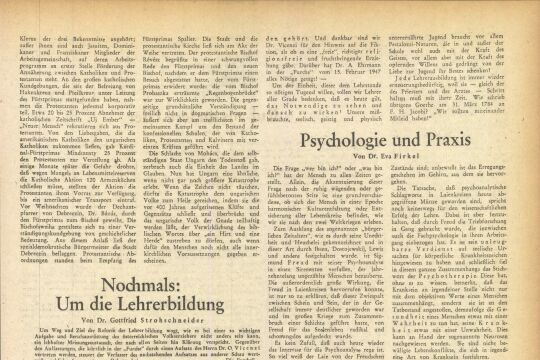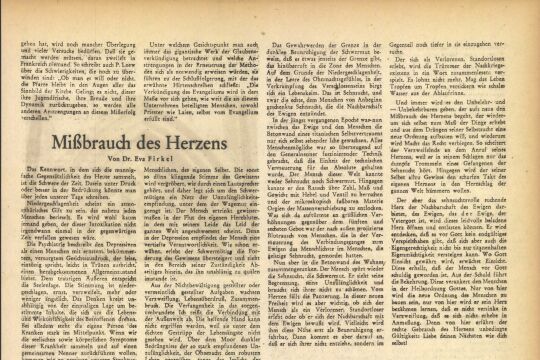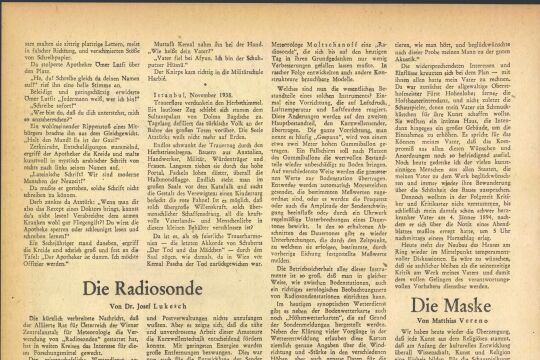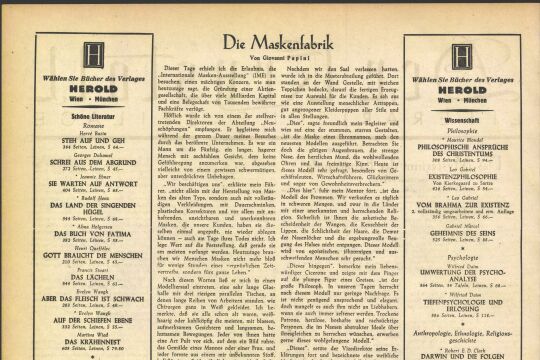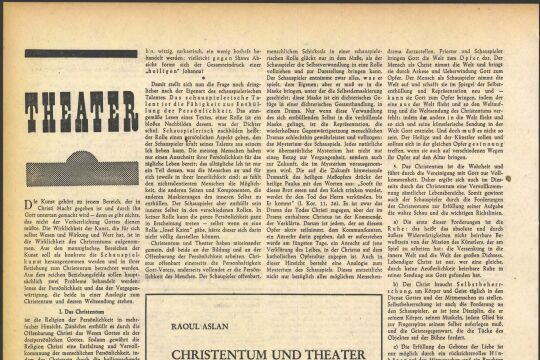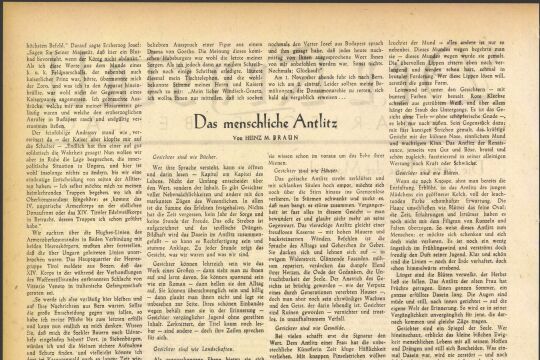Maske: Das Antlitz unserer Zeit
Das neue distanzierte Miteinander wird unsere gewohnte Art der Kommunikation vielleicht nachhaltig verändern. Ein Essay über Gesicht und Maske.
Das neue distanzierte Miteinander wird unsere gewohnte Art der Kommunikation vielleicht nachhaltig verändern. Ein Essay über Gesicht und Maske.
Gegenwärtig bietet der Gang durch die Stadt ein (noch) ungewohntes Bild. Damit sei aber nicht auf den verlassen wirkenden, beinahe menschenleeren Stadtraum verwiesen, wo sich zu Ostern eigentlich – wie etwa in Wien durch den Kohlmarkt, am Graben oder vor dem Stephansdom – Heerscharen von Touristen drängeln sollten. Vielmehr sind die vermummten Gestalten gemeint, die einem bei den eher selten gewordenen Gängen auf den Straßen begegnen und, wenn man unvorhergesehen ihren Weg kreuzt, ohne je ein entschuldigendes Lächeln erkennen zu können, erschrocken ein, zwei Schritte zur Seite springen.
Auch im Spiegelbild, das uns aus dem Schaufenster entgegentritt, können wir uns als uns selbst kaum erkennen, denn das gesellschaftliche Miteinander ist, wie die Selbstbegegnung auch, zu einem Mummenschanz, buchstäblich zu einem „Maskenspiel“ des Trägers mit und hinter der Maske geworden. Was im Oktober 2017 als Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz in Kraft trat, ein Verbot, an öffentlichen Orten und in öffentlichen Gebäuden die Gesichtszüge durch Kleidung oder andere Gegenstände in einer Weise zu verbergen beziehungsweise so zu verhüllen, dass sie nicht mehr erkennbar sind, wird nun zwecks Eindämmung der Covid-19-Pandemie empfohlen.
Welch bittere Ironie, dass es gerade der Atem ist, Metapher für das Leben schlechthin, der den Austausch unter den Lebenden behindert. Vielleicht wird die Gesichtsvermummung deswegen fast überschwänglich zum äußeren Zeichen sozialer Rücksichtnahme, der Fürsorge oder, wie die deutsche Kanzlerin sagte, zum Akt der Solidarität zwischen den Generationen erklärt. Es scheint nicht ausgeschlossen, dass sich aus diesem „Defacing“ bald eine neue Gesichtsmode herausbilden wird.
Eingeschränktes Mienenspiel
Wir nehmen die Verhüllung oder Maskierung des individuellen Gesichts mit einem Mundschutz bis unter die Augen zum Anlass, darüber nachzudenken, wie dieses faziale Social Distancing, wie das Rücksichtsgebot genannt werden kann, das Miteinander der Individuen auf der Bühne der Welt konstituiert. Denn das Gesicht, dem eine doppelte Semantik im Wort, als Sicht und Angesicht, eine Wechselseitigkeit des Blicks eingeschrieben ist, ist in unserer Kultur für den zwischenmenschlichen Umgang bedeutsam. Ein Gesicht, dessen Mienenspiel aber nicht gesehen werden kann, verliert nicht nur seine Bedeutung als Gesicht. Das eingeschränkte vis-à-vis, also das behinderte Wechselspiel zwischen Sehen und Angesehenwerden, die Konstellation zwischen dem eigenen Gesicht und dem Antlitz des anderen, verändert möglicherweise auch die Kommunikation.
Das Gesicht ist in unserer westlichen Kultur mehr noch als in ostasiatischen Gesellschaften zum wichtigsten menschlichen Körperteil geworden. Es gilt als Ausdruck individueller Besonderheit, als Spiegel der Seele und auf diese Weise gar als Platzhalter, als Pars pro Toto der menschlichen Person. Es war in seiner langen Geschichte der semiotischen Kulturtechniken und vielfältigen Praktiken schon immer Medium von Identität, Selbstdarstellung, Ausdruck und Kommunikation. Als spezifische Bedeutungsfläche war es zentraler Schauplatz für die Ausbildung gezielter „Gesichtspraktiken“ (Hans Belting), bei der Verfeinerung der Gefühlssprache, zwischen Selbstausdruck, dem Willen, eigene Emotionen zu zeigen, und der Selbstkontrolle, dem Zwang, diese zu regulieren.
Als das Menschlichste am Menschen verstehen wir das Gesicht seither als Aggregat eines affektiven Weltbezugs. Denn – so die gängige Meinung – der mimische Ausdruck modelliert die unauflösbare Einheit von physischen und psychischen Vorgängen. Anders gesagt finden auf ihm die unsichtbaren Ereignisse der Seele ein sichtbares und dechiffrierbares Fortleben. Deswegen gilt das Gesicht auch als Zentrum der zwischenmenschlichen Kommunikation und eben fazialen Bedeutungsgenerierung, wo sich Freude, Trauer, Angst und Zorn auf einfache Weise zeigen.
Die Mimik, als Indiz für den Zusammenhang von Innerem und Äußerem, und sogar das Aussehen des Gesichts versprechen Auskunft zu geben über Absichten, Wesen, Charakter oder auch das Schicksal des anderen. Seit Kant war für die Anthropologie das Gesicht das zentrale Erkennungs- und Identifizierungsmerkmal der Welt- und Menschenkenntnis, bis hin zu rassistischen und kriminalanthropologischen Aus- und Eingrenzungen.
Nicht nur durch die Geschichte wissen wir aber, dass der Widerschein des Inneren auf die Außenseite des Gesichts, also die Lesbarkeit des vermeintlich derart „beredten“ Gesichts, wie auch seine Physiognomie allzu oft von Irrtümern begleitet sind. Die Annahme, es gäbe eine natürliche Entsprechung zwischen innerem Bild und äußerer Erscheinung ist schlechterdings ein Mythos. Johann Joachim Winckelmanns Diktum, wonach sich die Seele der Griechen im „Gesichte des Lao koons“ spiegele, ist ebenso falsch wie die Annahme, im Gesicht sei eine ganze Biografie ablesbar, also wir wüssten viel von einem Menschen, wenn wir ihn nur ansehen. Das hat in der langen Geschichte der Gesichtskunde und Physiognomik seit Johann Caspar Lavater zu mehr als fragwürdigen Pathologisierungen im biederen System der Charakter- und Rassenkunde geführt. Und schließlich können auch die freundlichsten Mienen mitunter die unfreundlichsten Absichten maskieren.
Die „faziale Gesellschaft“
Der fehlenden Garantie der Ähnlichkeit ungeachtet, erfreut sich das Gesicht als Zeichen von Identität, Träger von Ausdruck, Ort der Repräsentation und zentrale Instanz für die Disambiguierung von Botschaften einer anhaltenden Prominenz. Das lässt sich nicht zuletzt an seiner ubiquitären Medienpräsenz ablesen, warum Thomas Macho auch von einer „fazialen Gesellschaft“ spricht.
Keine Sphäre scheint ausgespart, wenn es um faziale Kommunikationsformen geht: angefangen bei jenen sogenannten Fazialimages mit Punkt, Punkt, Komma, Strich, die wir nicht selten unseren SMS-Nachrichten anhängen oder sie durch diese sogar ersetzen, bis hin zu sämtlichen Bereichen in der Medienkultur, wo die Gesichter, ob nun von Stars, Promis oder Sportlern, wie selbstverständlich zu Vorbildern mit Nachahmungseffekten werden. Ganze Casting-Shows oder YouTube-Kanäle beruhen dar auf, dass Gesichter zur Nachahmung vorgegeben werden.
In der Politik lässt sich die Dominanz des Gesichts daran ablesen, dass Images der Politiker die Wahlwerbung beherrschen, nicht nur weil mit dem Gesicht Nähe fetischisiert wird, sondern weil – wie Macho sinngemäß sagt – keine politische Aussage stark genug sei, um ohne Gesicht auszukommen. Überhaupt setzt die Werbung inflationär auf sogenannte Beauty-Shots, auf Großaufnahmen von Gesichtern, weil, wie Valentin Groebner in seiner Studie „Ich-Plakate. Eine Geschichte des Gesichts als Aufmerksamkeitsmaschine“ schreibt, diese Bilder zu uns „sprechen, weil sie ein Gesicht zeigen“. Dass die Gesichter in ihrer medialen Überformung Bilder sind, muss hier vernachlässigt und kann an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt werden.
Allerdings ist der Umstand interessant, dass es sich bei diesen Gesichtern oft nicht um natürliche, sondern um geliftete, künstliche Gesichter handelt. Anders gesagt um Masken. Die Griechen gebrauchten dafür den Begriff prosopon. Das heißt wörtlich „das, was gegenüber den Augen (eines anderen) ist“, weswegen der gleiche Begriff auch für das Gesicht verwendet wurde. Das, was wir als Gegensatzpaar verstehen, das Gesicht zur Maske, wurde bei den Griechen also nicht unterschieden.
Wir verstehen unter einer Maske etwas, was auf das Gesicht gesetzt wird und es verdeckt. Die Maske ist für uns eher Symbol der Verwandlung. Mit ihr erscheint der Mensch wie ein Schauspieler, der, wie der Begründer der philosophischen Anthropologie Helmuth Plessner diese gespaltene persona beschrieben hat, „nach außen in der Figur seiner Rolle und nach innen privat, als er selbst“ sein könne, womit es nicht weit zur zweiten verbreiteten Konnotation der Maske ist, nämlich als Zeichen der Lüge und Täuschung, sofern sie die Person verbirgt. Sie ist der Ort, wo der Mensch ein anderer sein kann.
Gesicht oder Maske?
Allerdings haben sich in der deutschen Sprache auch Redewendungen erhalten, die dem Begriff prosopon für Gesicht und Maske nahekommen: „ein Gesicht haben“ und „ein Gesicht machen“. Das führt uns dazu, dass dem Gesicht wie der Maske ein seltsames Paradox eignet: Beide ermöglichen nämlich, gleichzeitig bei sich und außer sich zu sein, zu zeigen und zu offenbaren, zu verbergen und zu täuschen. Dem Gesicht eignet, weil es als Oberfläche doppeldeutig ist, apriorisch eine gewisse Unschärfe an. Denn ein natürliches Gesicht gibt es nicht.
Sagen wir zum Gesicht nun Gesicht oder Maske? Ein Gesicht haben bedeutet also stets, es auch auf verschiedene, ja gegensätzliche Weise verwenden zu können. Und für uns heißt das heute, wer sein Gesicht verliert, verliert nicht automatisch an Glaubwürdigkeit. Vielleicht lehrt es uns, statt dessen mehr Aufmerksamkeit dem Körperspiel des Gegenübers zu schenken.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!