Ärzte und Patienten sprechen höchst unterschiedliche Sprachen. Wie deren Verständigung gelingen kann, beriet ein Symposium.
Es sind zwei Beispiele von mehreren: Einem Asthmapatienten wird geraten, nach dem Inhalieren von Cortison den Mund auszuspülen, um Pilzbefall vorzubeugen. Frauen erfahren, dass die Kombination von Rauchen und Pille das Risiko von Herzinfarkt und Thrombose erhöht.
Diese Auskünfte bekamen sie nicht von ihren Ärzten, sondern bei Mediziner-Gesprächen von Medien angeboten: "Zu den bedrückendsten Erfahrungen der Patienten zählt kommunikative Not", erzählt der Gesundheitsjournalist Ernst Mauritz.
Medizin und ihr zentrales Objekt - der Mensch - scheinen sich zu voneinander zu entfernen und zu entfremden. Deshalb veranstalteten die Österreichische Ärztekammer und das Europäische Forum Alpbach in Wien das Symposium "Medizin und Ethik" unter der Frage: "Wo steht der Mensch?"
Die Medizin stehe, sagen ihre Anwender, vor großen Herausforderungen: Neue Technologien machen sie schneller, neue Therapien ermöglichen neuen Erfolge, doch daraus ergebe sich die Gefahr einer zu strikten Fokussierung auf den Körper, was den Blick auf den Menschen verstelle. Doch zu den ethischen kommen noch weitere Herausforderungen an die Mediziner.
Ärztinnen und Ärzte sollen einerseits professionell und daher distanziert sein, sie sollen nicht unmittelbar auf Forderungen der Patienten reagieren. Diese wünschen sich andererseits eine persönliche Beziehung und die Anteilnahme von den Ärzten. Das ist nicht der einzige Gegensatz.
Aufgrund ihrer stark unterschiedlichen Rollen sprechen Ärzte und Patienten ein unterschiedliche Sprache. Einige Patienten versuchen sogar, in der Fachsprache der Mediziner zu denken: "Sie begeben sich auf die Befundsprache und richten ihr Wohl danach", erzählt der Palliativmediziner Herbert Watzke bei der Tagung. Ärzte könnten aber die Sprache der Patienten erlernen.
Wie kann Verständigung funktionieren?
"Wenn die Verständigung von Arzt und Patient nicht in beide Richtungen verläuft, gehen viele Bemühungen von Ärzten ins Leere", betont der deutsche Sprachwissenschaftler Konrad Ehlich. Beide, Ärzte und Patienten, hätten unterschiedliche Haltungen, Befürchtungen und Erwartungen.
"Ärzte dürfen keine voreiligen Ratschläge geben oder Grenzen überschreiten", erklärt die Psychoanalytikerin und Medizinerin Marianne Springer-Kremser. Auf die von Patienten häufig gestellt Frage "Was würden Sie an meiner Stelle tun" rät sie, ihnen nicht zu antworten. Mit den Konsequenzen lebe der Patient oder die Patientin.
Diese wünschen sich von ihren Ärzten Klarheit, Prognosen und die Milderung ihres Leids. Davon haben viele sehr konkrete Vorstellungen. Und gerade bei schweren Erkrankungen suchen Menschen nach Erklärungen. Diese können jedoch jenen der Ärzte entgegengesetzt sein und Behandlungen beeinflussen. Dies erlebte Referent Watzke bei einem schwer krebskranken Patienten, dem ein Herzschrittmacher eingesetzt wurde. Wegen der starken Schmerzen wollte der Patient den Schrittmacher wieder entfernen lassen, doch die Befunde zeigten, dass die Schmerzen Folge der Verschlechterung seiner Krebserkrankung waren. Die Ärzte rieten zu einer Bestrahlung, doch der Patient bestand tagelang auf der riskanten Entfernung des Herzschrittmachers.
Die Lehre aus diesem Beispiel? Viele dieser subjektiven Krankheitstheorien ihrer Patienten würden die Ärzte nicht kennen, doch diese Gedanken würden Patienten behindern, Diagnosen anzunehmen und therapeutische Resultate zu erzielen, so Watzke. Die Entscheidung liege bei den Patienten. Ärzte hätten durch ihr Wissen über den Körper zwar eine gewisse Autorität, sollen aber nicht über die Köpfe ihrer Patienten hinweg entscheiden.
Diese Autonomie der Patienten ist ein Schutzrecht der Medizin. Sie ist von unterschiedlichen Werten geprägt. Ein fachlich und ethisch basiertes Handeln führt dazu, dass Partner mit unterschiedlichen Werten zu verantwortungsvollen Entscheidungen finden. Doch Voraussetzung dafür ist eine Verständigung, die gelegentlich misslingt, wie das linguistische Projekt "Schmerz- und Krankheitsdarstellung" der Universität Wien zeigt.
Wissenschaftler analysierten in diesem Projekt ärztliche Beratungsgespräche, so auch eine Konsultation zwischen einem Arzt und einer türkischsprachigen Patientin. Der Mediziner informierte sie intensiv über die Vorteile einer ambulanten und einer stationären Behandlung ihrer Migräne. Die Tochter der Patientin übersetzte das Gespräch, gab die Ausführungen des Arztes aber nur verkürzt wieder.
Es geht um den Menschen
Dieser erkundigte sich zwar nach den Wünschen der Mutter, fragte aber nicht explizit nach, ob sie alles verstanden habe. Es kam zu einem Missverständnis: Er meldete seine Patientin für eine stationäre Behandlung an, zu der die Frau nicht erschien. Die Lehre daraus? Die Untersuchung solcher Fälle zeige, dass Patientinnen mit Migrationshintergrund professioneller Dolmetscher bedürften und generell in die Entscheidungsfindung eingebunden werden sollten, erklärt die Projektmitarbeiterin Marlene Sator.
Dies alles bündelte der Präsident der Ärztekammer, Walter Dorner, in seine Schlussfolgerungen und in einen Appell: Mehrsprachigkeit, gemeinsame Entscheidungen und eine neue Sprache werden eine große Rolle in der Medizin spielen. Diese solle sich rehumanisieren und Patienten dazu aufrufen, Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen. Denn letztendlich gehe es in der Medizin um das Leben des Menschen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!


















































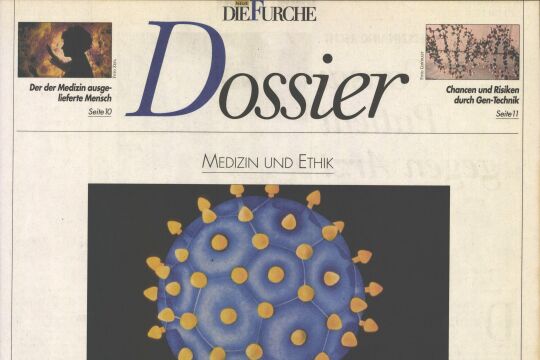


























.png)







.jpg)

