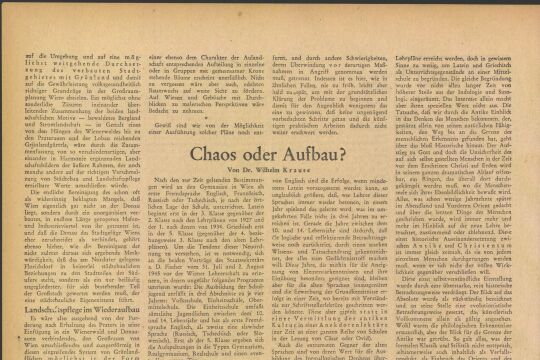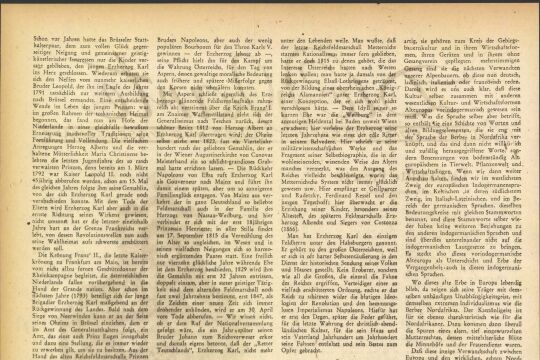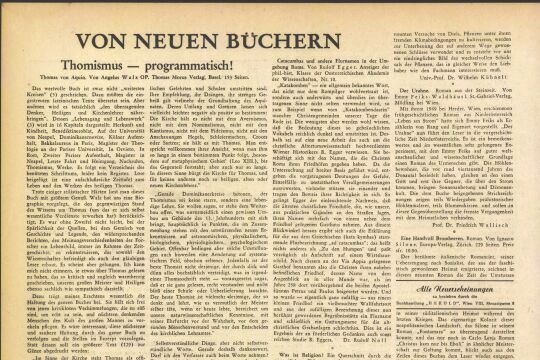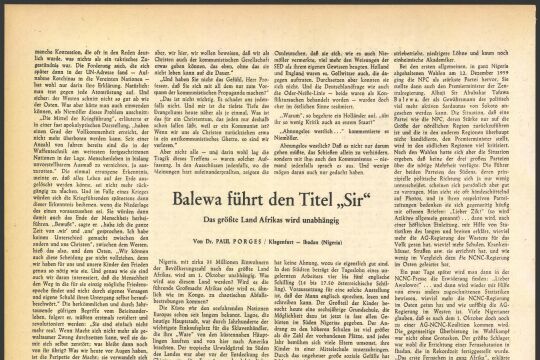Vorige Woche nahm die letzte Bo auf den indischen Andamanen die Sprache Bo mit ins Grab. Die meisten der weltweit 7.000 Sprachen sind vom Aussterben bedroht. Wissenschafter versuchen, das Kulturerbe zu bewahren.
Der alttestamentarische Gott war bekanntlich nicht zimperlich, wenn es um saftige Strafen ging. Eine seiner nachhaltigsten Taten, die „Babylonische Sprachverwirrung“, erlangte auch außerhalb bibelfester Kreise sprichwörtliche Bekanntheit. Demgegenüber wird die Vielfalt der Sprachen heute weitgehend als etwas Positives gesehen. Zwischen 6.000 und 7.000 verschiedene Sprachen sind weltweit bekannt. Tendenz fallend. Denn laufend sterben Sprachen aus. Als tot bezeichnet man eine Sprache, wenn niemand mehr lebt, der sie als Muttersprache gelernt hat. In diesem Sinne starb vor drei Wochen auf den indischen Andaman Inseln das Bo, gemeinsam mit seiner letzten Sprecherin, der 85-jährigen Boa Sr. Etwa 95 Prozent aller Sprachen gelten in unterschiedlichem Ausmaß als gefährdet. Um ein allgemeines Bewusstsein für die Relevanz der Sprachenvielfalt zu schaffen, hat die Generalversammlung der UNESCO im Jahr 2000 erstmals den „Tag der Muttersprache“ ausgerufen. Am 21. Februar wiederholt er sich heuer zum zehnten Mal.
Als gefährdet gilt eine Sprache, wenn Eltern sie nicht mehr an ihre Kinder weitergeben. Oder wenn diese ihr linguistisches Erbe nicht mehr annehmen wollen. Dafür gibt es unterschiedliche Ursachen.
Sprachen ohne Schrift sind labil
In vielen Entwicklungsländern beobachtet man das Sprachsterben in Zusammenhang mit der Urbanisierung. Die Landbevölkerung zieht in die Städte und nimmt dort die dominante Sprache an. Aber auch die Alphabetisierung bildungsferner Schichten führt zum Bedeutungsschwund regionaler Minderheitensprachen. Denn als staatliche Maßnahme findet sie naturgemäß in der Staatssprache statt. Generell sind Sprachen ohne zugehörige Schriftform labiler gegenüber gesellschaftlichen Veränderungen als verschriftlichte. Eine wichtige Rolle kann auch die Religion spielen. So steht die rasante Verbreitung von Hausa und Dyula in Westafrika in engem Zusammenhang mit der Islamisierung dieser Region. Zuweilen schaffen auch Naturkatastrophen Tatsachen. So dezimierte 1998 ein Tsunami an der Nordküste Papua-Neuguineas die Sprechergemeinschaft des Arop-Sissano um fast die Hälfte auf etwa 1150. Aber auch politische Missgunst kann Sprachen (und die mit ihnen verbundenen Kulturen) in Gefahr bringen. Für diesbezügliche Beispiele muss man nicht bis in die Türkei und ihre Unterdrückung des Kurdischen oder Neuaramäischen blicken. Ein zeitgenössisches Mittel der Repression findet sich in Form von Ortstafelverboten auch hierzulande.
„Die Gefährdung einer Sprache hat aber nicht notwendig etwas mit der Anzahl verbliebener Sprecher zu tun“, sagt Ulrike Mosel, Vorstand der deutschen Gesellschaft für bedrohte Sprachen (GBS). So gilt das Niederdeutsche, auch als Plattdeutsch bekannt, trotz seiner acht Millionen Sprecher als bedroht. Demgegenüber zählt das auf den Faröer-Inseln von nur 50.000 Menschen gesprochene Faröisch zu den stabilen Sprachen. Außerhalb Europas korreliert der Gefährdungsgrad einer Sprache aber meist mit der Anzahl ihrer Sprecher.
Sprachen mit wenigen Sprechern
So kennt der UNESCO-Weltatlas bedrohter Sprachen gegenwärtig mehr als 200 Sprachen mit weniger als zehn Sprechern. Nur zwei davon sind in Europa vertreten. Für das chinesische Aqao Gelao etwa weist der Atlas nur mehr fünf Sprecher aus. Für das bolivianische Uru gar nur mehr einen einzigen. Linguisten bemühen sich deshalb, das sprachliche Erbe der Menschheit zu bewahren. Dazu muss man Sprachen gründlich dokumentieren. Also Wörterbücher und Grammatiken erstellen, die Phonetik und Redewendungen erfassen. Moderne Technologien sind dabei eine große Hilfe für die Wissenschaftsgemeinde. So etwa das von der Volkswagenstiftung finanzierte Projekt DoBeS (Dokumentation bedrohter Sprachen). Dabei werden Grammatiken, Vokabellisten und Videoaufzeichnungen von Gesprächen in einer Datenbank dokumentiert. Diese Daten sind Sprachwissenschaftlern weltweit zugänglich und ermöglichen ihnen somit auch par distance die Arbeit an und mit gefährdeten Sprachen.
Oftmals geben Eltern ihre Sprache bewusst nicht an den Nachwuchs weiter. Sie befürchten Nachteile für ihre Kinder in Schule und Berufsleben, wenn diese die tradierte Minderheitssprache lernen. Einer Ansicht, der zahlreiche Untersuchungen widersprechen. So wurde von Linguisten mehrfach auf den Zusammenhang zwischen Mehrsprachigkeit und intellektueller Flexibilität hingewiesen. Eine mehrjährige Studie der Universität Tel Aviv zeigte sogar, dass das Beherrschen mehrerer Idiome den altersbedingten Abbau verlangsamt. Von Laien wird oft ein sozialdarwinistisches Argument zur Verharmlosung des Sprachenschwundes bemüht. Die schwächsten sterben eben aus, so die zynische These. Das gelte für Sprachen nicht anders als für biologische Arten. Davon wollen Linguisten allerdings nichts wissen. Gültig wäre das Argument, wenn Sprachen tatsächlich nur der Kommunikation von Information dienten. Dann wäre es wohl am sinnvollsten, jeder spräche Englisch oder Chinesisch. Doch darüber hinaus reflektieren Sprachen das Weltbild einer Sprechergemeinschaft. Auch Märchen, Mythen und religiöse Riten sind untrennbar mit der Sprache verknüpft, in der sie formuliert sind. Kulturelle Praktiken und Traditionen lassen sich nicht ohne Verlust ihrer Bedeutung in Standardsprachen übersetzen.
Versuche, aussterbende Sprachen zu bewahren, sehen sich mit einer fundamentalen Schwierigkeit konfrontiert. Der Erhalt ist nur möglich, wenn die betroffenen Sprecher das auch wollen.
„Prestige ist eine wichtige Größe bei Minderheitensprachen“, sagt Ulrike Mosel. „Die Sprecher müssen aktiv am Erhalt interessiert sein, ihre Sprache wichtig nehmen.“ Die Linguistin befasst sich mit Teop, einer gefährdeten Sprache auf Bougainville, der östlichsten Insel Papua-Neuguineas.
Teop kennt eine Vielzahl von Wörtern für unterschiedliche Hölzer und deren spezifische Eigenschaften im Kanubau (vergleichbar dem Vokabelreichtum der Inuit für Schnee). Schon heute verstehen die jungen Menschen diese Worte nicht mehr und damit auch nichts mehr vom traditionellen Kanubau. „Das möchte die ältere Bevölkerung ändern“, sagt Mosel. „Die Menschen dort sind sehr daran interessiert, dass ihre Sprache erhalten bleibt.“
Bereits vor einigen Jahren hat Mosel ein Märchenbuch auf Teop geschrieben. Jetzt arbeitet sie an einer modernen Grammatik für die Sprache. Zwar wird sich der Verlust vieler weiterer Sprachen wohl nicht verhindern lassen. Doch bereits der Versuch ihrer Bewahrung zeigt den gebotenen Respekt vor anderen Kulturen und ihren Ausdrucksweisen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!