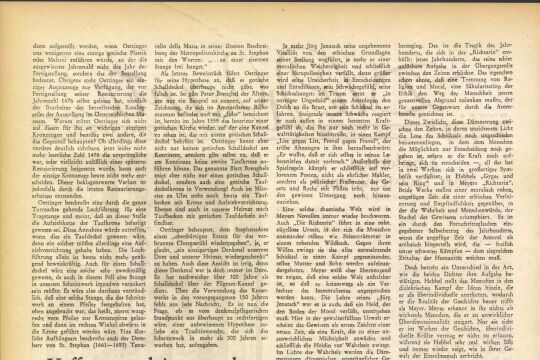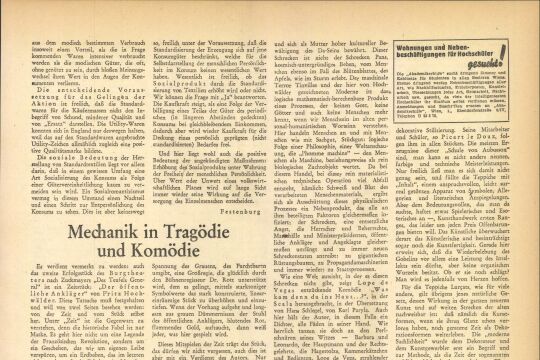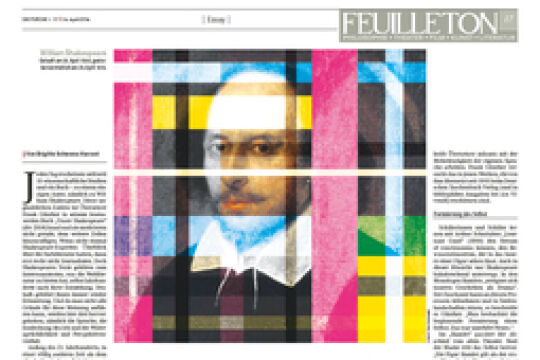Siebeneinhalb Stunden Shakespeare: Stephan Kimmig inszeniert am Burgtheater mit 18 Schauspielern in über 60 Rollen Shakespeares "Rosenkriege".
Von Shakespeares Stücken heißt es, jede Epoche finde das in ihnen, was sie durch ihre eigene Erfahrung darin sucht und finden will. So wollen wir die Frage stellen, mit welchem Interesse sich Stephan Kimmig den gewaltigen Textmassen der drei Teile von Shakespeares wenig gespieltem Heinrich VI. sowie Richard III. angenähert hat. Welche zeitgenössische Lesart schält er aus den zur so genannten York-Tetralogie zusammengefassten Königsdramen heraus? Welche Gründe lassen sich finden, diese Chronik der englischen Herrschaftsgeschichte aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, die den Sturz des Hauses Lancaster und den Aufstieg der Yorks während der "Rosenkriege" gestaltet, heute auf die Bühne zu stemmen?
Wozu "Rosenkriege" heute?
Shakespeares Historien handeln allesamt vom blutigen Kampf um die Macht. Immer wieder geht es um Erwerb, Erhalt und Verlust von Macht oder - wie Jan Kott das genannt hat - um den "großen Mechanismus der Geschichte". Shakespeare versteht diesen Mechanismus auch als einen des menschlichen Herzens: Durch Geltungsdrang, egoistischen Ehrgeiz, Treuebruch, Heuchelei, Habsucht, Intrige und feigen Mord haben Menschen Einfluss auf den Lauf der Geschichte. Einmal in Gang gesetzt, das lehren Shakespeare Königsdramen, entfacht der mörderische Mechanismus Kräfte, denen kaum mehr Einhalt zu gebieten ist. Denn Gewalt entfacht immer neue Gewalt. In "Macbeth", den Kimmig in der nächsten Spielzeit am Burgtheater inszenieren wird, mordet der König, weil er morden muss, getrieben von einem Verlangen nach dem Mord, der den Mordsreigen endlich unterbrechen, der eine Zäsur im Kreislauf des Bösen bedeuten würde. Aber soweit sind wir noch nicht.
Die "Rosenkriege" beginnen im Augenblick eines Machtwechsels. Schon bei der Grablegung Heinrichs V. kommt es zwischen den beiden Adelshäusern der weißen (Haus York) und der roten Rose (Haus Lancaster) zu einem Handgemenge. Martin Zehetgrubers schlichte, ganz mit schwarzen Plastikplanen verhängte Bühne illustriert weniger die Trauer als vielmehr die angebrochene Zeit der Finsternis des drohenden Bruder- und Bürgerkriegs.
Mit Heinrich V. starb nicht nur ein Souverän, der seine Autorität auf das Gottesgnadentum stützen konnte, sondern auch der Garant politischer Ordnung und allgemein akzeptierter Werte - allesamt Schranken, die eine (relativ) humane Welt garantiert haben. Die Lücke, die der Tod hinterlässt, weil der verzärtelte, schöngeistige Thronfolger Heinrich VI. (Philipp Hauß) sie nicht füllen kann, markiert das Moment, in dem jene absolute Freiheit entsteht, die das unmäßige Verlangen der Subjekte nach unbedingter Selbstverwirklichung weckt und ins Mörderische treibt.
"Ich fühl mich mickrig, wenn ich nicht der Höchste bin", bemerkt der bucklige Richard (Nicholas Ofczarek). Die Freiheit gebiert die Tyrannei der Möglichkeiten. Ofczarek spielt Richard III. als ein sich absolut setzendes Individuum mit unendlichem Begehren nach absoluter Freiheit. Eine pathologische Figur, monströs durch die unbegreifliche Entwertung seines moralischen Bewusstseins, ein Dreckskerl, dem alles, was Nicht-Ich ist, als Feind erscheint.
Was in den nächsten sieben Stunden in 45 Szenen geschieht, ist ein einziges Schlachten. Mord folgt auf Mord, wobei das Sterben mal ironisch, mal genussvoll grausam zelebriert wird, aber immer irgendwie komisch wirkt und quer steht zu den ernsteren Tönen. Der Stilist Kimmig erweist sich hier einmal als wenig stilsicher. Den französischen Hof mit seinen Manierismen zeigt er als Parodie auf Karl Lagerfeld. Nur selten gelingen ihm Bilder, die über das im Text Gesagte hinausgehen. Etwa wenn der schwache König Heinrich VI., von der Welt abgekehrt am Bühnenrand sitzend, seinen idealistischen Träumereien nachhängt und hinten in einer Art Gewächshaus ein kunstvoll choreografiertes Gemetzel im Gange ist. Oder im Richard-Teil: die Bühne ist ganz in Weiß gehalten, Emblem der klirrenden Kälte dieser despotischen Welt, auf dem Boden fein säuberlich gereiht Plastikeinwegflaschen, Sinnbild für das auswechselbare Volk, um die die Herrschenden einmal sorgsam herumtänzeln, um dann wieder berserkerhaft zerstörend dreinzufahren. Kollateralschäden im Kampf der Mächtigen?
Eine despotische Welt
Am Ende des Blutrausches singt der Chor der Universität Wien Beethovens "Ode an die Freude", wo es heißt: "Alle Menschen werden Brüder." Ist das Zynismus oder naives Sendungsbewusstsein? Es ist nicht klar, was Kimmig will; er deutet nicht, er zeigt. Nur was? Dass die Welt eine ist, in der egoistisches Handeln einschließlich Mord Schicksal, ja Zwang ist, der aus uns selbst kommt? Dass die Mechanik willkürlicher Herrschaft einhergeht mit dem Verlust moralischer Schranken und universeller Werte oder auch umgekehrt? Wer will, kann unsere Gegenwart darin gespiegelt sehen. Zwingend ist das allerdings nicht.