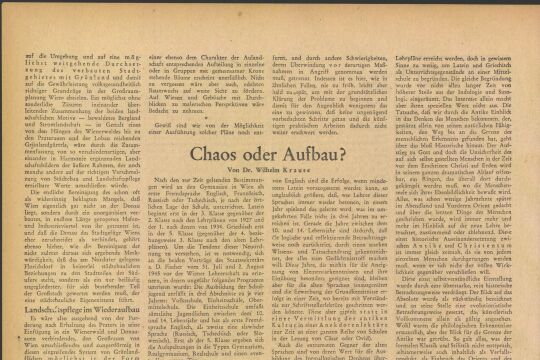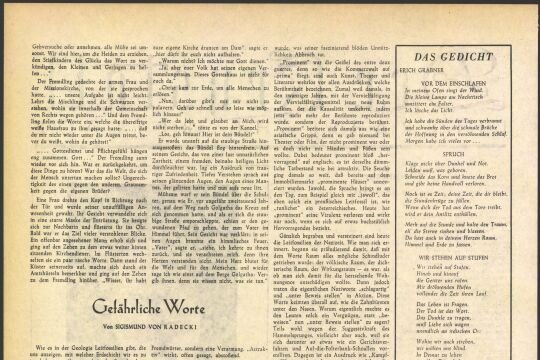Dialekte - sprachliche Dinosaurier, Gemütsrefugien oder kommunikative Ressource?
Als ich mit 14 Jahren vom abgelegenen Bauerndorf im Salzkammergut nach Linz ins Gymnasium kam, wurde mir das offenkundig "Hinterwäldlerische" meiner Existenz überdeutlich signalisiert: Der Deutschprofessor lachte schallend, als er in meiner "hochdeutschen" Aussprache entschiedene dialektale Färbungen festzustellen vermeinte. Ich war tief gekränkt und fühlte mich als "persona non grata" einer verständnislosen Umgebung ausgesetzt, aber ich fügte mich - zumindest sprachlich - und versuchte etwa die inkriminierten maximalen Diphthonge (Zwielaute) ai und au meiner Heimat zu vermeiden und durch die wienerisch inspirierten Fast-Monophthonge des Deutschlehrers zu ersetzen: Aus dem Ischlerischen wa-it, weit' und ha-us, Haus' wurde so wäed und håos. Was ich damals nur ahnte, weiß ich heute mit Sicherheit - dass ich nämlich damit lediglich eine regionale Färbung der gesprochenen Hochsprache durch eine andere regionale Färbung mit offenbar höherem Prestige ersetzt hatte.
Vollwertige Sprachen?
Die Haltung des Deutschlehrers spiegelt jene Einstellung wider, die lange Zeit gang und gäbe war: Dialekte seien zwar vielleicht ganz putzig und bei Folklore-Abenden unvermeidlich, aber genau genommen doch recht unnütz und sollten tunlichst vermieden werden. "Schön sprechen" - darauf kam es an. Der Dialekt wurde als "restringierter Code" mit "wenig komplexen" sprachlichen Strukturen desavouiert, zugeschnitten auf die schlichte kognitive Ausstattung seiner Benutzer. "Kompensatorischer" Sprachunterricht wurde den rückständigen Dialektkindern verordnet. Viele Eltern, die selber durchaus veritable Dialektsprecher waren, bemühten sich (und bemühen sich nach wie vor), mit ihren Kindern "schön" zu sprechen - denn diese sollten es doch nicht zuletzt auch sprachlich besser haben!
Aus heutiger sprachwissenschaftlicher Sicht sind diese vorurteilsbehafteten Vorstellungen nachhaltig zu revidieren: Dialekte sind - linguistisch gesehen - vollwertige Sprachen; es lässt sich mit ihnen alles sagen, was sprachlich ausgedrückt werden soll. Die "Hochsprache" ist nur eine Sprachvarietät des Deutschen neben vielen anderen - allerdings eine mit normativem Charakter und schriftlicher Tradition. Klar ist: Unterschiedliche Dialekte oder Sprachen sind nicht jeweils "besser" oder "schlechter", sondern schlicht und einfach "anders". Es kommt nicht darauf an, Hochsprache und Dialekte gegeneinander auszuspielen, sondern in ihren anders gearteten kommunikativen Funktionen und Wertigkeiten zu begreifen und zu nützen. Die "innere" Mehrsprachigkeit sollte das Ziel aller Sprach(förder)bemühungen sein - der situationsabhängige und dem dialogischen Gegenüber angemessene Einsatz unterschiedlicher Sprachvarietäten, das Spiel auf den vielen sprachlichen Registern zwischen Dialekt und Hochsprache.
Wozu Dialekt sprechen?
Aus dem Alten Testament ist uns jene denkwürdige Geschichte überliefert, in der die beiden verfeindeten Stämme der Gileaditen und der Efraimiten sich am Jordan gegenüberlagen. Wenn nun ein Flüchtling zu den Gileaditen kam und die Furt über den Jordan passieren wollte, prüften sie, ob er zu ihnen oder zu den Feinden gehöre. Dazu bedienten sie sich eines ebenso einfachen wie wirksamen Mittels: Er musste das Wort Schibboleth aussprechen. Sagte er nun stattdessen Sibboleth - denn die Efraimiten konnten dieses Wort nur in dieser Weise aussprechen -, dann, so überliefert uns das Buch der Richter (12, 5-6), "erschlugen sie ihn an den Jordanfurten".
Diese Geschichte macht in recht drastischer Weise darauf aufmerksam, dass wir die Sprache nicht nur zur Übermittlung von Gedanken und Meinungen benützen: Wenn wir uns mit jemandem unterhalten, erfahren wir nicht nur, was er uns sagen möchte, sondern wir erfahren auch etwas über ihn selbst, ohne dass er uns das ausdrücklich mitteilt. Wir schließen aus der Art und Weise, wie etwas gesagt wird, auf die Persönlichkeit des Sprechers, auf seine regionale und soziale Herkunft und Zugehörigkeit.
Die Sprache fungiert also als Symbol - als Ausdruck personaler, regionaler und sozialer Identität, als Ausdruck der Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe und der Verankerung in einem sozialen Netzwerk. Und genau hier ist auch die Funktion des Dialekts auszumachen: Er ist die Sprache des Alltags, des engeren lokalen oder regionalen Umfeldes, des familiären und freundschaftlich-vertrauten Umgangs - er ist die "Sprache der Nähe". Dies setzt ihn in einen funktionalen Gegensatz zur Hochsprache als "Sprache der Distanz", der öffentlich-formellen Rede, der weiträumigen Kommunikation.
Dialekte - gibt's die noch?
Häufig wird der Niedergang des "ursprünglichen", "unverfälschten" Dialektes beklagt - fast alle jüngeren Sprecher würden nur mehr "Mischformen", sprachliche Sammelsurien aus allen möglichen Sprachvarietäten, aber keinen "echten" Dialekt mehr sprechen. So richtig natürlich die Beobachtung ist, dass - verglichen mit der Sprechweise der ältesten Generation - die jüngeren Dialektsprecher vielfach die kleinsträumig gebundenen grundmundartlichen Wörter und Formen nicht mehr verwenden und zum Teil auch nicht mehr kennen, so wenig berechtigt ist es dennoch, die heutigen Dialektvarietäten abzuwerten. In ihnen offenbart sich nur besonders deutlich, was immer schon zu beobachten war: Dialekte sind (wie Sprachen überhaupt) nichts Homogenes, Einheitliches. Auch im kleinsten Dorf finden wir unterschiedliche Ausprägungen der "ortsüblichen" Sprache, und sogar ein einzelner Sprecher wechselt oftmals zwischen verschiedenen Formen.
All dies sind Anzeichen der stetigen Veränderung, die alle natürlichen Sprachen auszeichnet: Sie sind "passgenau" auf den täglichen Umgang zugeschnitten und spiegeln getreu die Veränderung der Lebenswelten wider - Sprachen ändern sich, weil sich die Sprecher ändern. Besonders augenfällig wird dies etwa am Beispiel einzelner Wörter - während einige "unmodern" werden und verschwinden, werden andere neu aufgenommen oder besonders häufig verwendet (denken wir nur an den rasanten Wechsel der Begrüßungsformeln: Wer hätte noch vor wenigen Jahren vorauszusagen gewagt, dass sich in kurzer Zeit auch hiesige Bäuerinnen auf dem Dorf mit hallo begrüßen oder mit tschüss verabschieden würden?). Genauso passiert dies auch mit einzelnen sprachlichen Lautungen und Formen - und natürlich mit dem Gebrauch des Dialekts überhaupt.
Dialekte schützen?
Bemerkenswert und erklärungsbedürftig bleibt dennoch, dass ausnahmslos zu allen Zeiten sprachliche Veränderungen als "Verfall" interpretiert wurden. Ganze Generationen von Sprach- und Kulturkritikern haben sinngemäß immer das gleiche moniert: Die Sprache (wie überhaupt die gesamte Kultur) befinde sich in einem beklagenswerten Zustand, sei von Verwilderung und Verrohung bedroht und müsse deshalb gepflegt und geschützt werden.
Dabei wird übersehen, dass jede Veränderung zwangsläufig als Abweichung vom bisher Üblichen beginnt und so lange als "Fehler" sanktioniert wird, bis sie sich durchgesetzt hat und zur neuen Norm geworden ist. Insofern sind auch die Veränderungen im Dialekt gelassen hinzunehmen: Die Sprecher sind nicht mehr ausschließlich kleinräumig gebunden und orientieren sich nicht mehr allein an den Vorstellungen der "Ortsgesellschaft". Gegen diese gesellschaftliche Realität vermag sich kein sprachpflegerischer, den Dialekt in seiner ursprünglichen Form bewahren wollender Einsatz erfolgreich zu stemmen.
Wird also der Dialekt letzten Endes doch verloren gehen? Nein, gewiss nicht: Auch wenn kleinräumige und archaische Formen verschwinden, so treten an ihre Stelle doch neue Formen, die funktional genau so wie die alten wiederum auf die regionale und soziale Verankerung des Sprechers verweisen. Was sich also ändert, ist die kleinräumige Gebundenheit der Merkmale, nicht jedoch die Funktion des Dialekts als regionales und soziales Symbol - dies wird sich nicht ändern, so lange es Sprecher mit regionaler und sozialer Identität gibt.
Der Autor ist Professor für
germanistische Sprachwissenschaft
an der Universität Salzburg.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!