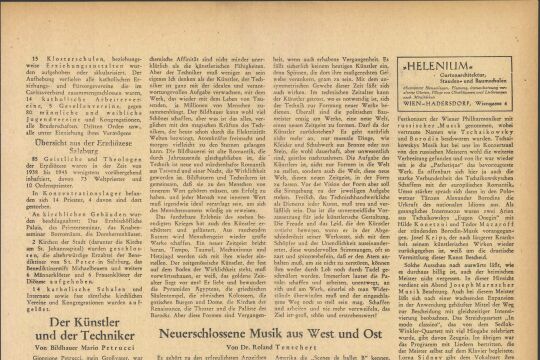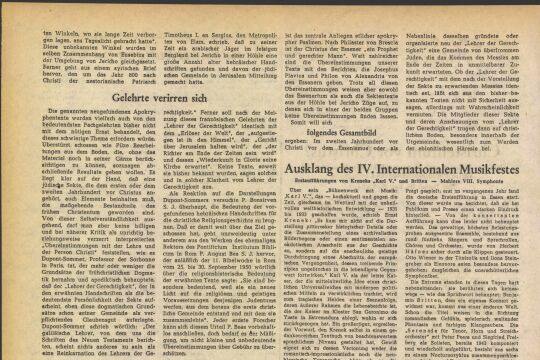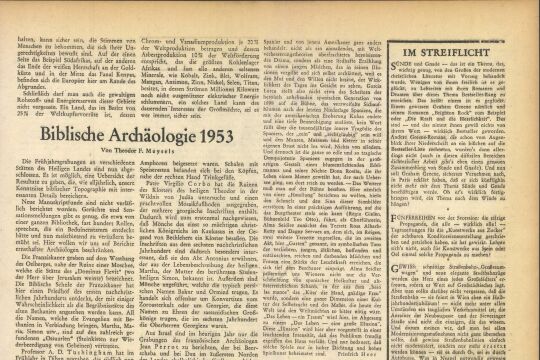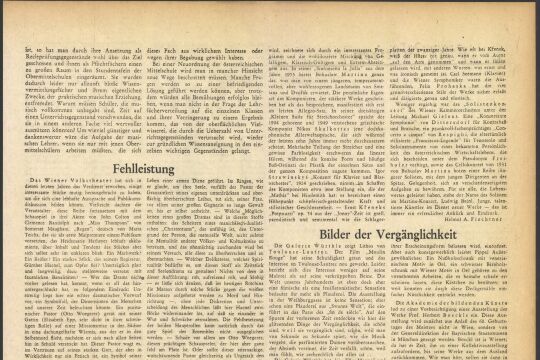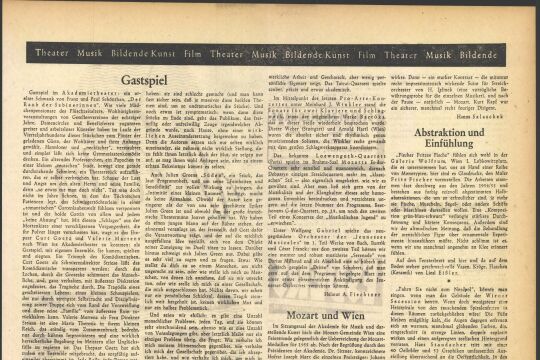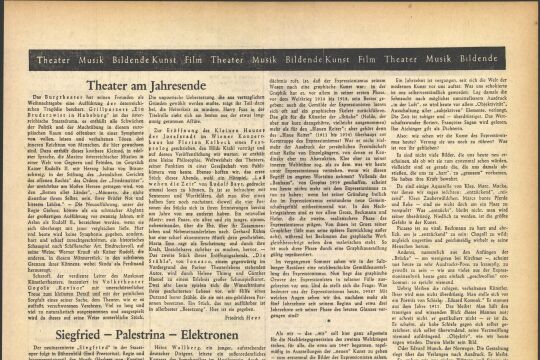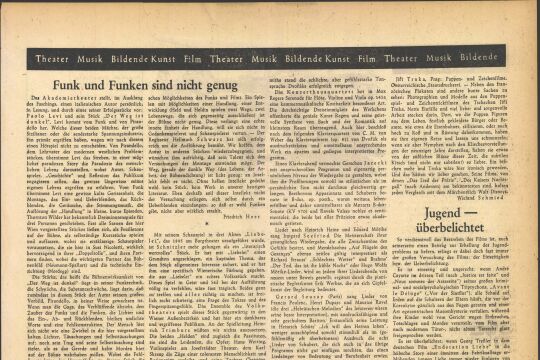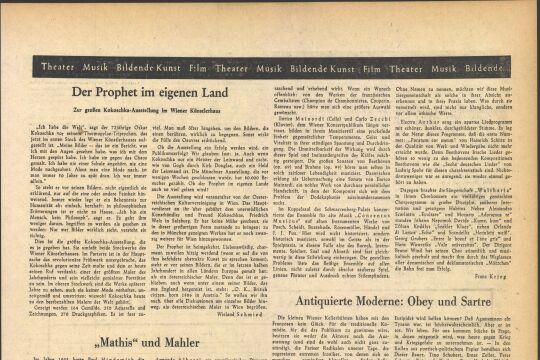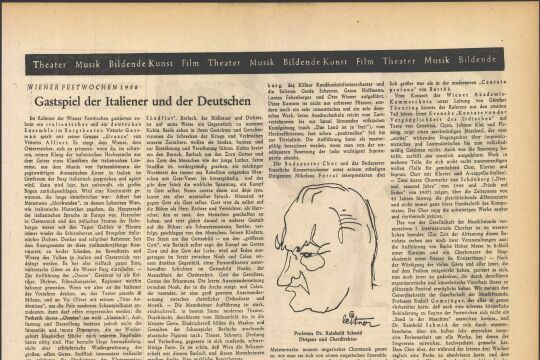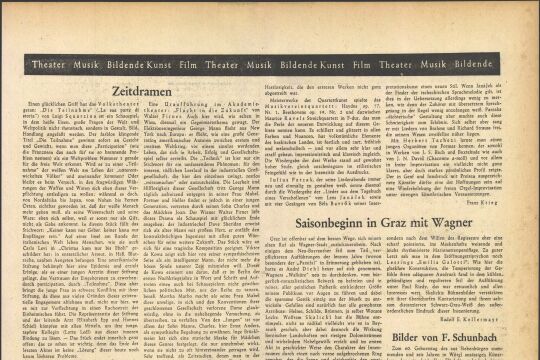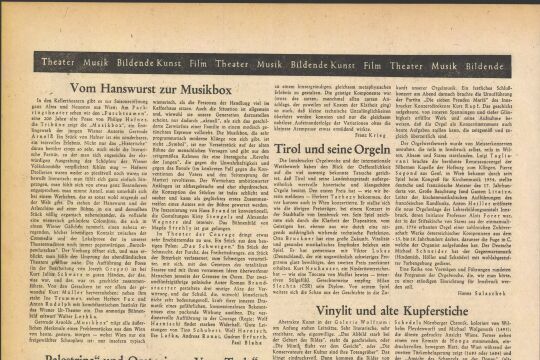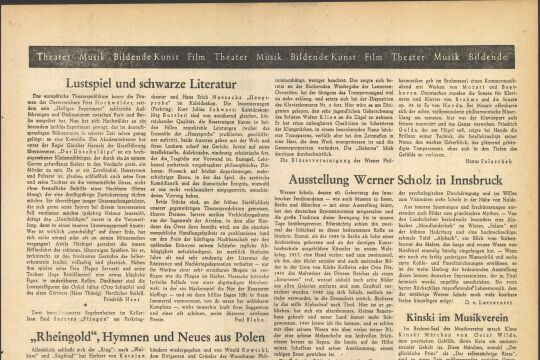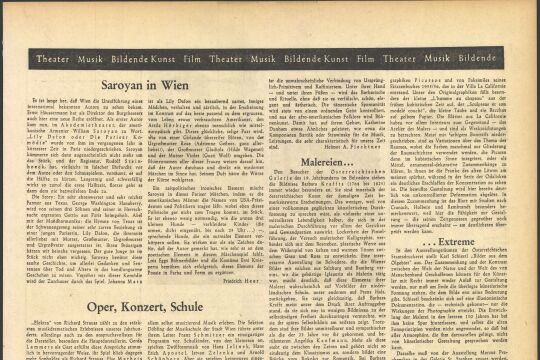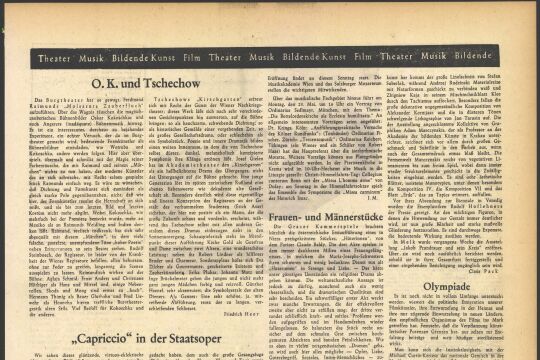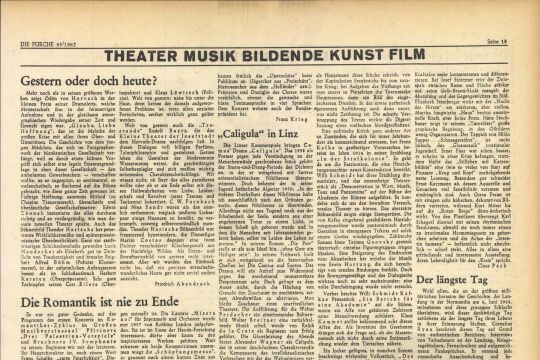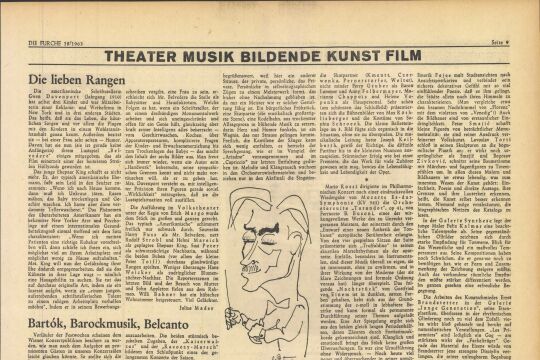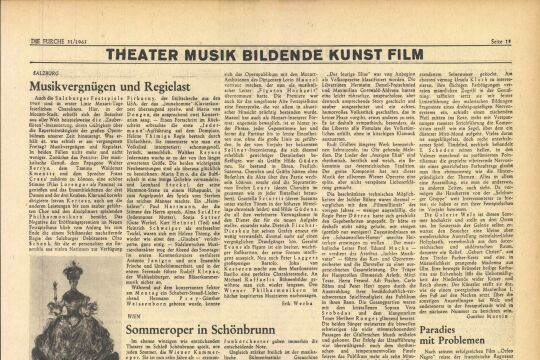Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
„Wildschütz“, „Karl V.“ und die Leningrader
In einer Neuinszenierung von Adolf Rott ging „Der Wildschütz“ von Gustav Albert L o r t z i n g über die Bretter der Staatsoper. Das bürgerliche Singspiel (das es seiner Natur nach ist), hüpfte wie seine Noten munter dahin zwischen den Einfällen einer ebenso munteren Regie und lustigen Bühnenbildern, die im ersten Akt aus Fallerschen Bausätzen (den Nachfolgern des Anker-Steinbaukastens) bestanden, im zweiten ein Zimmer im Schloß mit einem Billard und vielen Türen und im dritten eine Parkperspektive zeigten. Die Hauptfigur, der Schulmeister Baculus, wurde von Karl D ö n c h weit über die komische Rolle hinaus ins Tragikomische gestaltet, sie sprengte fast den Rahmen ihrer Umgebung, sie paßte als einzige ins große Haus am Ring. Renate Holm wurde ihrem „Gretchen“ stimmlich und auch darstellerisch gerecht. Es ist eine Volksopern-, wenn nicht eine Operettenfigur. Irmgard Seefried, Hilde Rössel-Majdan (letztere in unnachahmlicher Komik, die des Psychologischen nicht entbehrte), meisterten ihre Rollen singend und spielend, Anny Felbermayer konnte zur Farblosigkeit ihres „Kammermädchens“ wenig hinzutun. Georg Völker als Graf und Waldemar Kmennt als Baron waren gute Erscheinungen, blieben aber an Wirkung hinter den Damen zurück. Ausgezeichnet hingegen Peter Klein als Haushofmeister. Die Kostüme waren wie die Musik: nett, munter, ohne aufzufallen. Das Orchester spielte gleichsam mit Schmunzeln, der Dirigent Heinz W a 11 b e r g bemühte sich mit Erfolg, Chöre und Tänze im nötigen leichten Tempo zu halten. Bleibt nur die Frage: Warum spielt man diese richtige Volks oper in der Staats oper, deren Preise sich das Volk kaum leisten kann und in deren Rahmen es wenig paßt? Vermutlich würde selbst Lortzing sich zwar höflich bedankt, aber doch den Kopf geschüttelt haben. F. K.
„Der Wildschütz“ in der Staatsoper. Und nicht hier, im Großen Haus am Ring, für welches das Werk — auf Bestellung von Clemens Krauß, dem damaligen Leiter — geschrieben wurde, sondern im Großen Sendesaal des österreichischen Rundfunks: „Karl V.“ von Ernst K r e n e k. — Wir haben auf das bedeutende Bühnenwerk an dieser Stelle wiederholt hingewiesen, zuletzt auf der dem Komponisten Krenek gewidmeten Sonderseite der 37. Folge der „Furche“, die wir nachzulesen bitten. Die Aufführung am vergangenen Sonntagabend im vollbesetzten Konzertsaal in der Argentinierstraße unter der Leitung des Komponisten (Spielleitung Dr. Hans Sachs, Dialogregie Otto Ambros) war nicht nur eine Großtat des Österreichischen Rundfunks (Studio Wien), sondern zugleich auch eine Rehabilitierung dieser Oper. Gewiß: Text und Musik sind anspruchsvoll und schwierig, aber beide sagen etwas aus und sind reich an dramatischen Steigerungen und Höhepunkten. Und die technischen Schwierigkeiten sind durchaus zu meistern: die konzertante Aufführung wurde innerhalb von vierzehn Tagen einstudiert und ließ kaum einen Wunsch offen. Insgesamt 36 Solisten waren aufgeboten, von denen wenigstens einige hervorgehoben seien: Otto Wiener in der Titelrolle, Peter Weihs als Beichtvater Karls V., Juan de Regia, Valerie Bäk als Eleonore, des Kaisers Schwester, und Marie-Therese Escribano als Isabella, seine Gattin. Der Komponist, der die Aufführung selbst leitete, und alle Ausführenden wurden minutenlang gefeiert. Es gab ein gutes halbes Dutzend „Vorhänge“ — leider, wie gesagt, nicht in der Staatsoper.
Am Tag vorher gastierten im Großen Musikverein die Leningrader Philharmoniker unter Eugen M r a w i n s k i, die wir bereits vor drei Jahren in Wien kennenlernten: ein Spitzenorchester, das als Interpret russischer Musik (auf dem Programm standen die 5. Symphonie von Schostako-witsch und die „Fünfte“ von Tschai-k o w s k y) überhaupt nicht zu schlagen ist. Zur vollkommenen technischen Durchbildung der einzelnen Instrumentalgruppen und des ganzen Ensembles kommt eine zuweilen bestürzende, atemraubende Intensität des Vortrags. Wollte man von den Besten die Allerbesten hervorheben, so wäre es vielleicht die Gruppe der Kontrabassisten, von denen jeder ein Virtuose seines Instruments ist. Langanhaltender Beifall und zwei Zugaben.
Das 1. Abonnementkonzert des Orchesters der Wiener Kulturgesellschaft, das aus Laien, Dilettanten im ursprünglichen Sinn des Wortes, besteht, leitete Rudolf H a n z 1, ausgezeichneter Fagottist und ehemaliger Vorstand der Wiener Philharmoniker. Für die Interpretation von Händeis „W a s s e r m u s i k“, der M i I i t ä r s y m-p h o n i e von Joseph H a y d n und der Italienischen Symphonie von Mendelssohn brachte der Dirigent die Musikkultur seines Stammorchesters mit. Hinzu gesellt sich eine elegante dirigentische Erscheinung und ein Temperament, das — beim Musizieren jedenfalls — zum Brio neigt. So kam es, daß das wohlstudierte Orchester in den raschen Ecksätzen der Mendelssohn-Symphonie stellenweise etwas überfordert war. Auch hat sich Rudolf Hanzl vielleicht zuviel den 1. Violinen gewidmet, die freilich den schwersten Strang zu ziehen hatten. Den Freunden der Wiener Kulturgesellschaft haben die Darbietungen ihres Orchesters im gutbesuchten Großen Musikvereinssaal sowie die Leistung des Dirigenten gut gefallen, desgleichen dem Kritiker.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!