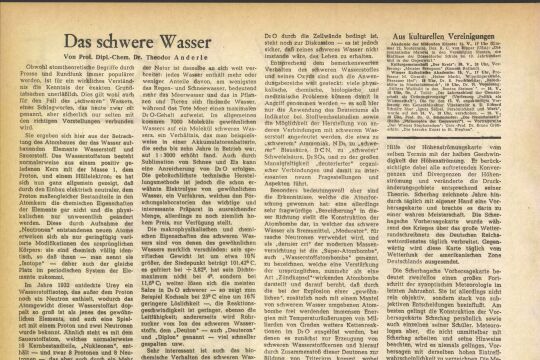Die Kernfusion könnte eines Tages alle irdischen Energieprobleme lösen. In Frankreich wird dafür ein Reaktor der Superlative errichtet.
Laut Mythologie versuchte Prometheus, den Göttern das Feuer abzutrotzen. Die Strafe dafür war drastisch. Doch von Mythen lassen sich Wissenschaftler nicht abschrecken. Zu verlockend ist die Aussicht, Energie in nahezu unbegrenztem Ausmaß nutzen zu können. Jede Sekunde verbrennt die Sonne Millionen Tonnen Wasserstoff zu Helium. Die dabei freigesetzte Energie gelangt als Strahlung ins All. Das Prinzip des Sonnenfeuers in irdischen Dimensionen zu kopieren ist leider alles andere als trivial. Versuchen will man es trotzdem. Dieser Tage beginnen im französischen Ort Cadarache die Bauarbeiten für eine der komplexesten technischen Anlagen, die menschlicher Forschergeist jemals erdacht hat.
Der Fusionsreaktor ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), passenderweise das lateinische Vokabel für „Weg“, ist ein internationales Gemeinschaftsprojekt. Neben den europäischen Euratom-Staaten sind Russland, Südkorea, China, Japan, Indien und die USA beteiligt. Nach jahrelangen Verhandlungen konnte Europa den Standortzuschlag für sich verbuchen. Im Gegenzug übernimmt Europa 45,5 Prozent der Gesamtkosten von zehn Milliarden Euro.
Hauptort des Geschehens ist die reifenförmige Vakuum-Reaktorkammer von ITER. In ihr werden die Wasserstoff-Isotope Deuterium und Tritium zu Helium fusionieren. Bei dieser Reaktion bleibt jeweils ein Neutron übrig, das gegen die Reaktorwand prallt. Durch das Neutronen-Bombardement heizt sich eine Kühlflüssigkeit in der Wand auf. Über Wärmetauscher wird dann Dampf erzeugt, der wie in herkömmlichen thermischen Kraftwerken Turbinen und Generatoren antreibt. Aufgrund ihrer hohen Masse findet die Fusionsreaktion im Inneren der Sonne bereits bei einer Temperatur von etwa zehn Millionen Grad statt. In ITER muss der Brennstoff dagegen mehr als zehn Mal so hoch erhitzt werden, ehe sich etwas tut. Bei dieser Temperatur lösen sich die Elektronen von ihren Atomkernen und das Wasserstoffgemisch verwandelt sich zu Plasma. Als Heizung fungieren Mikrowellen, sowie ein zentraler Transformator. Außerdem will man elektrisch neutrale Teilchen in die Kammer schießen. Durch Kollisionen mit dem Brennstoff tragen sie ebenfalls zum gewünschten Temperaturanstieg bei. Weil Plasma elektrisch leitend ist, kann es durch Magnetfelder eingeschlossen und so von der Wand getrennt werden. Die dafür nötigen Spulen sind mit rund 40 Prozent die teuerste Komponente der Anlage.
ITER soll erstmals beweisen, dass ein Fusionsreaktor mehr Leistung liefern kann, als für den Betrieb hineingesteckt werden muss. Bestehende Forschungsanlagen wie JET in England oder ASDEX Upgrade in München sind dafür zu klein. Ein Projekt dieser Größenordnung hat naturgemäß einen großzügigen Zeitplan. Demnach soll die Anlage 2018 einsatzbereit sein. Dann werden erst einmal plasmaphysikalische Experimente durchgeführt. Acht Jahre später ist die erste Fusion vorgesehen.
Hauptproblem wird sein, das Plasma lange genug heiß zu halten. Bereits ein geringer Temperaturabfall bringt die Fusion zum Stoppen. Hält ITER, was sich die Entwickler von ihm versprechen, soll in den frühen 2030er Jahren ein Demonstrationsreaktor gebaut werden, der dann erstmals Strom erzeugt. Läuft alles glatt, könnte eine Dekade später das erste Fusionskraftwerk Strom ins öffentliche Netz liefern. Kritische Stimmen gibt es dennoch. Wäre es nicht viel sinnvoller, die Milliarden zum Ausbau bereits vorhandener Technologien zu verwenden, lautet die Frage. Zum Beispiel für Photovoltaik, Windkraft und Geothermie?
Konkurrenz der Energiequellen
„Ich halte nichts davon, Energiequellen gegeneinander auszuspielen. Wir werden alle benötigen.“, sagt Harald Weber, Leiter der Assoziation Euratom-ÖAW, die die österreichischen Forschungsbeiträge zu ITER koordiniert.
Unter seiner Leitung haben beispielsweise Wissenschaftler des Atominstituts der TU Wien ein neuartiges Isoliermaterial für die supraleitenden Magnetspulen entwickelt. Die Mischung aus Epoxidharz und Cyanatester hält der Strahlenbelastung problemlos stand. „Auch zum Design wesentlicher Bauteile haben wir maßgeblich beigetragen“ betont Weber. Welche Unternehmen welche Bauteile für ITER liefern werden, ist jedoch noch ungewiss.
Insider erwarten, dass das zuständige Gremium im Juni die endgültigen technischen Spezifikationen für ITER absegnen wird. Dann könnten die ersten Ausschreibungen beginnen. Als österreichischer Fixstarter gilt Plansee. Das Tiroler Unternehmen entwickelt seit zehn Jahren Materialien für den so genannten Divertor. Diese Komponente wird einerseits das Abfallprodukt Helium aus der Reaktorkammer absaugen. Andererseits Metallpartikel, die von den Neutronen aus der Reaktorwand herausgeschlagen werden und das Plasma verunreinigen könnten. Dafür muss der Divertor Temperaturen bis 2000 Grad aushalten – mehrere Jahre lang. Als Divertormaterial soll vorerst ein Verbund aus Wolfram und faserverstärktem Kohlenstoff eingesetzt werden, später reines Wolfram. „Wir wollen an ITER liefern“, bestätigt Werner Schulmeyer, Leiter Kernfusion bei Plansee. Konkurrenz bei der Ausschreibung brauchen die Tiroler kaum zu fürchten. „Es gibt weltweit nicht viele Firmen, die so etwas bauen können.“ Die österreichische Industrie gibt sich dennoch zurückhaltend. Verständlich: Zu groß sind die Planungshorizonte, zu gering die Stückzahlen, als dass ein durchschnittlicher Betrieb die Entwicklungsarbeiten vorfinanzieren könnte. Skepsis nähren auch die vorgesehenen Haftungsverträge. „Es wäre absolut inakzeptabel, die Haftung für mögliche Folgeschäden zu übernehmen“, mokiert sich ein grundsätzlich interessierter Firmenchef. „Die Bauteile von ITER sind schließlich etwas völlig Neues und wurden noch nie zuvor eingesetzt.“
Weil ITER ein Kind der Wissenschaft ist, ist vorgesehen, die technischen Details der Entwicklungen offen zu legen. Das schmeckt auf Geheimhaltung bedachten Hightech-Schmieden nicht. Ob mit oder ohne Österreich – der Fusionsreaktor wird gebaut. In einem internationalen Gemeinschaftsprojekt sind nationale Eitelkeiten sowieso fehl am Platz.