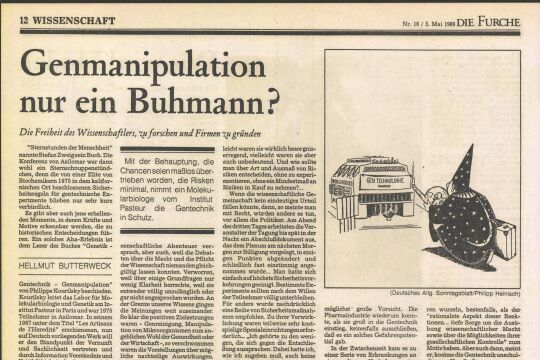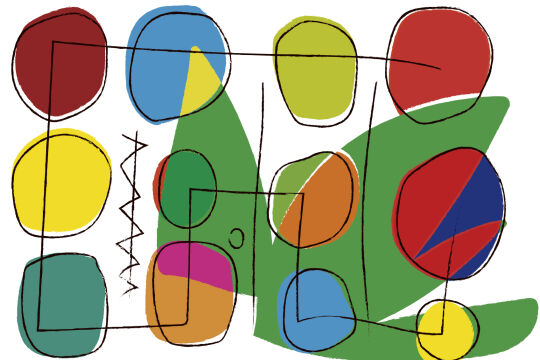Die fortschreitende Auffächerung wissenschaftlicher Disziplinen wirft neue Fragen auf: Droht somit der Blick auf das Ganze verloren zu gehen? Und wer fordert diesen Blick noch ein? Damit stellt sich die Suche nach der – ganzheitlichen – Leitwissenschaft. Doch wie sich zeigt, ist dies müßig. Die Fragen stehen in einem Zusammenhang, und der ergibt das Ganze.
„Die Bewegung der Einheit der Wissenschaft hat nun seit einigen Jahren Fortschritte erzielt, und die Anzahl jener Vertreter der verschiedenen Wissenschaftsbereiche, die ihr Interesse an ihr kundgetan haben, […] hat von Jahr zu Jahr zugenommen.“ Diese Zeilen schrieb Otto Neurath, prominentes Mitglied des Wiener Kreises, vor 74 Jahren. Auf die heutige wissenschaftliche Landschaft könnten sie kaum weniger zutreffen.
Die Gegenwart ist von heterogener Vielfalt geprägt. Die akademische organisierte Wissenschaftswelt gliedert sich in Fakultäten, Institute und Departments. Darunter sorgen die Arbeitsgruppen für eine kaum noch überschaubare Aufsplitterung der Forschungsbereiche. Eine typische Begleiterscheinung des postmodernen „Anything goes“?
Kaum, denn Wissenschaft sucht schließlich nach Wahrheit, dem postmodernen Denken seit jeher ein Graus. Nicht sehr originell, aber im Kern wohl nicht falsch ist die Diagnose, dass verschiedene Wissenschaften verschiedene Aspekte der Welt beschreiben und erklären. Bleibt da noch Platz für eine allumfassende Leitwissenschaft?
Neue Kategorien
Lange gefiel sich die Philosophie in dieser Rolle als integrative Mutterdisziplin. Ihre Aufgabe besteht darin, auf die unhinterfragten Voraussetzungen der Einzelwissenschaften zu reflektieren und damit die Ordnung zu bewahren. Das tut sie heute nicht schlechter als früher, freilich unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Derweil sind ihre Kinder flügge geworden und benötigen längst keinen elterlichen Rat mehr.
Es ist schwer zu sehen, wie sich das Konzept einer Leitwissenschaft heute inhaltlich verstehen ließe. Stattdessen haben sich ökonomischen Kategorien wie „Fortschritt“, „Erfolg“ und natürlich „Verwertbarkeit“ als erschreckend gut anwendbar erwiesen. Wissenschaft als Mittel gesellschaftlicher Zwecke ist ein Gedanke, den zwar schon Francis Bacon im 17. Jahrhundert formulierte. Doch zum bestimmenden Trend wurde er erst gut 300 Jahre später. „Es beginnt nach dem Zweiten Weltkrieg, dass wissenschaftliche und ökonomische Entwicklung stark Hand in Hand gehen“, sagt Ulrike Felt, Vorständin des Wiener Instituts für Wissenschaftsforschung. Deutlicher Profiteur dieser Entwicklung waren die Biologie und ihre Derivate, die heute unter dem Namen „Lebenswissenschaften“ zusammengefasst sind.
„Seit den 1980er-Jahren erkennt man auch ein Kippen der Fördergelder weg von der Physik, hin zu den Lebenswissenschaften.“ Wenn diese heute vielfach als „die Leitwissenschaft“ des 21. Jahrhunderts bezeichnet werden, ist das deshalb weniger Ausdruck einer fachlichen Dominanz, sondern zeigt die viel fundamentalere Kluft zwischen Grundlagenforschung einerseits und den auf industrielle Verwertbarkeit zielenden Forschungsbereichen andererseits.
Mit ökonomischer Relevanz geht nicht selten auch gesellschaftliches Ansehen einher. Wo einer viel Geld hineinsteckt, muss schon mächtig Substanz drin sein. Denn Investoren sind ja nicht dumm. Der Kapitalismus als Qualitätsfilter sozusagen.
Die gesellschaftliche Relevanz einer Wissenschaft bemisst sich heute zu einem Gutteil nach ihrem Erfolg beim Einwerben von Fördermitteln. Aufschlussreich ist hier ein Blick auf die vorhandenen Gelder. So verfügt die anwendungsorientierte FFG über ein mehr als dreimal so hohes Jahresbudget wie der Grundlagenfonds FWF. Dem Trend zur Verwertbarkeit kann sich selbst die dezidierte Grundlagenforschung nicht immer entziehen. So sehen sich beispielsweise Mitarbeiter des CERN seit Jahren genötigt, in Interviews darauf hinzuweisen, dass an ihrem Institut immerhin das World Wide Web erfunden wurde.
Die Faszination Neurobiologie
Man sollte freilich nicht ungerecht sein. Manche Disziplinen verfügen eben über Gegenstandsbereiche, denen eine natürliche Faszination innewohnt. Die Neurobiologie ist ein gutes Beispiel dafür. Die komplexen Funktionen des menschlichen Gehirns lassen sich sogar jenen schmackhaft machen, die es selbst nur eingeschränkt benutzen. Resultate der Neurowissenschaften schaffen es denn auch regelmäßig in die Boulevardpresse.
Ein wenig hilflos steht unter dieser Betrachtungsweise die Mehrheit der Geistes- und Sozialwissenschaften da. Der Öffentlichkeit ist nicht notwendigerweise klar, dass Literaturwissenschaft mehr bedeutet, als Bücher zu lesen. Dass Theaterwissenschaft sich nicht darin erschöpft, Stücke anzusehen. Und dass ein Linguist mehr können muss als Fremdsprachen. „Es ist den Geistes- und Sozialwissenschaften nicht gelungen, den Unterschied zwischen Laien und Experten herauszustreichen“, meint Ulrike Felt. „Dagegen haben die Naturwissenschaften mit dem hohen Formalisierungsgrad ihrer Theorien diesen Unterschied völlig klargemacht.“ Natürlich ist es nicht einfacher, Soziologe oder Philosoph zu werden als Molekularbiologe oder Quantenphysiker. Der Respekt des Laien gilt dennoch meist Letzteren, weil der oberflächliche Blick auf Formelkolonnen und die Auswertungen von Messreihen es so scheinen lässt. Das kränkt zwar die Betroffenen, bringt aber immer noch keinen Kandidaten für eine Leitwissenschaft in Sicht.
Vielleicht ist es deshalb besser, diese Suche einzustellen und stattdessen von „Leitfragen“ zu sprechen. Das macht Sinn, denn Fragen beanspruchen keine Exklusivität.
Das Netzwerk ergibt das Ganze
Fragen können sich ändern oder unterschiedliche Antworten zulassen. Fragen stehen in einem netzwerkartigen Sinnzusammenhang. Die Analyse dieses Netzwerkes ersetzt den traditionellen philosophischen „Blick aufs Ganze“ zeitgemäß und hinreichend.
Keine Wissenschaft ist wichtiger als eine andere. Aber manche Fragen mögen dringlicher sein als andere. Vor allem aber können Fragestellungen von Forschern verschiedener Disziplinen partnerschaftlich bearbeitet werden. Grenzüberschreitende Kooperationen sind ein Merkmal der modernen Wissenschaften. Zuweilen entwickeln sich daraus sogar neue eigenständige Disziplinen oder Wissenschaften. Beispiele dafür liefern die physikalische und synthetische Chemie, die molekulare Biologie und die Kognitionswissenschaft.
Was das Unternehmen Wissenschaft zusammenhält und – in strengem Sinne – wirklich „leitet“, ist das ständige Stellen immer neuer Fragen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!