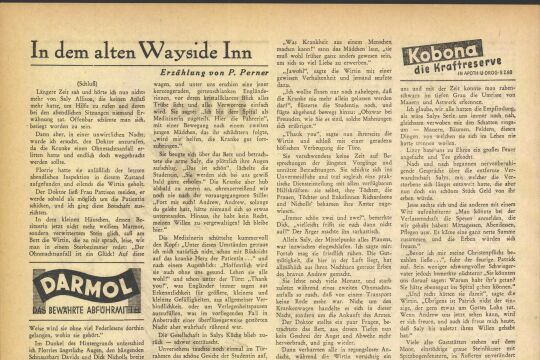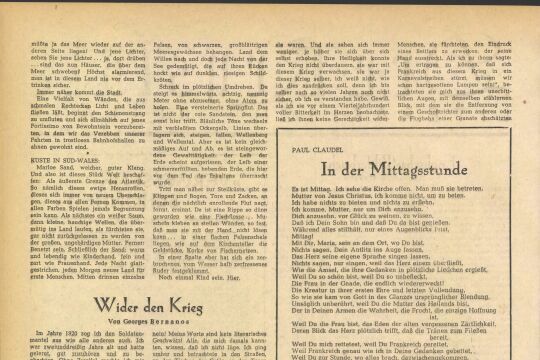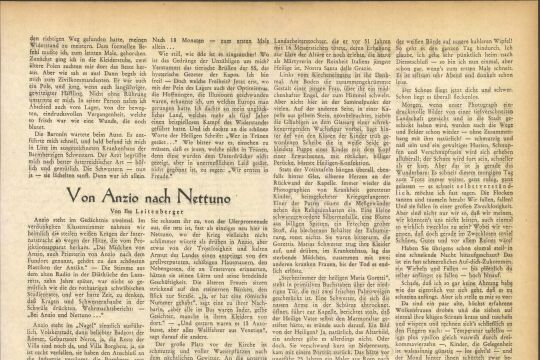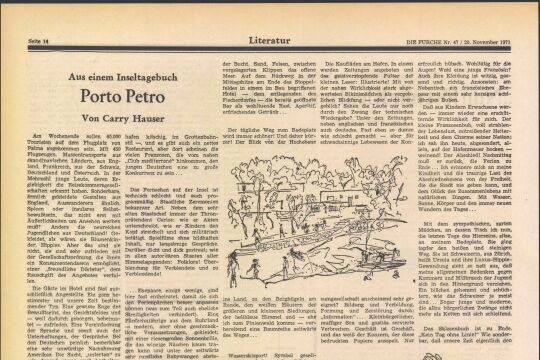Menschen, die durch Terrorangriffe mit Flugzeugen starben, werden auf einem Flugplatz aufgebahrt. Darüber nachzudenken, hat niemand Zeit.
Als der schwere Lastwagen mit dem Kennzeichen P196846 in die Canal Street einbiegt, verstummen alle Gespräche. Eine Frau hält sich die Hände vor die Augen. Polizisten nehmen die Mütze ab. "Keine Fotos", zischt einer die Reporter an. Bewohner des Chinesen-Viertels senken ihr Haupt, einige verbeugen sich. Drei Trucks mit weiß angestrichenen Kühl-Containern im Schlepp rollen langsam vorbei. Bis vor kurzem wurden sie zum Transport von Frischfleisch eingesetzt. Jetzt holen sie die Toten aus der "restricted zone", dem Sperrgebiet, im Süden von Manhattan ab, wo sich bis Dienstag das World Trade Center befand.
Mehr als 20 Kühl-Lastwagen haben Unternehmen der Stadt New York überlassen. Der erste Auftrag für die Fahrer lautete: "Bringt die Plastik-Säcke rein." 30.000 davon haben die Behörden mit Hilfe anderer US-Bundesstaaten zusammengebracht. Tausende von Leichensäcken wurden inzwischen in die Nähe der Trümmerberge gefahren, aus denen Bergungstrupps mehr und mehr Tote und Körperteile ausgraben. Wie den Fahrern zumute ist, erfährt man nicht. Keine Interviews. "Dieser Job ist für alle, die ihn erledigen müssen, schon schwer genug", sagt ein Polizeioffizier. "Lassen Sie die Männer in Ruhe."
Auch noch Tage, nachdem Terroristen zwei Passagierflugzeuge in die 412 Meter hohen Zwillingsürme rasen ließen, ist Manhattan noch eine geteilte Stadt. Unten im Süden schuften sich Feuerwehrmänner und Nationalgardisten, Polizisten, Bauarbeiter, Kran- und Baggerfahrer, Suchhundeführer und Rotkreuzhelfer bis zur völligen Ermattung ab. Je weiter man jedoch Richtung "Uptown" kommt, desto mehr wirkt Manhattan auf den ersten Blick wie eh und je. Hier sind die Geschäfte längst wieder offen, nach dem alten Motto 24/7 - 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche. Man sieht Schulkinder, die umhertoben, und auch die jungen, meist schwarzen Basketballspieler, die auf den engen Sportplätzen zwischen Manhattans Wolkenkratzern ihre Bälle in den Korb werfen.
"Riesenscheiße ist das alles, aber wir müssen schließlich Geld verdienen", sagt Barkeeper Simon im Pub O'Donnell. "Da, schauen Sie, der sagt das auch immer." Im Fernseher über dem Tresen beschwört Bürgermeister Rudolph Giuliani zum hundertsten Mal das "wiederauferstehende neue New York, das stärker als je zuvor sein wird". Danach sehnen sich alle. Doch das wird dauern. Auch die große Mehrheit der New Yorker, die in "NOA" lebt, holt das Grauen auf die eine oder oder andere Art immer wieder ein. "NOA starts here", hat ein Zyniker an eine Wand kurz vor der Sperrzone geschrieben und darunter "North of the Apocalypse", sinngemäß: nördlich der des Weltuntergangs.
Die weißen Kühl-Trucks kommen an "NOA" nicht vorbei. Auf ihrem Weg zu den Leichenschauhäusern müssen sie, eskortiert von Polizisten auf Motorrädern, Leichen durch jene Viertel fahren, in denen Hunderttausende versuchen, ihr Leben wieder einzurichten. Die meisten der Trucks steuern den Flughafen La Guardia auf Long Island an. Dort wurden Hangars zu Leichenschauhäusern umfunktioniert. Menschen, die durch Terrorangriffe mit Flugzeugen starben, werden auf einem Flugplatz aufgebahrt. Darüber nachzudenken, hat niemand Zeit. Schon gar nicht ist den Tausenden, die rings um das Armory House an der Lexington Avenue Schlange stehen, nach philosophischen Übungen zumute. Hier ist das größte von mehreren Betreuungszentren für Angehörige mutmaßlicher Opfer eingerichtet.
"Toneyll ist meine Tochter", sagt eine schwarze Frau. "Hier ist ihr Bild, es muss sie doch jemand gesehen haben." Toneyll McDay arbeitete im Nordturm des World Trade Center. Um 07.30 Uhr habe sie am Dienstag an ihrem Schreibtisch gesessen. Eine schlanke Frau mit langem schwarzen Haar ist auf dem Foto zu sehen, das die Mutter herumzeigt. Sie will nicht glauben, dass ihre Tochter tot ist. Wer immer sie zuletzt gesehen hat, wird wohl nicht mehr Auskunft geben können, wie sie starb. Es bricht keine Panik aus, als ein Beamter die erste Liste mit hundert Namen der bestätigten Toten herumreicht. Einige wenige weinen still vor sich hin. Die meisten finden niemanden auf der Liste, den sie kennen. Toneyll steht nicht darauf. Weiterer Listen folgen. Alle zusammen werden Tausende von Namen enthalten.
"Bis zur letzten Gewissheit gibt niemand die Hoffnung auf", sagt Pfarrer Alfonso Aguilar. Wie viele andere Geistliche - aller Konfessionen - steht der Katholik an der Ecke Lexington Avenue und 26th Street für trostreiche Gespräche zur Verfügung. 35 Frauen, Männer und Kinder haben sich an diesem Tag bisher an ihn gewandt. Der Herr werde mit den Opfern sein, habe er allen gesagt. Aber er hat auch etwas hinzu gelernt: Viele wollten sich nicht allein auf den Herrn verlassen. "Die Leute wollten nicht weinen. Sie haben gesagt, wenn wir stark bleiben, dann hilft das unseren Lieben unter den Trümmern zu überleben."
Derweil ziehen andere durch Manhattan und schüren Spannungen. Eine Gruppe weißer Jugendlicher mit Baseballschlägern steht vor der Grand Central Station und brüllt: "Tod den Arabern". Eine einzige Polizistin löst die Gruppe auf. Drüben in Brooklyn braucht es Hunderte von Uniformierten, um die Einwohner des Araberviertels links und rechts der Atlantic Avenue zu schützen. Schuldzuweisungen geistern durch die ganze Stadt. Auch anti-jüdische Parolen tauchen hier und da auf. Und irgendjemand will gar Ex-Präsident Clinton und dessen Frau für die Katastrophe verantwortlich machen. Auf fast einem Dutzend Telefonzellen ist zu lesen "Bill - Hillary - Murderer - WTC".
Der Autor ist dpa-Korrespondent in New York.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!