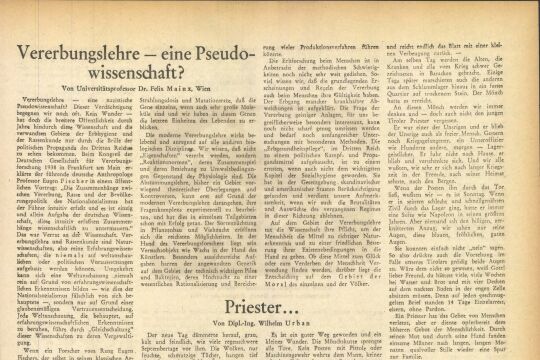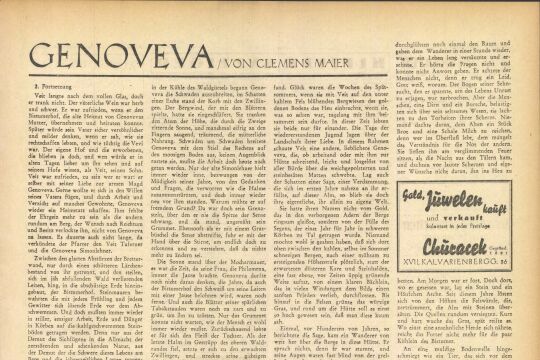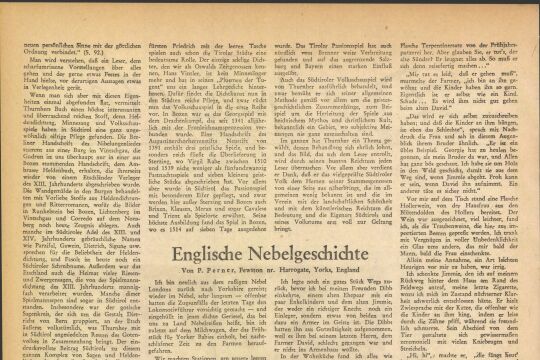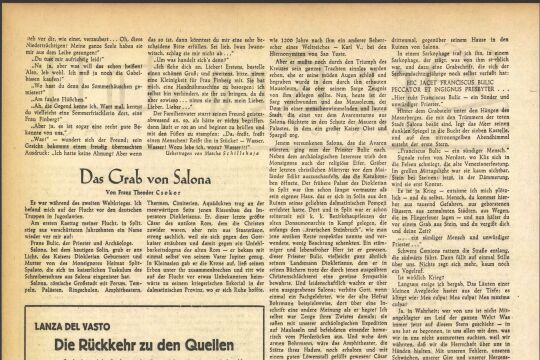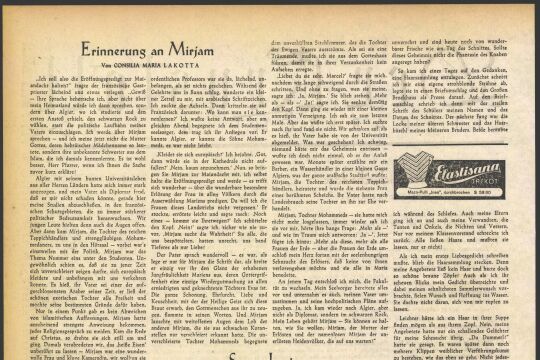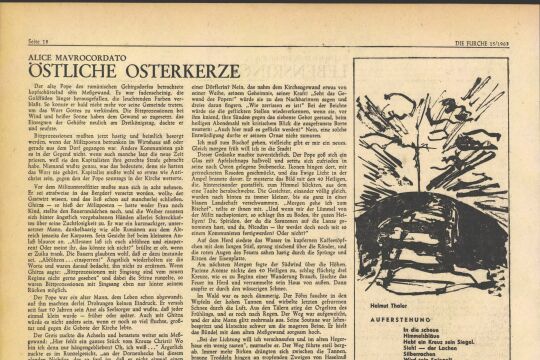Eine Spurensuche in den ukrainischen Ostkarpaten, wo nur Grabsteine und Erinnerungen geblieben sind.
Das Gras zwischen den dunklen Steinen ist lange nicht mehr gemäht worden, so dass die Schritte in der Wiese sanft eingedrückte Spuren hinterlassen, die sich bald wieder schließen. Die Grabsteine stehen achtlos über die Wiese verstreut wie Dominosteine nach einem abrupt unterbrochenen Spiel, nach vorn und hinten gebeugt, einige lehnen sich aneinander, als seien sie schon zu alt und zu müde, um von alleine zu stehen, andere sind längst umgestürzt, so dass die verwitterten Inschriften und Symbole von Namen und Berufen - zwei Hände, ein Fisch, ein Vogel (ein Rabe?), ein aufgeschlagenes Buch - in den Himmel hinaufschauen, manche sind so tief eingesunken, dass sie nur mehr eine Handbreit aus dem Boden ragen. An vornüber gebeugten Steinen, deren Schräge sie vor der zerstörerischen Wirkung von Schnee und Regen bewahrt, sieht man, dass viele früher einmal bemalt waren - es sind noch Spuren von blauer Farbe zu erkennen. Ein leichter Sommerregen wischt behutsam über die Steinrücken. Die Wiese mit dem alten jüdischen Friedhof von Jabluniv liegt am Rande des Dorfes, nur wenige Schritte von der Landstraße, die von Kolomyja in steilen Windungen über die bewaldeten Kuppen der ukrainischen Ostkarpaten nach Kosiv führt.
De Wiese mit dem Friedhof
Von einem nahen Bauernhaus klingt wütendes Hundegebell herüber. Eine alte Frau tritt aus dem niedrigen Stall, um nach dem Rechten zu sehen. Die Grußformeln in dieser entlegenen Gegend scheinen sich seit Jahrhunderten nicht verändert zu haben:
Slawa Isusu Christu! (Gelobt sei Jesus Christus) - Slawa na wiki wikow! (Gelobt für ewige Zeiten!)
Die Bäuerin klagt, dass auf der Friedhofswiese, die zu ihrem Hof gehört und deren Gras sie für ihre beiden Kühe benötigt, keiner mähen will, weil an den Steinen jede Sense kaputt geht. Und wo bekommt man dann eine neue her? Wo heute alles knapp ist in der Ukraine. Doch die Steine ausgraben und wegschaffen, das darf man auch nicht, das haben die Behörden bei Strafe untersagt, und daran denkt ja auch keiner, denn immerhin ist das doch ein Friedhof, auch wenn hier seit langem keiner mehr begraben wurde. Manchmal kommen Fremde, um den Ort zu besuchen. Vor ein paar Monaten waren Juden da, mit langen schwarzen Mänteln, Hüten und Bärten.
Chassiden?
Sie zuckt die Achseln. Sie weiß nur, dass sie Juden waren, das haben sie selber gesagt. Der Älteste hat Ukrainisch gesprochen. Sie sind im Gras herumgestampft und haben etwas gesucht, haben versucht, auf den Steinen etwas zu entziffern, offenbar konnten sie die fremde Schrift lesen. Einer hat ihr etwas Geld gegeben, damit sie ihnen Wasser brachte, weil sie durstig waren von der Reise. Nach einer Stunde sind sie wieder gefahren. Den Wagen hatten sie dort drüben abgestellt, bei der Bushaltestelle, der Chauffeur ist gar nicht erst ausgestiegen, er war wohl ein Hiesiger.
An der Bushaltestelle stehen drei Frauen im Regen. Als Schutz haben sie Plastiktischtücher über den Kopf gezogen, die ihnen bis zu den Knien reichen. Zwei haben sich in karierte Tischtücher gehüllt, die dritte in eines mit buntem Blumenmuster. Regenmäntel sind ein Luxus in der Ukraine, den sich nicht jeder leisten kann. Die Frauen schauen neugierig zu den Fremden hinüber.
Slawa Isusu Christu!
Slawa!
Ob es hier in der Gegend noch Juden gibt? Sie schauen einander fragend an, dann schütteln sie die Köpfe. Die Frauen sind bloßfüßig, ihre Schuhe halten sie in den Händen, die ziehen sie erst an, wenn sie einen Laden, ein Amtsgebäude oder die Kirche betreten. Schuhwerk ist offenbar ein Luxus.
Juden? Früher wohnten hier überall Juden.
Bogdan Bojtschuk beschreibt mit der Hand einen weiten Kreis, der die Häuser entlang der Straße in Prokurava einschließt. Den Weiler Prokurava erreicht man, wenn man bei Pistyn die Landstraße nach Kosiv verlässt und auf einem elenden, von tiefen Schlaglöchern und Rinnen übersäten Fahrweg dem Lauf des Gebirgsflüsschens Pistynka aufwärts folgt. Die Häuser entlang des Weges sind reich verziert, bunte Mosaikstreifen aus Glas und Fliesen, kunstvolle Schnitzarbeiten, die Dächer mit hellem Blech beschlagen, das auch die obere Fassade bedeckt, so dass die Häuser aussehen wie riesige, halb in Stanniolpapier gewickelte Bonbonwürfel. In den Gebirgsdörfern am Oberlauf von Prut und Tscheremosch leben heute fast ausschließlich Huzulen, ein ukrainischer Volksstamm, berühmt für seine ornamentfreudige Volkskunst. Bis zum Zweiten Weltkrieg war die Region ein Zentrum des chassidischen Ostjudentums.
Der Huzule Bogdan Bojtschuk ist 66 Jahre alt, er hat seine jüdischen Nachbarn deutlich in Erinnerung bewahrt. Dort drüben stand die Hütte von Meschilem, daneben die von Chaskel, weiter unten wohnte Schmul, über dem Flüsschen Berl. Bojtschuk nennt nur die Vornamen der Juden, ihre Familiennamen hat damals wohl keiner gekannt, außer der Vertreter der Staatsmacht, der posterunkowy (Wachmann), wie er den Gesetzeshüter polnisch nennt.
Von 1918 bis 1939 gehörte das Gebiet zu Polen. Damals habe noch Ordnung geherrscht in Prokurava, erinnert sich Bojtschuk. Wenn der Polizist in der sauber gebürsteten Uniform durchs Dorf schritt, wurde er ehrerbietig gegrüßt. Heute ist alles auf den Kopf gestellt. Die Huzulen vergessen die alte Lebensart, sogar das Vieh zeigt sich widerspenstig. Erst vor wenigen Tagen ist Bojtschuks einzige Kuh von der eingezäunten Weide auf die Straße gelaufen, was den ordnungsliebenden Huzulen so erzürnte, dass er das Rindvieh für drei Tage in eine Hütte sperrte zur schtraf, wie er sagt, ein Lehnwort aus habsburgischer Vergangenheit. Dass sie in dieser Zeit, in Ermangelung der frischen Weide, weniger Milch gab, nahm er in Kauf. Das hätte es früher nicht gegeben, als Meschilem noch seine Kilims herstellte, jene bunten Wollteppiche, die fürs Huzulenland typisch sind. Er hatte einen einfachen Webstuhl in seiner engen Hütte, auf dem er Tag und Nacht mit Frau und Kindern arbeitete, um alle satt zu bekommen.
Ein Huzule erinnert sich
Sie waren fleißige Leute, die Juden von Prokurava. An zwei Töchter Meschilems erinnert sich Bojtschuk besonders gut, weil sie so lustige Namen trugen: Machli und Wachli - vielleicht wurden sie auch nur von ihren Eltern so gerufen, jedenfalls hat das ganze Dorf sie so gekannt. Sie sind oft zu seinen Eltern gekommen, um Milch oder Schafkäse zu holen. Chaskel hatte ebenfalls zwei Töchter, Sura und Tauba, und einen Sohn, Schmul. Als dieser heiratete, besaß er anfangs kein eigenes Haus, da wohnte er mit seiner jungen Frau bei Bojtschuks Eltern, die genug Platz hatten. Die Juden waren meist Handwerker, Schuster, Schneider, Teppichweber, Tischler, manche besaßen auch Wald, Weideland und Vieh, das sie, wie die Huzulen, im Sommer auf die Hochalmen trieben.
Vor Bojtschuks Haus ist eine unscheinbare Erhebung, auf der er Kartoffeln und Knoblauch anbaut. An dieser Stelle stand einst eine jüdische Schenke, die Jantscho gehörte. An die ebenerdige Gastwirtschaft erinnern nur mehr die überwachsenen Fundamente und ein mit Steinplatten ausgekleidetes Loch in der niedrigen Böschung, eine ehemalige Fensterluke in den längst zugeschütteten Keller. Jantscho schenkte Bier und billigen Wein aus, vor allem aber Schnaps, horilka, den nannten sie schabasilka, weil die Juden ihn am Schabbes tranken. Auch die Juden tranken horilka, doch mit Verstand und Maß, sagt Bojtschuk. Überhaupt wurde damals weniger getrunken als heute. Wenn drei in Jantschos Schenke zusammensaßen, bestellten sie vielleicht 250 Gramm Schnaps, dann sagten die Leute schon, das sind aber Säufer. Heute schüttet einer allein 500 Gramm und noch mehr in sich hinein, und keiner findet das bemerkenswert.
Sowjets und Deutsche
Im September 1939 wurde Polen zerschlagen. Auf den engen Straßen der Ostkarpaten drängten sich die Flüchtlinge, um die nahen Grenzen zu Ungarn und Rumänien zu erreichen. Statt der mit Bangen erwarteten Deutschen kamen zunächst die Sowjets. Die Huzulen, traditionell von Holzwirtschaft und Viehzucht lebend, empfanden wenig Sympathie für die neue, von den Kommunisten eingeführte Ordnung. Wer wurde denn damals schon Kommunist?, fragt Bojtschuk verächtlich: Ein paar arbeitsscheue Huzulen, die gern beim Schnaps oder Bier saßen und dem lieben Herrgott den Tag stahlen. Die führten plötzlich das große Wort.
Doch die russische Zeit war nicht von langer Dauer. Im Juni 1941 kamen die Deutschen und ihre Verbündeten, die Ungarn, ins Land, und für die Juden brachen bittere Zeiten an, sie wurden behandelt wie Vieh und noch schlimmer. Viele versteckten sich in den umliegenden Wäldern, um abzuwarten, ob die Zeiten sich vielleicht wieder beruhigten und die Peiniger abzogen. Sie zogen nicht ab. Bojtschuk erinnert sich, wie er damals mit anderen zur Heumahd ging. Da saßen ihre Juden, Jantscho, Meschilem, Chaskel und andere mit ihren Familien am Waldrand im hohen Gras versteckt und baten um etwas zu essen. Sie brachten ihnen etwas, obwohl das gefährlich war. Wer Juden versteckte oder ihnen sonstwie Hilfe leistete, konnte selber mit dem Tod bestraft werden. Nach ein paar Tagen waren die Juden von Prokurava verschwunden.
Nicht alle Ukrainer haben ihren jüdischen Nachbarn geholfen. Jehoschua Gertner, einer der wenigen Überlebenden aus dem nahen Städtchen Kosiv, der eine Geschichte des Untergangs von Kosiv verfasste, erinnert an von Huzulen veranstaltete Massaker, etwa in Jablunycja am Schwarzen Tscheremosch, wo sie die Juden in den reißenden Gebirgsbach warfen und ertränkten. Auch in anderen Dörfern kamen die Einheimischen den Deutschen und der ukrainischen Miliz oft zuvor. Manche griechisch-katholische Pfarrer predigten in den Kirchen, dass nun über die Juden gekommene Unglück sei die Strafe Gottes dafür, dass sie seinen Sohn zu Tode gequält hätten. Gott habe sich gegen das Volk der Juden gewandt, es sei daher gottgefällig, bei ihrer Vernichtung mit Hand anzulegen.Doch Jehoschua Gertner nennt auch Huzulen, die ihren jüdischen Nachbarn Hilfe leisteten und sie versteckten, ohne die Gefahr zu achten, in die sie sich damit selber begaben. Was aus den Juden von Prokurava geworden ist, ob einer von ihnen überlebt hat, kann Bojtschuk nicht sagen.
Zwangsumsiedlungen
1951 haben die Kommunisten in Prokurava und vielen umliegenden Dörfern die meisten Häuser abgerissen oder niedergebrannt und die Bewohner umgesiedelt - in die Gegend von Odessa. Dort wurden angeblich Menschen gebraucht. In Wahrheit ging es eher darum, den ukrainischen Nationalisten der UPA, der Ukrainischen Aufständischen Armee, die bis in die fünfziger Jahre im unwegsamen Gelände der Waldkarpaten einen Partisanenkrieg gegen die Kommunisten führten, die Basis zu entziehen. Auch Jantschos Schenke wurde damals niedergebrannt.
Erst Mitte der fünfziger Jahre durften die meisten Huzulen wieder in ihre Heimat zurückkehren, unter ihnen auch Bojtschuks Familie. Aber nicht auf ihr altes Grundstück, das nach Meinung der Kommunisten zu nahe am Wald lag, der als Heimat der Partisanen galt, die daher auch Waldmenschen genannt wurden. Den Bojtschuks wurde das Grundstück neben der Straße zugewiesen, auf dem die Brandruine von Jantschos Schenke stand.
Ein Fass Wein versteckt
In der Ukraine gehen bis heute Legenden um von Gold und anderen Schätzen, welche die Juden vergruben, ehe sie erschossen oder in die Vernichtungslager geschickt wurden. Der Schankwirt Jantscho freilich war arm und besaß kein Gold. Doch er vertraute den Bojtschuks an, er habe im Keller ein Fass Wein versteckt, das wolle er nach seiner Rückkehr ausgraben. Jantscho kam nicht zurück. Auch nicht Meschilem, Machli und Wachli, Sura, Tauba oder Chaskel, kein einziger Jude aus Prokurava. Als Bojtschuk 1956 heiratete, machte er sich auf die Suche nach dem versteckten Wein. Und er wurde im eingestürzten Keller tatsächlich fündig. Der Wein war dickflüssig wie Molasse und ziemlich sauer, erinnert er sich, vielleicht eine Folge des Feuers, das Jantschos Schenke eingeäschert hatte. Doch der Wein hatte immer noch eine kräftige Farbe, und versetzt mit Zucker und Wasser wurde er sogar wieder trinkbar, wie die Hochzeitsgäste dankbar vermerkten.
Außer der unscheinbaren Erhebung vor Bojtschuks Haus und der Erzählung von dem aus der Erde geborgenen Wein erinnert in Prokurava nichts an den jüdischen Schankwirt Jantscho, ebenso wenig an Meschilem den Kilimweber, an Chaskel, Schmul und ihre zahlreichen Angehörigen.
Vorabdruck aus:
Warum wurden die Stanislaws erschossen? Reportagen von Martin Pollack
Zsolnay Verlag, Wien 2008
232 Seiten mit zahlreichen Abbildungen, gebunden, € 20,50
Das Buch erscheint am 4. Februar.