Lautstarke Ankündigungen - kleinlaute Taten. Das Operettenjahr der Wiener Volksoper im Rückblick.
Das von der Wiener Volksoper ausgerufene Europäische Operettenjahr ging am vergangenen Sonntag mit der Premiere von Kálmáns "Gräfin Mariza" zu Ende - und um es gleich vorwegzunehmen, zu einem Skandal, den eine Wiener Tageszeitung bereits angekündigt hatte, kam es nicht. Im Gegenteil erlebte man zwei Akte, in denen getreu dem Original folgend (in vielen Details sogar überzeugend ideenreich) die Handlung nacherzählt wurde - dies allerdings in einem hässlichen Bühnenbild (entworfen von Klaus Werner Noack), das die Geschichte in einer heruntergekommenen Garage oder Scheune mit vorgelagertem Toilettenhäuschen ansiedelte. Dem folgte ein aufgeblähter dritter Akt, der als kompletter Stilbruch zum Vorangegangenen die Auflösung aller Verwirrungen in eine Spielshow à la "Bitte, verzeih' mir" verlegte. Mag sein, dass damit Regisseurin Vera Nemirova die heutige Fernsehgesellschaft mit ihren peinlichen Heirats-, Rache- und Vergebungs-Shows auf den Arm nehmen wollte. Die Ausführung dieses fehlgeleiteten Schlussteils blieb jedoch derart unbeholfen dilettantisch, dass es kaum zu einer Provokation, geschweige denn zu einem Theaterskandal reichte.
"Europa der Regionen"
Dieser Versuch, die Operette "ins Heute zu führen", muss als gescheitert angesehen werden - ein Urteil, das man über sämtliche Teile des "Europäischen Operettenjahres 2002" verhängen muss. Blicken wir zurück: Das Jahr der Euro-Einführung war von der Volksoper zum "Europäischen Operettenjahr" deklariert worden, fünf Operetten aus fünf verschiedenen europäischen Ländern hatten über das Jahr verteilt im Haus am Gürtel Premiere. Die Volksoper wollte damit "zu Beginn des 21. Jahrhunderts einmal mehr ihrem Ruf, das führende Operettenhaus der Welt zu sein, inhaltlich, künstlerisch und emotional gerecht werden" und das "Europa der Regionen, der Vielstimmigkeit, der differenzierten lokalen Traditionen" zeigen. Dies hätte aber nur Sinn gemacht, wenn entsprechend spezifische Werke der einzelnen Länder gezeigt worden wären- mit der Wahl der "Generalin" von Amadeo Vives war man aber von einer typischen Zarzuela weit entfernt, das Werk mit Schauplatz auf den britischen Inseln gehört zur Gruppe der international geprägten Operetten Spaniens. Italienische Operettenmeister hätten mit Ranzato, Lombardo und Pietri zur Wahl gestanden, Pietro Mascagni war hingegen vor allem der Oper verbunden, unternahm mit "Si" mehr einen Seitensprung zur leichten Muse. Und "Gräfin Mariza"? Gewiss, das Stück spielt im ungarischen Ambiente und auch der Komponist war gebürtiger Ungar; "Gräfin Mariza" erblickte jedoch 1924 in Wien das Bühnenlicht, gehört seither zu den Meisterwerken der Wiener Operette. Hätte man ein ungarisches Werk präsentieren wollen, hätte man ein Stück von Pongrác Kacsóh oder Jenö Huszka wählen müssen - oder, wenn es unbedingt Kálmán hätte sein müssen, sein noch in Budapest uraufgeführtes "Herbstmanöver".
Gesamtkunstwerk
Immerhin hatte man jedoch neben den Standardoperetten "Der Bettelstudent" und "Gräfin Mariza" Gelegenheit, Raritäten des Genres kennen zu lernen. Wurde die Volksoper aber dabei ihrem selbst gesteckten Anspruch gerecht, die Kunstform ins Heute zu führen und dabei "die Operette als Gesamtkunstwerk aus Stil, Witz, Sentiment und Musik auf die Bühne zu bringen?" Wohl kaum! Am meisten blieb der Regie führende Hausherr Dominique Mentha von der Idee des Gesamtkunstwerks entfernt. In seiner plumpen Inszenierung der Millöcker-Operette löste er mehrmals Nummern aus dem Zusammenhang heraus und ließ sie konzertant in Wunschkonzertmanier präsentieren. Es folgte die belanglose, von Emilio Sagi hölzern inszenierte "Generalin" von Amadeo Vives. In Sullivans "Pirates of Penzance" hätte man problemlos eine Vielzahl aktueller Bezüge herstellen können, Regisseur Matthias Schönfeldt verschenkte aber diese Möglichkeiten in seiner hilflosen Produktion komplett. Regietheater der schlimmsten Sorte herrschte bei Mascganis "Si", von der originalen Handlung blieb nichts übrig, Regisseurin Katja Czellnik zeigte statt der traurigen Liebesgeschichte untheatralisch den Zustand unmöglicher Liebe in einer Welt der Maschinen. Nach diesem Regieunsinn fiel die Produktion von Kálmáns "Gräfin Mariza" als Schlusspunkt des Projekts vergleichsweise konventionell aus, zumindest wenn man sich - siehe oben - auf die ersten beiden Akte beschränkt.
Umsetzung gescheitert
Einen neuen und schlüssigen Weg in der Operettenpräsentation zu beschreiten, ist der Wiener Volksoper in keiner dieser Produktionen geglückt; den lautstarken Ankündigungen waren meist nur kleinlaute Taten gefolgt. Einen Nachweis hat aber die Volksoper gleich mehrfach erbracht, nämlich wie schwer es ist, Operette zu besetzen. Einzelne hervorragende Leistungen - etwa der Damen Edith Lienbacher, Akiko Nakajima und Renate Pitscheider, sowie der Herren Dario Schmunck, Oliver Ringelhahn und Adrian Eröd - konnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Volksoper nicht mehr über ein intaktes Ensemble verfügt. Wäre sonst für Kálmáns "Mariza" eine vibratoreiche Sopranistin mit steifer Höhe und wenig Phrasierungskultur wie Lisa Houben gewählt worden? Hätte man mit Johan Weigel, einen smarten Buffotyp mit entwicklungsfähigen, technisch aber noch unausgereiften tenoralen Mittel, im ersten Fach als Tassilo besetzt? Müsste man sonst nach wie vor auf Sándor Némenth, einen erfahrenen, aber doch mittlerweile stark angegrauten Routinier im Buffofach zurückgreifen? In Papierform erweckte das Operettenprojekt der Volksoper berechtigte Hoffnungen, in der Umsetzung scheiterte es an vielen Faktoren regielicher und musikalischer Art - für das selbsternannte führende Operettenhaus der Welt ein trauriges Zeugnis.
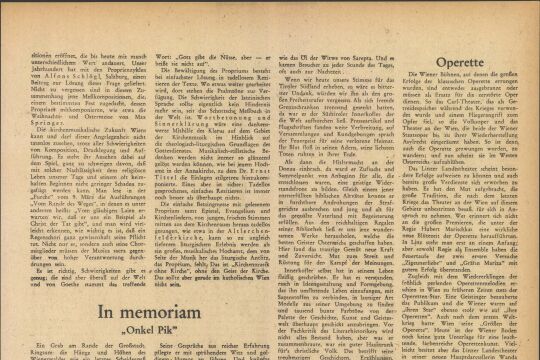









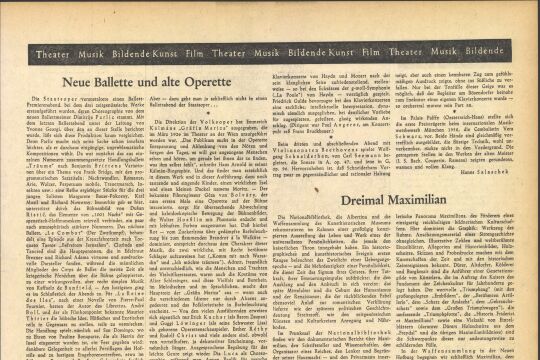

























_edit.jpg)


