Ein Bericht über Christoph Schlingensiefs Werk und den "Tannhäuser" in Bayreuth.
Nun ist sie also vorüber, die mit einiger Spannung erwartete und von zahlreichen Skandalgerüchten begleitete "Neudeutung" von Richard Wagners "Parsifal" durch Christoph Schlingensief bei den Bayreuther Festspielen. Und was ist bei der ganzen Sache herausgekommen?
Das Regiekonzept des "Aktionskünstlers" Schlingensief scheint sich darauf zu beschränken, den Schauplatz der Geschichte in ein südafrikanisches Elendsquartier zu verlegen und alle Handlungselemente, die Sinn und Geist des Bühnenweihfestspiels verkörpern, zu eliminieren oder ins Obszöne und Lächerliche zu verzerren. Die nach Art einer Operetteninszenierung fast ständig in Bewegung befindliche Drehbühne ist mit Gerümpel vollgeräumt und mit Personal bevölkert, das mit dem Stück nichts zu tun hat und aus anderen Produktionen Schlingensiefs übernommen wurde. Dazu wird diese überdimensionale Müllhalde ständig durch Projektionen, sinnlose Filmausschnitte und flimmernde Lichter "belebt", die die singenden Personen fast verschwinden lassen und die Musik zur Nebensache degradieren. Auf Boden und Wänden sind Wortfetzen und Parolen gemalt, wie etwa "Heiliger Hund, bitte für uns" und ähnliche Geistesblitze aus einer eindeutig bestimmten ideologischen Ecke. Dazu passt die geradezu schamlose Umdeutung der ersten Grals- und Abendmahlsszene: An Stelle des Grals liegt in der Bühnenmitte zunächst eine fast nackte dunkle Frau und in der Folge ein riesiger schwarzer weiblicher Torso, an dessen Öffnung die Gralsritter - alle als Priester verschiedener Konfessionen maskiert - ihre Hände mit Blut beschmieren und damit Parsifals weißes Gewand bekleckern. Ansonsten bietet der dritte Akt noch einen Bandltanz der Afrikaner rund um einen kleinen Maibaum; Gurnemanz erkennt den zurückkehrenden Parsifal, bevor dieser die Szene betritt, und anstatt der letzten Gralsenthüllung gibt es einen ekelerregenden Film mit Großaufnahmen eines verwesenden Hasenkadavers.
Musik: auch nicht besser
Aber auch die musikalische Seite fällt nicht ruhmreich aus. Gurnemanz - klangvoll, aber wenig differenziert gesungen von Robert Holl - tritt zu Beginn mit weißem Fell und langem feuerrotem Bart auf, die Karikatur eines nach Afrika verirrten Wikingers. Kundry muss zunächst in afrikanischer Aufmachung, dann aber noch im ersten Akt als Dame in Abendrobe, im dritten Akt als Schwarze mit Baströckchen umherhüpfen und sorgt deshalb bei Gurnemanz´ Worten "Wie anders schreitet sie als sonst" für Heiterkeit beim Publikum. Dass Michelle de Young mit ihrer Rolle gesangliche Mühe hat, fällt dabei schon nicht mehr ins Gewicht. Endrik Wottrich, der sich vom Spieltenor (David in den "Meistersingern") zu einem respektablen Heldentenor mit mehr Metall als Timbre entwickelt hat, kommt damit in den dramatischen Ausbrüchen gut an, bleibt aber in den intimen Momenten des dritten Aktes auf der Strecke. Erstaunlich, dass ihm von der Regie Kundrys Taufe nicht verwehrt wurde; neu dagegen, aber durchaus nicht ohne Wirkung, dass sie danach sogleich stirbt. Hier könnte ein Regisseur tatsächlich zu der stimmigen Auffassung gelangt sein, dass Kundry unmittelbar durch die Taufe von ihrem rastlosen Dasein erlöst wird. Nur steht dieser einzige große Moment der lähmend langweiligen Aufführung in krassem Widerspruch zum übrigen Bühnengeschehen.
Orchester: chancenlos
Ansonsten gibt es noch zwei uninteressante, monoton lärmende, jederzeit gegenseitig austauschbare Baritone: den farblosen Amfortas von Alexander Marco-Buhrmeister und den als - erraten! - rabenschwarzen Gorilla à la King -Kong dargestellten Klingsor von John Wegner, der mit großem Stimmvolumen einigen Eindruck macht. Und ganz zuletzt die schwerwiegendste Enttäuschung: Unter Pierre Boulez wird das großartige Festspielorchester weit unter seinem Wert geschlagen; mit schnellen Tempi wird Langeweile erzeugt - das gibt es ! - und der große Atem der Musik wird nie fühlbar, die mächtigen Bögen des ersten und dritten Aktes stellen sich ebenso wenig ein wie die Dramatik des zweiten. Aber bei all dem pausenlosen Unfug auf der Bühne muss die Musik ja zwangsläufig auf der Strecke bleiben.
Ganz anders am folgenden Abend die Wiederaufnahme des "Tannhäuser" in der kindlich-kitschigen Ausstattung von Philippe Arlaud, dem anderen Ortes - in Bregenz mit Italo Montemezzi und an der Volksoper mit Benjamin Britten - schon optisch Besseres gelungen ist, der aber das Werk nicht antastet und die Geschichte effektvoll erzählt. Einen triumphalen Einstand feiert in der Titelrolle der auch darstellerisch sehr aktive Stephen Gould, in dessen Stimme sich schönes Timbre mit heldischer Kraft vereint. Ricarda Merbeth ist seit der Premiere vor zwei Jahren gereift und nun eine Elisabeth mit blühender Stimme und mühelosen Höhen. Wolfram bleibt der langjährige Bayreuth-Sänger Roman Trekel, der das Manko seines etwas substanzlosen Timbres durch klare Diktion und kluge Darstellung weitgehend ausgleicht. Abgerundet wird die Besetzung durch die sehr kraftvoll, fast zu direkt attackierende Venus von Judit Nemeth und den Landgrafen von Kwangchul Youn, dem man nur den deutschen Fürsten nicht recht abnimmt. Doch was wäre dies alles ohne die musikalische Leitung durch Christian Thielemann, der das an diesem Abend wie ausgewechselt klingende Orchester und den phänomenalen Chor zu Höchstleistungen führte und das Publikum zu einem Beifallsorkan hinreißen konnte. Persönlichkeiten wie er sind es, die Bayreuth weiterhin zur Stätte wirklicher Festspiele machen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!





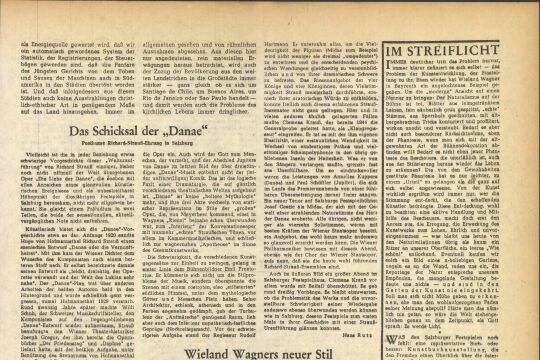


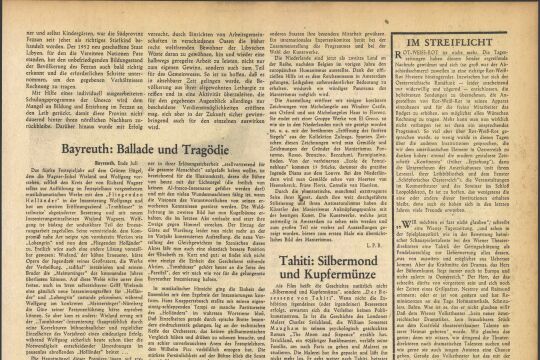



















































































%20OFS_Monika%20Rittershaus%20(16).jpg)







