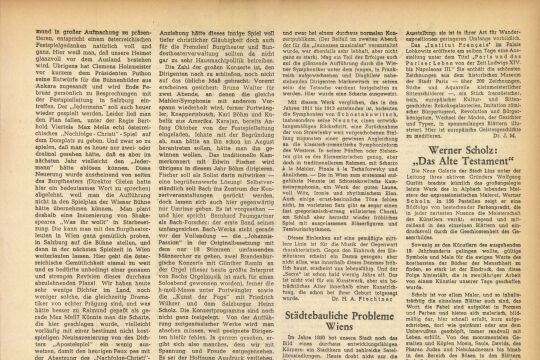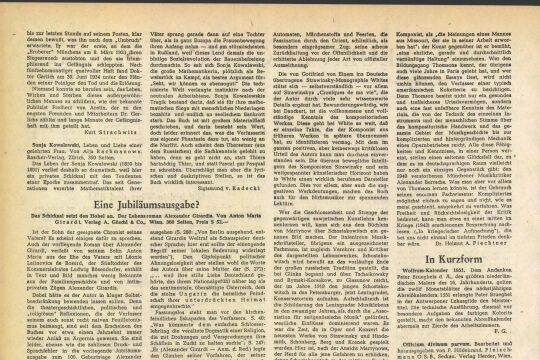"Auf öffentliche Resonanz folgt das Tribunal marxistischer Kulturkritik. In diesem Spiel schöpferischer Gezeiten werden rastlose Produktionsschübe mit Jahren der Latenz, des Schweigens und der inneren Emigration erkauft."
Zum 100. Geburtstag von Dimitri Schostakowitsch. Ein Porträt des Komponisten von Oswald Panagl.
Die Nachrufe zum Ableben von Dimitri Schostakowitsch am 9. August 1975 taten sich mit der angemessenen Würdigung nicht eben leicht. Da war zunächst die öffentliche Person, der Repräsentant einer sowjetrussischen Staatskultur, die den Musiker je nach Bedarf und politischem Klima zur Galionsfigur erhoben oder zum Außenseiter erklärt und gedemütigt hat. Da gab es weiters den sichtbar leidenden Menschen, der sich trotz aller Unbill nicht zur Emigration entschließen konnte und seinem körperlichen Verfall den gleichen zähen Widerstand entgegensetzte wie dem Oktroi der Behörden und den Schikanen einer offiziösen Kunstdoktrin. Endlich und vor allem galt es aber einem Komponisten gerecht zu werden, dessen Schaffen ganz unterschiedliche Werturteile zuließ. Was machte das Eigentliche und Besondere von Schostakowitschs Tonsprache aus?
Anpassung und Weigerung
Der Abstand von drei Jahrzehnten hat den Blick klarer gemacht, doch Ambivalenzen und Widersprüche prägen noch immer das Bild des Menschen und Musikers Dimitri Schostakowitsch. Perioden der Anerkennung werden von Phasen der Missachtung abgelöst; auf öffentliche Resonanz folgt das Tribunal marxistischer Kulturkritik, das dem Musiker Formalismus, Destruktion und Dekadenz vorhält. In diesem Spiel schöpferischer Gezeiten werden rastlose Produktionsschübe mit Jahren der Latenz, des Schweigens und der inneren Emigration erkauft.
Doch was wie Stillstand aussieht, erweist sich im Rückblick als Erneuerung, gleichsam als Verpuppung oder Häutung, als Inkubationszeit neuer Schaffensprozesse. Wenn dem Komponisten die Breitenwirkung versagt ist, geht er in die Tiefe, begibt sich in eine Klausur, in der er neue Verfahren ästhetischer Mimikry und chiffrierter Botschaften entwickelt.
Damit sind wir im Kernbereich seiner Künstlerschaft angelangt. In manchen Wesenszügen Gustav Mahler vergleichbar, verkörpert der russische Musiker eine gebrochene Beziehung zwischen Form und Inhalt, klanglichen Mitteln und persönlicher Aussage, von Schein und Sein. Äußerer Pomp, den man affirmativ (miss)verstehen könnte, steht in Wahrheit für innere Leere, grelle Orchesterfarben und aberwitzige Steigerungen von Tempo und Dynamik dienen der Parodie und schaffen verkappte Porträts politischer Popanze. Triviale Momente bezeichnen die trostlose Banalität des Alltags; Erinnerungsfetzen, verfremdete Zitate, melodische Fragmente beschwören bisweilen Wunschbilder und versickern alsbald in Vergeblichkeit, scheitern an einer feindseligen Realität.
Diesem Komponisten ist ästhetisch nicht über den Weg zu trauen: er ist zu vielem imstande und zu allem fähig. Spannungsreich und dem Prinzip des Wandels in der Kontinuität verpflichtet ist auch seine Auseinandersetzung mit Stilen und Richtungen, sein Verhältnis zum Kanon der tradierten Gattungen: Nach Quantum und Qualität im Mittelpunkt seines Schaffens Streichquartett und Symphonie mit jeweils 15 Werken. Während die Kammermusik den äußeren Rahmen dieses Genres bewahrt, sprengt das symphonische Oeuvre immer wieder die Beschränkung auf das Orchester. Auf den Spuren Gustav Mahlers und im Gefolge von Beethovens "Neunter" bezieht er auch das Instrument der menschlichen Stimme mit ein: Seine 13. Symphonie vertont Texte von Jewtuschenko, das folgende Stück weist den solistischen Sopran-und Basspartien vertonte Gedichte von Garc\0xEDa Lorca, Apollinaire und Rilke zu.
Auch andere "klassische" Werktypen bedient Schostakowitsch mit Bedacht: So schafft er jeweils zwei Konzerte für Klavier, für Violine und für Cello. Wenn er die beiden Stücke für Streichinstrumente David Oistrach bzw. Mstislav Rostropowitsch widmet, werden darin weitere Wesenszüge des Komponisten deutlich: sein Sinn für persönliche Freundschaft und die gleichsam mitbedachte Rezeption. Er schreibt nicht abstrakt und für die Schublade, sondern integriert die Person des idealen Interpreten bereits in den Schaffensvorgang.
Opern und Filmmusik
Ein Schmerzenskind war und blieb bis zuletzt die Gattung Oper. Das Frühwerk Die Nase (nach Gogol) des 22-Jährigen wurde erst spät in seinem Rang erkannt. Das zentrale Stück Lady Macbeth von Mzensk (nach Leskow) erregte nach erfolgreicher Uraufführung (1934) und zahlreichen Produktionen zwischen Zürich und Stockholm, New York und Buenos Aires knapp zwei Jahre später das Missfallen Stalins und leitete damit einen schwierigen Lebensabschnitt des Musikers ein. Die inhaltlich und musikalisch entschärfte Zweitfassung der Oper, die 1962 unter dem Titel Katharina Ismailowa entstand, rehabilitierte zwar den Komponisten, bedeutet aber ästhetisch einen Rückschritt. Das Bühnenwerk Die Spieler (1942) bleibt Fragment. Opernpläne zu den Sujets Der stille Don sowie Schuld und Sühne gedeihen nicht mehr.
Die Filmmusiken von Schostakowitsch als marginal abzuwerten, wäre unpassend, ja schlichtweg falsch. Der Künstler stellt sich bewusst der Herausforderung durch ein junges Medium, das ihn schon in früher Jugend anzieht. Bereits mit 17 Jahren verdient der Student sein Brot als Stummfilmpianist und findet Freude daran. Allenfalls mag man sich an den Themen und Titeln von linientreuen Produkten stoßen, für die der Musiker nach 1945 komponiert: Das unvergessliche Jahr 1919, Lieder der Ströme oder Der Fall von Berlin.
Die Vorliebe des Komponisten für Unterhaltungsmusik hat die russische Kulturpolitik dann mit Argwohn betrachtet, wenn sie dem ideologisch verdächtigen amerikanischen Jazz oder westlichen Tanzrhythmen galt. Erst nach dem Tod des Meisters führten russische Orchester die Noten seines Tahiti-Trot (op. 16, nach dem Foxtrott Tea fort wo) als Standardzugabe im Reisegepäck.
Großer Leidensdruck ...
Passion entfaltet als Vokabel unseres Bildungswortschatzes einen notorischen Doppelsinn. Der Ausdruck vermittelt je nach Kontext die Bedeutung eines schmerzhaften Kreuzweges oder von emphatischer Begeisterung, kurz gesagt: die Ambivalenz von Leidensdruck und Leidenschaft. In beiden Lesarten - getrennt oder vereint - trifft das Wort auf Schostakowitsch voll zu. Dem physischen Leiden, der bedrohlichen Krankheit war der Komponist seit früher Jugend ausgesetzt. Mit 17 Jahren erkrankt er an Bronchien-und Lymphdrüsentuberkulose. Er lernt Spitäler und Kuranstalten kennen, die ihm in seinen späten Lebensjahren zum zweiten Domizil werden sollten. 1959 erkennen die Ärzte eine unheilbare chronische Entzündung des Rückenmarks, die sich in Lähmungsphasen der rechten Hand symptomatisch ankündigte. Mit 60 Jahren ereilt ihn der erste Herzinfarkt, der zweite folgt fünf Jahre später, einer dritten Attacke erliegt der geschwächte Organismus im August 1975. Aber auch das Jahresende 1967 musste der Künstler in Spitalspflege zubringen: Ein schwieriger Beinbruch, der nicht mehr ausheilen wird, beeinträchtigt danach seine Mobilität.
Im Verhältnis zu seiner Umwelt bleiben dem Künstler Leiderfahrungen nicht erspart. Der zunächst als Wunderkind begrüßte frühreife Knabe wird zwar schon mit 13 Jahren in das Konservatorium aufgenommen. Als Jüngling aber wird er 1924 wegen "Jugend und Unreife" vom Kompositionsstudium ausgeschlossen. Zwei Jahre davor musste er einen folgenschweren privaten Kummer durchmachen: Der Tod des Vaters stürzt die Familie in drückende materielle Not.
... und Schaffensdrang
Doch Passion bedeutet bei Schostakowitsch eben auch Enthusiasmus und unbändigen Schaffensdrang. Sein Gesamtwerk beeindruckt durch Vielfalt und Können, es sucht aber mit seinen offiziellen 147 Opuszahlen auch an Fülle seinesgleichen. Selbst in Zeiten der Vereinsamung und verordneten Ablehnung bleibt er rastlos tätig oder erprobt seine Fähigkeiten in neuen Metiers. Die Früchte seines geheimen Schaffens freizulegen und zu sichten, stellte der Musikologie lohnende Aufgaben.
Schostakowitsch war nach seiner Veranlagung kein Einzelgänger: Er hat Kontakte gesucht, zuerst zu Vorbildern, dann zu Kollegen, später zu Schülern und ausübenden Künstlern. Wichtige Passanten kreuzen denn auch flüchtig oder nachhaltig seinen Lebensweg. Der Komponist Aleksandr Glasunow ist sein erster Mentor, der Theatermacher Meyerhold prägt sein Verhältnis zur Bühne, die Musiker Arthur Honegger und Alban Berg werden zu Bezugspersonen auf frühen Auslandsreisen. Nach dem Krieg trifft er Brecht und Eisler in der DDR. Zu Benjamin Britten entsteht eine späte innige Freundschaft, die sich in der Widmung der 14. Symphonie niederschlägt.
"Meisengeige"
Seltsam sind die Spuren, die der Komponist in den Erinnerungen von Zeitgenossen hinterlassen hat. So zitiert Lew Kopelew zynisch die öffentliche Meinung: "Schostakowitsch ist natürlich Jude ... Na, vielleicht ist er getauft. Aber seine Musik ist ganz und gar nicht russisch. Die ist kosmopolitisch. Das wissen alle." Nikita Chruschtschow wiederum bekennt fast rührend laienhaft: "Aber wir verstanden Schostakowitsch nicht in einigen konkreten Fragen, etwa wenn er auftrat und ... die Jazzmusik unterstützte."
Ein merkwürdiges Rezeptionszeugnis aber verdanken wir der Lyrikerin Friederike Mayröcker in ihrem Gedicht Meisengeige: "Schostakowitsch / hängt seine Notenköpfe / auf den Hopfenstrauch: / Bierdurst befiel / die Musiker / in Wladiwostok".
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!