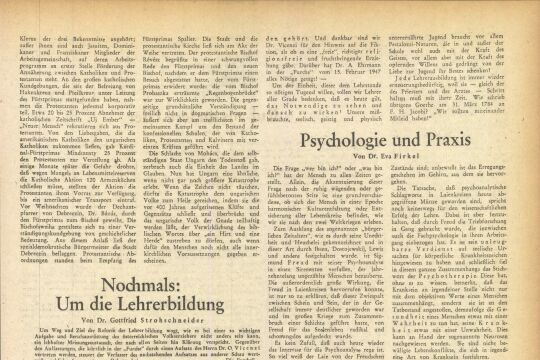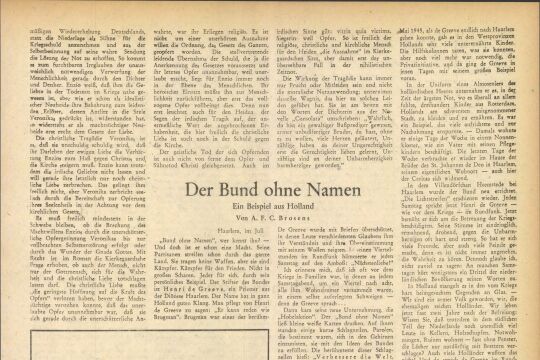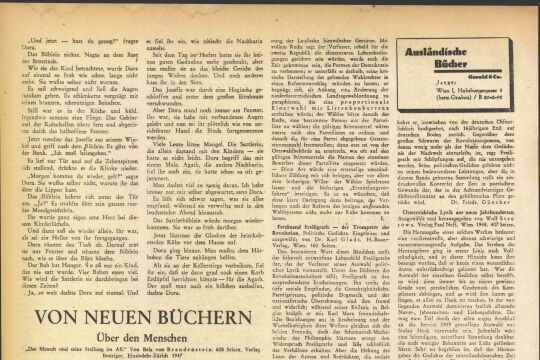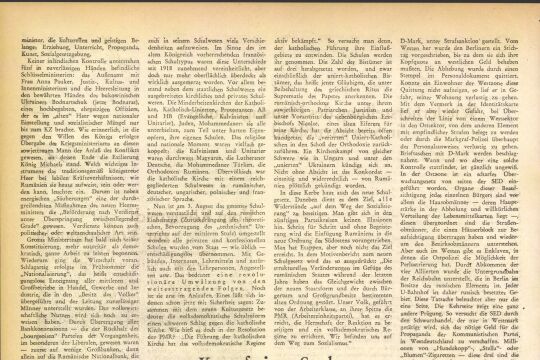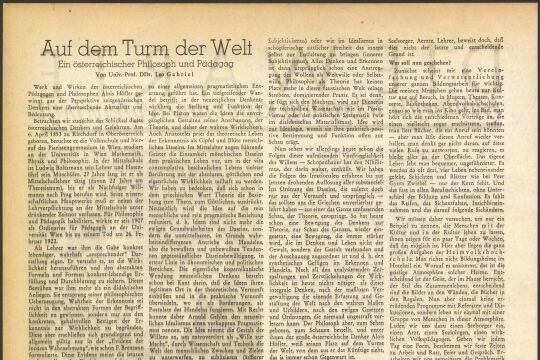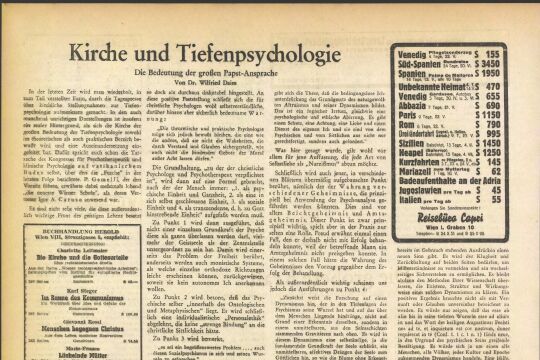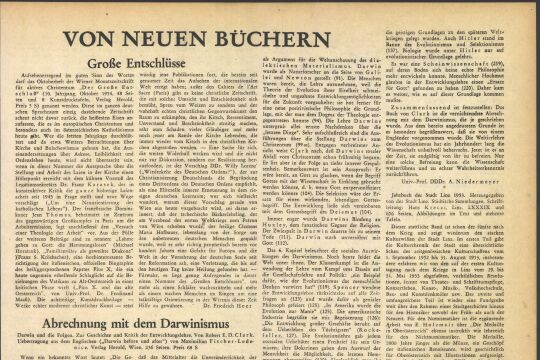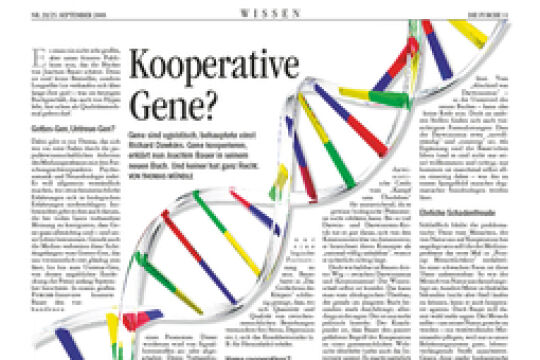Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Deszendenz und Darwinismus
Diese Betrachtung will — dein knappen Rahmen entsprechend natürlich nur in Streiflichtern — zeigen, wie weit sich die heutige Biologie vom „Darwinismus“, diesem seinem Grundgedanken nach nicht ametaphysischen, sondern antimetaphysischen Erklärungsversuch der stammesgeschichtlichen Entwicklung des Organismenreiches, wieder entfernt hat. Der durch Darwins epochemachendes Werk erst zu allgemeiner Anerkennung gelangte Deszendenzgedanke allerdings, das heißt das Abstammungsgeschehen als solches, muß heute als eine ebenso gesicherte Tatsache betrachtet werden wie andere, ebenfalls nicht unmittelbar beobachtbare, aber aus einer Fü.le übereinstimmender Erfahrungen erschließbare naturwissenschaftliche Erkenntnisse, zum Beispiel die Existenz von Atomen. Ob sich dabei die Entwicklung des Menschen über anthropoide Affen (vom Schimpansentypus) und Zwischenformen vom Typus des Neandertalers mit Augenbrauenwülsten und stark fliehender Stirn vollzogen hat, wird heute durch geologisch ältere Schädelfunde ohne die genannten Charaktere ernstlich in Frage gestellt (siehe P. W. Schmidt, Wissenschaft und Weltbild, 2. Jahrgang, 1949). Die Ableitung des Menschen von tierischen Vorfahren bleibt aber davon unberührt und trotzdem unvermeidlich, nur würde im letzteren Falle die Tatsache noch mehr in den Vordergrund treten, daß die Deszendenz des Menschen überhaupt nur als ein Entwicklungsziel verständlich wird, an welcher Tatsache man ec en durch die antimetaphysische Deszcn- denz-„Theorie“ des Darwinismus vorbeikommen wollte.
Die Unzulänglichkeit des Darwinismus liegt schon in seinem — im Titel von „The origin of species by means of natural selection“ (1859) angedeuteten — Grundgedanken. Denn die Erklärung der Entstehung der Arten, das heißt der phylogenetischen Entwicklung des Organismenreiches, durch das von Darwin in den Vordergrund gestellte (wenn auch noch nicht zum alleinigen Erklärungsprinzip gemachte) Prinzip der „natürlichen Auslese“ oder „Selektion“ läuft nicht auf einen ametaphysischen (und insoferne bloß streng „phänomenologischen“), sondern auf einen antimetaphysischen Erklärungsversuch hinaus. Dieses Prinzip will nämlich die Entwicklung (und das heißt Höherentwicklung) des Organismenreiches„ also einen in allen Fällen nur aus dem Walten eines „Subjekts“ erklärbaren, zielstrebigen Prozeß, a posteriori, nämlich durch eine (gar nicht stattgehabte!) Vernichtung alles dessen, was sich nicht (fortschreitend) entwickelt hat, erklären. Der Grundfehler ist also ein erkenntnistheoretischer und ah solcher ein Münchhausenscher Versuch, sich am eigenen Zopfe aus dem Sumpf zu ziehen. Der (unbewußt der menschlichen Soziologie entlehnte!) „Kampf ums Dasein“, den Darwin als Hilfsmotor seiner Selektion eingebaut und zu einem förmlichen Trommelfeuer ständiger Vernichtung gestaltet hat, ist nur eine der vielen Verfälschungen einer unbefangenen (rein „phänomenologischen“) Naturbeobachtung, zu denen diese Theorie (siehe später) verleitet hat. Die (naturgemäß unzähligen) empirischen Gegenargumente gegen die der Selektion zugeschriebene Wirkung lassen sich daher alle auf diesen Grundfehler zurückführen, und ihr überzeugendstes ist wohl der Einwand, daß ja der primitivere Organismus keineswegs unzweckmäßiger gestaltet, das heißt schlechter angepaßt ist als der höhere. Ja, Einzeller, in Sonderheit Bakterien und Virusarten, vermögen zweifellos viel ungünstigere Lebensbedingungen zu überdauern als höhere Organismen, sowie ja auch phylogenetisch ältere Typen durch phylogenetisch jüngere keineswegs durchgehend verdrängt worden sind. Daß das mit der Selektion zum alleinigen Motor der Entwicklung gemachte mer- kantilistische Nützlichkeitsprinzip am unendlichen Formenreichtum — am Schöpferisch-Künstlerischen! — der Natur vollkommen vorbeigeht, sei hier nur nebenbei bemerkt.
Der sich von Lamarcks „Zoologie philo- sophique“ (1809) ableitende Lamarckismus, der die Phylogenese auf die „aktive Anpassung“ der Lebewesen, nämlich auf die bei geänderten Umweltbedingungen eintretende Änderung des Arttypus, zurückführt, ist im Gegensatz zum Darwinismus keine antimetaphysische Theorie. Denn Lamarck rechnet mit einem „Lebensvermögen“, aus dem heraus der Organismus jedes beliebige Organ umzubilden oder neuzubilden imstande ist, was ja naturphilosophisch richtig ist. Rein naturwissenschaftlich versagt seine Theorie, weil sich die im strengen Sinne erst während des individuellen Lebens „erworbenen“ Merkmale als nicht vererbbar erwiesen haben.
Der Darwinismus hat nun geradezu den Blick von der Naturgesetzlichkeit des phylogenetischen Entwicklungsgeschehens abgelenkt, so daß man sich auf die in die Augen springenden Tatsachen einer „gerichteten“ Entwicklung erst in Form schüchterner Einwände gegen die AĮlmacht der Selektion (als vermeintlich einzigen wirklich ametaphysischen Erklärungsprinzips) begonnen hat. Ich erwähne hier nur die (unabhängig von phylogenetischer Verwandtschaft immer wieder auftretenden) „analogen“ Formenreihen, den „ganzheitlichen“ (immer das ganze Habitusbild verändernden) Charakter aller konkret beobachteten Mutationen und aus paläonto- logischem Gebiet das „Irreversibitätsgesetz“ (Dollo) von den nicht umkehrbaren Entwicklungen und das verwandte „biologische Trägheitsgesetz“ von O. Abel. Hieher gehört auch die Zwangsvorstellung durchaus monophyletischer Stammbäume, die für den klassischen Darwinismus unausweichlich war, weil er ja auch die Zwischenformen an den Verzweigungsstellen des Stammbaumes auf die Zufallstreffer individueller (!) Mutationen zurückführen mußte, die durch vollendetere Umweltbeherrschung dem früheren Arttypus durch ihren eigenen, dann zum Zwischenglied gewordenen Typus verdrängt haben sollten. Nun verlangt aber gerade eine solche Zwischenform planvolle („korrelative“) Änderungen des ganzen Organisationstypus, um Zum Ausgangspunkt neuer Systemkategorien (zum Beispiel der aus Reptilien hervorgegangenen Säugetiere) werden zu können. Solche korrelative Änderungen aber sind nur aus einer sich ändernden Formbildungspotenz der Art als solcher, also nur als ein die ganze Art erfassendes Geschehen, und damit weiterhin als ein sicher nicht immer nur auf eine einzige Art beschränkt gebliebenes Geschehen verständlich. Aus diesen Gründen ist zum Beispiel von den Erbbiologen und Rassenforschern L. Tirala („Rasse, Geist und Seele“, 1935) ausdrücklich für polyphyle- tische Entwicklungslinien eingetreten. In jüngster Zeit hat Grünberg („Wiener medizinische Wochenschrift“, 97. lahrgang, 1947), ausgehend von einer sehr beachtenswerten Analyse der im Artbegnff implizit enthaltenen Formbildungspotenzen, dieser Forderung Ausdruck verliehen.
Ich möchte diese Betrachtung mit einem kurzen Ausblick auf die Eigenart und das Tempo der vom Menschen ausgehenden Entwicklung beschließen. Die dem Menschen eignende Freiheitsstufe — tiefer erklärt: die zur Natur- ‘ Wesenheit hinzutretende Geistwesenheit des Menschen — bringt es mit sich, daß die vom Menschen ausgehende Kultur (im weitesten Sinne der Umgestaltung seiner Umwelt) sich in einem ganz anderen Tempo entwickelt als das vormenschliche Organismenreich. Die vom Individuum gemachten Erfahrungen sind für andere Individuen erlernbar und der Mensch kann bei seinen Schöpfungen die gemachten Erfahrungen unmittelbar in Verbesserungen umsetzen. Gerade diese Eigenart der menschlichen Kulturentwicklung hat sich ja auch — unbewußt — sowohl auf den Darwinismus wie auf den Lamarckismus ausgewirkt, indem ereterer das phylogenetische Geschehen auf individuelle Mutationen, letzterer aber auf eine unmittelbare Vererbung individuell erworbener Eigenschaften gründen wollte. Nun finden wir aber gerade dieses vom Lamarckismus den menschlichen Schöpfungsbereichen entlehnte Eilzugstempo :n der vormenschlichen Natur nicht realisiert. Diese ist nicht nur auf eine durchaus art- gebundene Lenkung ihrer Geschöpfe aus dem Unbewußten (über die Gefühlssphäre der Bewußtseinsphänomene) eingestellt, sondern auch ihre Entwicklung vollzieht sich nicht über individuell erworbene Merkmale, sondern über angeborene Mutationen. Andererseits beschränkt sich die Wirkung der Selektion auf die Ausmerzung aller Fehlentwicklungen, also auf den Schutz vor dem Absinken in Degeneration, wobei aber auch an jene wunderbare Angepaßtheit aller Organismen an ihren Lebenskreis, an die Feinmodellierung der „Mikroevolution“ (von Bertalanffy, „Gefüge des Lebens“, 1937) zu denken ist. Dem angedeuteten Tempo der kulturellen Entwicklung des Menschen steht eine relative Konstanz seines somatischen Typus gegenüber, der sich seit den prähistorischen (durch Werkzeuggebrauch gekennzeichneten) Epochen der eigentlichen Menschwerdung zum mindesten nicht mehr wesentlich geändert hat. Daß der Mensch seitdem auch rein biologisch im Organismenreich eine Sonderstellung einnimmt, die durch die von ihm selbst ausgehende Umgestaltung der in seinen „Merkmal-Wirk- mal-Kreis“ eingehenden „Umwelt“ (im Sinne v. Üxkülls) ihr Gepräge erhält, wurde in letzter Zeit durch Gehlen (Berlin, 1940) ausführlich untersucht und gewürdigt. Unabhängig von ihm hat auch unser Wiener Zoologe Otto Storch (Wien, Springer, 1947) diesen Gedanken aufgegriffen; er stellt die sehr bemerkenswerte Überlegung an, daß dem durch „organische“ Vererbung bis in kleinste somatische und psychische Merkmale festgelegten „Phänotypus“ des Menschen ein „Eigentypus“ oder „Ergasto- typus“ (ein erarbeitbarer Individualtypus) gegenübersteht, der den Phänotypus an Wichtigkeit oft weit übertrifft. Ich begnüge mit diesen Andeutungen, die das Bild des weltanschaulichen Einflusses des Deszendenzgedankens auf unsere heutige Biologie in der Richtung ergänzen, daß auch die für di grundsätzliche Stellung der Geisteswissenschaften so eminent wichtige Berücksichtigung der menschlichen „Stufe“ als einer über das bloß Biologische hinausgehenden Gegebenheit heute auch von der Biologie nicht mehr übersehen wird.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!