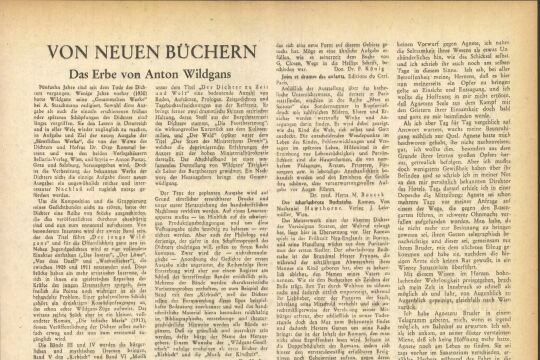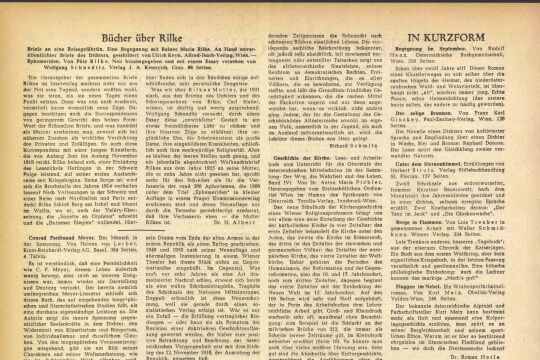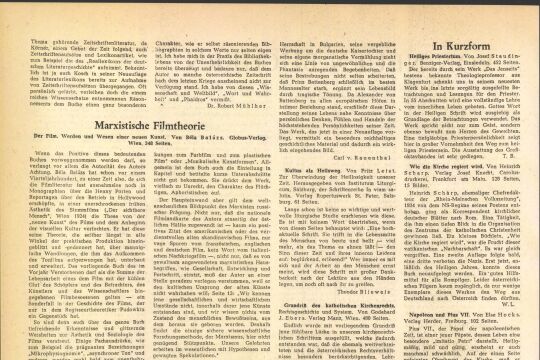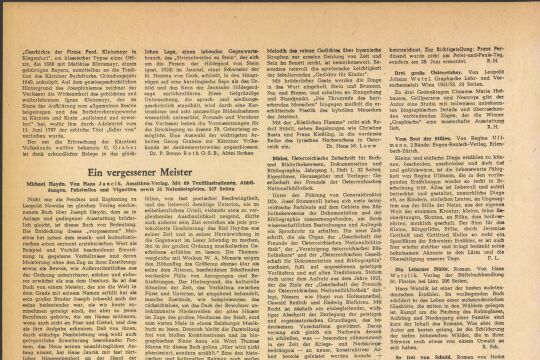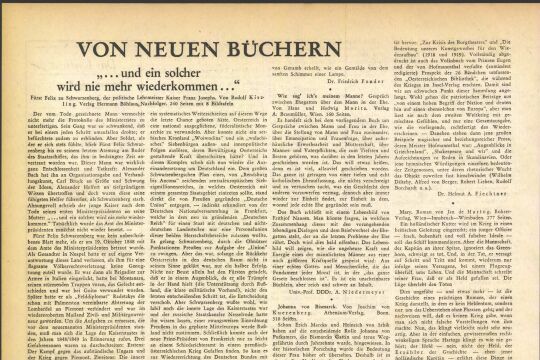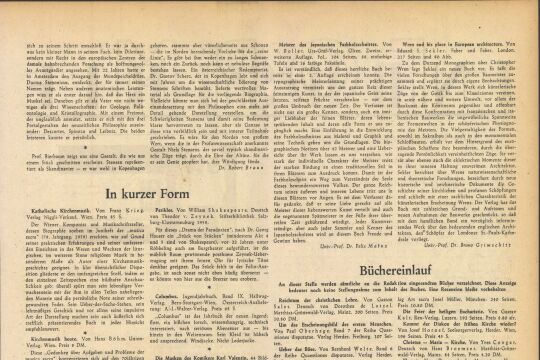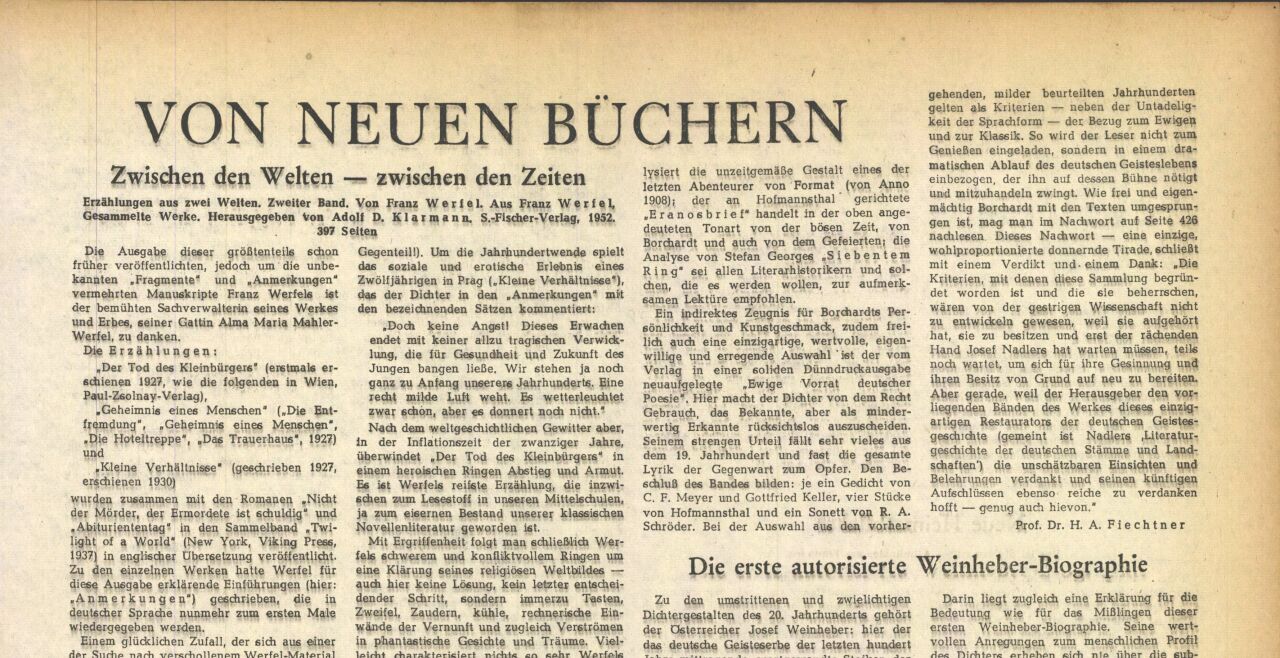
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die erste autorisierte Weinheber-Biographie
Zu den umstrittenen und zwielichtigen Dichtergestalten des 20. Jahrhunderts gehört der Österreicher Josef Weinheber: hier der das deutsche Geisteserbe der letzten hundert Jahre mittragende, wortgewandte Stoiker, der Schopenhauer-Adept, der sich schließlich zum klassischen Humanitätsgedanken, zu einem von Nietzsche und George gleichermaßen beeinflußten, tragisch-heroischen Idealismus und hohem Form- und Wortkult durchrang; auf der anderen Seite der kleine Postbeamte, der — aus jenen Schichten stammend, wo sich das Kleinbürgertum bereits mit den Massen des Proletariats mischt — im Österreich der zwanziger Jahre, ungehört und unverstanden blieb und sich dann vom Nationalsozialismus als Aushängeschild benützen ließ. Im Mai 1945 machte Weinheber seinem Leben freiwillig ein Ende. Er wäre sonst im vergangenen Jahre sechzig Jahre alt geworden. In der Auseinandersetzung der folgenden Jahre wurde dann verständlicherweise die Gestalt Weinhebere in jenen Raum hineingedrängt, in dem die Tagesdiskussion das Kunstwerk überschattet und manchmal bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Es ist heute in doppelter Hinsicht eine Notwendigkeit, das Werk und das Schicksal Josef Weinhebers nicht einer dubiosen Dunkelheit zu überantworten auf dem Gebiet der Literarhistorie ebenso wie im Bereich der menschlichen Wertungen.
Nach dem bedeutenden Kapitel, das Reinhard Piper im zweiten Band seiner Lebenserinnerungen „Nachmittag“ einer Begegnung mit Weinheber widmete, liegt nun eine weitere Studie vor. Wie es im Ankündigungsblatt des Verlages heißt, handelt es sich hier um die erste, „von der Witwe des Dichters autorisierte Biographie“. Sie stammt von dem österreichischen Schriftsteller Edmund Finke, Herausgeber der Zeitschrift des Wiener Dichterkreises „Der Augarter “ und Verfasser literarkritischer Aufsätze und einer Reihe von Detektivromanen. („Josef Weinheber, Der Mensch und das Werk“, Salzburg, Köln, Zürich 1950, Pilgram-Verlag, 280 Seiten.) Selbst langjähriger und intimer Freund des Dichters, der zwanzig Jahre hindurch in enger Verbindung mit ihm lebte, will er offensichtlich über den Versuch einer Rehabilitation Weinhebers hinaus ein Treuebekenntnis zu seinem Wortführer ablegen.
Darin liegt zugleich eine Erklärung für die Bedeutung wie für das Mißlingen dieser ersten Weinheber-Biographie. Seine wertvollen Anregungen zum menschlichen Profil des Dichters erheben sich nie über die subjektive Sphäre. Aus der gleichen subjektiven Perspektive läßt er Sachlichkeit und Distanz zugunsten eindeutiger, aggressiver Stellungnahme außer acht. So fehlt der nötige Abstand zu der Person des Dichters wie zu seinem Werk: um so bedauerlicher, ak das umfangreiche lyrische Werk Weinhebere auffallend unregelmäßig in der Qualität ist: epigonal-bedeutungslose Lyrik findet sich neben solcher von beinahe vergleichsloser Ausdruckskraft und einer Prägnanz des Gedanklichen, wie si’e seit Schillers Gedankenlyrik kaum erreicht worden ist. Das lyrische Werk Weinhebers bedürfte dringend einer kritischen Sichtung. Möge in absehbarer Zeit eine strenge Auswahl bleibenden Wertes vorgelegt werden.
Finke distanziert sich a priori von den Methoden der fundierten Literaturkritik und stellt zwei Thesen auf, die er dann auf 280 Seiten verficht: er macht Josef Weinheber zum Protagonisten der Dichtkunst der letzten 50 Jahre schlechthin und schreibt — der deutschen Frühromantik hädenklkh. angenähert — die „göttliche Berufung des Dichters“ als Seher und Prophet als einzigen Wahlspruch auf das Panier des Kritikere. Gleichzeitig wird das aktuelle Moment in die Beweisführung einbezogen, wenn das orphische Wesen des Dichtere gegen das „verderbte, verlorene, ungeistige 20. Jahrhundert“ ausgespielt wird.
Obwohl unbefriedigend, ist der erste Teil der Biographie über den Menschen Weinheber in seinem warmen, persönlichen Ton noch der reizvollste; doch fehlt auch hier die kritische Deutung des inneren Phänomens und der äußeren Problematik, besonders was Weinhebers wirkliche Stellung zum Nationalsozialismus angeht, die bisher noch nicht ernsthaft untersucht wurde.
Die Werkanalyse, die den zweiten und dritten Teil des Buches ausmacht, vernachlässigt, wie gesagt, die wissenschaftlich-kritische Aufgabe. Außer gängigen unfundierten Wein- heber-Interpretationen findet sich kaum etwas Neues. Ein ganzes Kapitel ist dem höchst fragwürdigen und abwegigen Vergleich mit Hölderlin gewidmet.
Heilige Maskerade. Roman. Von Olav Hartman n. Verlag der „Frankfurter Hefte“, Frankfurt a. M. 153 Seiten.
Der schwedische Pastor Svensson, ein liberaler Protestant, dessen Denken durchsetzt ist von Rationalismus, glaubt im Grunde seines Herzens nicht mehr an jenes Christentum, das die Bibel enthält und das er Sonntag für Sonntag von der Kanzel verkündet. Für ihn ist der Inhalt der Heiligen Schrift nur mehr symbolischer Gehalt. Seine Frau, abgestoßen von dieser Haltung, will ihn dieser „Maskerade“ entreißen. Nicht, um zum Christentum zurückzufinden, sondern um endgültig zum Heidentum zu gelangen. In „heiliger Maskerade“ setzt sie sich mit den Personen der Hl. Schrift gleich und beginnt von diesem Standpunkt mit ihrem Manne die Auseinandersetzung. Mit’ der Wirkung, daß sie nicht nur ihren Mann tatsächlich entlarven kann, sondern daß sie den Weg zum Christentum zurückfindet.
Dies ist in Kürze der Inhalt des Romans, der in Tagebuchform gehalten ist. Ein bedeutendes Werk, eine Art evangelisches Gegenstück zu Bernanos’ „Tagebuch eines Landpfarrers“, und zu den vielen Priesterromanen auf katholischer Seile. Doch während bei den katholischen Romanen der Akzent fast durchwegs auf dem Problem „Amt und Person“ liegt, so bei diesem evangelischen Roman auf dem Problem „Heilige Schrift: Gottes Wort oder Symbol“. Der Roman hat in seiner Heimat viel Aufsehen, ja teilweise Ärgernis erregt, wahrscheinlich, weil er viele Leser zu einer EntScheidung zwang. Es ist ein großes Verdienst der „Frankfurter Hefte“, dieses Werk, das sich völlig ebenbürtig den Dichtungen eines Greene, Bernanos, Queffelec zeigt, in deutscher Übersetzung herausgebracht zu haben.
Valentina. Roman von Bonaventūra Tee- c h i. Amandus-Verlag, Wien, 1952, 302 Seiten.
Der für die Vermittlung fremder Literatur dankbare Leser wird die flüssige deutsche Übersetzung des neuen Werkes eines erfolgreichen italienischen Romanciers mit Interesse lesen. Bonaventūra Tecchi, heute sechsundfünfzig Jahre alt, hat sich durch meisterhafte Darstellung der jugendlichen Psyche und durch lebhafte Auseinandersetzungen mit den allgemeinen Problemen der Gegenwart einen Namen gemacht. Als Professor der Germanistik in Rom bemüht er sich um das Verständnis seiner Landsleute für die moderne deutsche Literatur, eine Reihe vorzüglicher Übersetzungen stammen von ihm.
Seine „Valentina“ nun ist das zarte, farbige Bild eines jungen Mädchens von früher Kindheit bis zum sechsundzwanzigsten Lebensjahr. Als Gymnasiastin stürzt sie in das ungeheure Liebeserlebnis, das sie an einen Gleichaltrigen bindet. Er stirbt in russischer Kriegsgefangenschaft. Valentina, nach einem Selbstmordversuch, verfolgt mit wachsender Anteil-nähme die Arbeiten ihres Onkels, der sich in Brünn der Geschichte des Spielbergs zugewandt hat — des einstigen Kerkers zahlreicher bedeutender Italiener des Risorgimento. Sie lernt einen jungen italienischen Diplomaten kennen und das Leben siegt, sie wird seine Frau.
Die an sich dünne Handlung bildet das Podium für die Auseinandersetzungen mit der Seele der Kriegs- und Nachkriegsjugend. Tecchi geht manchmal in seiner Offenheit recht weit. Allein Takt und Künstlertum behalten die Oberhand.
Zwei ohne Gnade. Roman. Von Hubert Mum eit er. österreichische Verlagsanstalt, Innsbruck. 303 Seiten.
Als dieser historische Roman, der von der verhängnisvollen Liebe des Minnesängers Oswald von Wolkenstein zu Sabina Jäger handelt, den Kampf Tirols um seine staatliche Selbständigkeit zur Zeit des Konstanzer Konzils sowie die Erhebung des Bürgertums gegen die erbeingesessene Ritterschaft schildert, vor zwanzig Jahren erschien, fand dieses Werk nicht nur besondere Beachtung in literarischen Kreisen, sondern auch eine breite Leserschaft, denn Mumelter erwies sich als Erzähler von bezwingender Eigenart, der verborgenen Seelenregungen nachzuspüren, sie glaubhaft darzustellen und dabei mit kraftvoller Sprache dem bewegten Geschehen Farbe und Leben zu geben vermag. Deshalb ist die Neuauflage dieses Werkes wärmstens zu begrüßen.
Die blinden Spiegel. Roman. Von Alex du Frenes, Verlag Kiepenheuer u. Witsch, Köln 1951. 218 Seiten.
Der Einbanddeckel weist Masken. Und Masken trägen viele Menschen dieses Erstlingswerkes. Was es höchst anziehend macht: der Zeitton (besonders Nürnberg zur Zeit des Prozesses): Farbe und Licht, an Monet und Renoir gemahnend: Aussparen von Handlungsteilen — einesteils die Phantasie des Lesers anregend, anderenteils freilich eine schlüssige Erklärung für das Handeln der Schauspielerin Gloria und des Obersten Fabrice Le Roux schuldig bleibend. Was bedenklich anmutet: die charakterliche Haltung der Hauptpersonen. Uber jedem Gefühl muß das sittliche Gesetz stehen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!