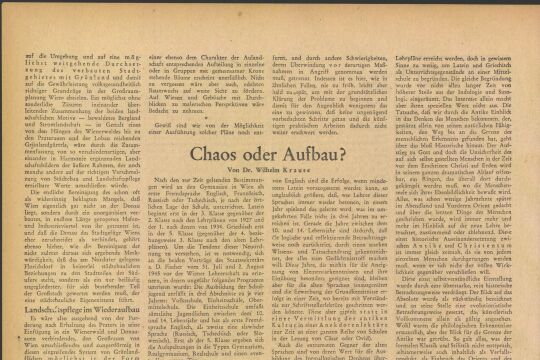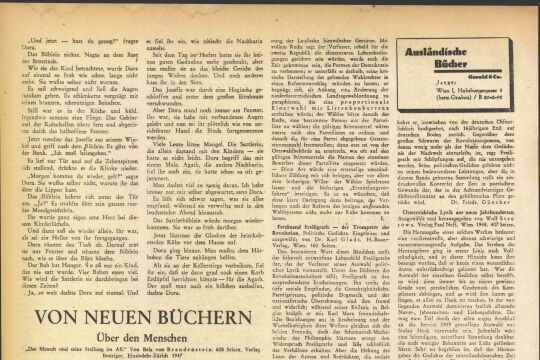Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Keine Angst vor Latein
Zufällig las ich eben wieder die Stelle der „Buddenbrooks“, in der Thomas Mann zweifellos alle Ablehnung gegen einen ehemaligen Lateinlehrer, alle Abneigung gegen ein altes Schulsystem hineinlegte: die Ovidstunde bei Dr. Mantelsack.
Und das wirft die Frage auf, wieweit heute noch solche Mantelsack-Furcht besteht, ja, berechtigt ist, ob da und dort noch so ein „Mantel' sack“ unter uns lebt, Furcht und Schrecken unter der Jugend verbreitet und sie mit der Knute unerbittlicher und harter Strenge zwingt, mit dem Mut der Verzweiflung „vom goldenen Zeitalter“ zu lesen, „das ohne Rächer freiwillig Treue und Recht pflegte“.
„Das Hauptübel, an dem der deutsche Satzbau noch leidet, zumal bei Gelehrten, aber auch bei Männern der Zeitungen, ist der zumeist an der Lateinschule eingesogene Wahn, daß das in der lateinischen Sprache herrschende Stimmgesetz der Unterordnung und Einschachtelung auch unserer Muttersprache wohl anstehe. Was aber die auf der Hochschule Gebildeten tun, das ahmen die meisten Berichterstatter nach, als ob sie erst dadurch auf die Höhe jener Bildung kämen, während solche Sätze vielmehr ein Zeichen der Ver-bildung sind ...“
Diese Worte stammen nicht etwa aus der unmittelbaren Gegenwart, die reich ist an scharfen Vorwürfen gegen die „verbildenden Einflüsse“ des Lateinischen auf die Muttersprache: Theodor Matthias sagt es bereits 1892 — und noch unverändert in der VI. Auflage seines Buches „Sprachleben und Sprachschäden“, 1926! Mochte seine Anklage noch für die Jahrhundertwende Geltung haben, als noch — was zum Beispiel deutsche Tacitus- oder Caesar-Ubersetzungen dieser Zeit in üppigster Auslese nachweisen — lateinische Subordination, lateinischer Satzrhythmus und Numerus und lateinische Partizipalkonstruktionen den deutschen Ausdruck prägten; so hat sich seither doch manches geändert, da eher psychologische Rücksicht auf stilistische Spracheigen-art das Maß sprachlicher Genauigkeit bestimmt.
Mag sein, daß da und dort noch humanistische Sprachdiktatur Einfluß übt; Gesetz ist das heute nicht mehr, allein schon deshalb nicht, weil jetzt — zumal im neuen Schulgesetz verankert — dem Lateinunterricht bei weitem nicht mehr die reiche Stundenfülle von einst zur Verfügung steht Unsere Lateinschüler kommen kaum noch zu dem innigen Kontakt mit der Originalsprache, der eine „stilistische Infektion“ überhaupt bewirken könnte. Wollen wir aber der vorwiegend utilitaristischen Wertung der ausgesprochenen Lateingegner und den von alten Ideologien geleiteten Urteilen der Verfechter humanistischer Bildung maßvoll begegnen, dann leite uns vor allem der ständige Blick auf die dienende Funktion der lateinischen Sprache; sie läßt durch die von der Grundschule an mit äußerster Disziplin gepflegte und geübte „Schau auf das Ende“ („respice finem!“) mit der Zeit Freude am logisch vorgeformten Gedanken gewinnen.
Darin sollte auch der Hauptwert lateinischer Erziehung für die Moderne liegen: in der Erweckung der Lust am Gestalten klarer, logisch übersichtlicher Sprachgebilde und später am freudvollen Erfassen fertiger Gestalten und ihrer widerspruchsfreien Wiedergabe in angemessener muttersprachlicher Form. Es ist interessant, daß gerade der Lehrplan für die bisherige österreichische Lehrerbildungsanstalt — und auch für ihren Nachfolger, das musisch-pädagogische Realgymnasium — diesen Wert des Lateinunterrichts für die Muttersprache mit folgender Forderung am besten ausspricht:
.Festigung und Vertiefung der Kenntnisse und Steigerung der Ausdrucksfähigkeit in der Muttersprache durch möglichst vollkommene Verdeutschung der lateinischen Texte. Gelegentliche serreichende Betrachtung des Satzbaues und Sprachgebrauches im Lateinischen und im Deutschen, wie auch in der lebenden Fremdsprache.“
Wenn Deutschlehrer heute noch vielfach in Bausch und Bogen die „verbildenden Einflüsse der lateinischen Sprache auf die Muttersprache“ verurteilen, dann nur aus der schrägen Sicht, als ob für den Lateiner noch immer das klassische Latein allein Richtlinie für deutschen Stil und Ausdruck wäre, als ob dessen Satzbildung und Satzrhythmus allein die deutsche Schriftsprache prägen dürften und der Wert einer Übersetzung lediglich nach dem Grad der „Wörtlichkeit“ zu bemessen wäre.
Diese Übersetzungsmethode aber ist seit langem überholt und wird schon seit der Jahrhundertwende heftig bekämpft.
Wir haben heute — geschult durch die Erfahrungen radikaler Stilumbrüche und geläutert durch die Erlebnisse rauher Unmittelbarkeit — jene Sicht gewonnen, die uns befähigt, aus der Nüchternheit der „Sprache der verwalteten Welt“ (Korn) doch wieder den Anschluß zu suchen an syntaktische Vollkommenheit, an rhythmischen Wohlklang — und — wo es den psychologischen Voraussetzungen, den innersten psychischen Bedingungen, der Angemessenheit der inneren Form entspricht —, sogar an eine maßvolle Architektonik der Periode. Allerdings darf sie nicht gewollt gekünstelt sein, sondern muß stets den innersten Gesetzen des persön-: liehen Ausdruckswillens gehorchen. Diese sprachlichen Bestrebungen sind heute nicht tot; sie leben weiter und werden heute wieder gründlich und erschöpfend, aber „ohne Marter und Qual“ gelehrt
Hier also liegt der tiefere Sinn lateinischer Spracherziehung auch für das Deutsche, daß man den jungen Menschen in allen Entwicklungsstufen, in denen er den „Schrecken des Lateinunterrichtes ausgesetzt“ wird, immer wieder die Überzeugung erobern läßt, daß diese Erziehung seinem Besten dient und daß dieses „Spiel“ mit glasklaren formalen und syntaktischen Gebilden stets auch ein „Training“ ist — aber ein Training sprachlicher Denkschärfe.
Wie aber steht es mit der „Folterung“ der Jungen durch die langen Livianischen Perioden?
Die historische Periode eines Li-vius soll vor allem dem Zweck dienen, den Lateinschülern den Sinn für das Erfassen großer logischer Zusammenhänge im Rahmen eines übersichtlichen Hauptgedankens zu schärfen, sie in die Architektur eines Satzgefüges einzuführen, deren Zusammenhalt durch die lebendigen Spannungsverhältnisse von Hauptgedanken und vorbereitenden und begleitenden Nebengedanken gegeben ist. Man sage nicht, daß diese Arbeit, methodisch richtig gehandhabt, verbildend wirkt! Im Gegenteil — durch die ständige Einsicht in die Satzwerte, in den spannungsgeladenen Zusammenhalt mit dem Hauptgedanken, erlebt der Schüler jenes Wunder logischer Ganzheit-lichkeit des Satzes, das schon Wundt einst so definiert hat: „Der Satz ist kein punktuell durch unser Bewußtsein laufendes Gebilde, von dem immer nur ein Wort oder gar ein einzelner Laut in diesem momentan existiert, während Vorangegangenes oder Nachfolgendes in Nacht versinken, sondern solange er gesprochen wird, steht er als Ganzes im Bewußtsein.“
Es ist eine Vertiefung jenes Erlebnisses des Ganzen, das schon — wie bereits einleitend gesagt wurde — im Elementarunterricht des Lateinischen durch das ständige „respice finem!“, durch das fortwährende Arbeiten mit komplexen, einander sauber zugeordneten Gebilden fruchtbar für die gesamte Sprachlogik und also vor allem auch für die Muttersprache wird.
Ganz anders verhält es sich bei der unmittelbaren Formschulung durch die oratorische Periode, deren großer Lehrmeister Cicero ist und die mit ihrem ganzen kunstvollen Aufbau den Inhalt steigert, die Form bildet und in keiner Weise verbildet — wenn sie nicht aufgezwungen wird. Die praktische Arbeit zeigt uns immer wieder, daß die Lektüre von Cicero-Reden gegenüber anderen Prosawerken mit großer Begeisterung aufgenommen wird, daß seine stilistischen und rhetorischen Figuren Interesse erwecken — selbst bei Schülern, die sonst nicht gerade sehr ansprechbar für die Schönheit klassischen Ausdrucks sind. Wenn man die Hinweise auf die Schönheit der Komposition nicht übertreibt, erleben die jungen Menschen den eigenartigen Zauber des sprachlich' Verbindenden, der rein psychischen Emotion des Ausdrucks, die eben in gehobener Kultursprache allgemein ist Sie erkennen, daß die Übertragung in die Muttersprache nicht Übersetzung schlechthin ist, sondern organische Aufnahme von Form und Rhythmus, und sie erleben zugleich auch, daß jedes Übermaß der oratorischen Periode den Gehalt zerstört, die innere Dynamik schwächt und das Pathos abstumpft.
Warum also Angst vor dem Lateinlehrer, warum Angst vor dem Lehrer überhaupt! Wie im Deutschunterricht — und letztlich in allen kunsterziehenden Fächern! — müssen auch im Lateinischen alle Formelemente so an die Reifenden herangetragen werden, daß sie diesen Akt nicht als Zwang, sondern als eine Art freier ästhetischer Wahl empfinden. Unter diesem Aspekt aber ist die lateinische Prosa in ihren wertvollsten Vertretern durchaus imstande, positive, formbildende Werte zu schenken und formsteuernde Kräfte lebendig auszustrahlen. Daß die zugrundeliegende strenge Gesetzlichkeit grammatikalischer Forderungen am Beginn für die Bildung des Sprachcharakters erzieherisch wertvoll ist, kann niemand bestreiten; daß die stilistische Ausformung der rhetorischen Prosa in methodisch richtiger Führung auch der Muttersprache manch Gutes schenkt und damit auch der reifenden Jugend viel Freude bereiten kann, sollte erwiesen werden.
Und daß romanisches Formgefühl und strenge Gesetzlichkeit zur höchsten Vollendung auch des modernen dichterischen Ausdrucks zu führen vermögen, hat — neben vielen anderen Dichtern der Gegenwart — Josef Leitgeb (1897 bis 1952) mit seinem eigenen Werk erwiesen, jener Dichter, der — wie Adalbert Schmidt sagt — „sich schon als Knabe für Latein begeisterte und seine Vertrautheit mit dieser kristallklaren Sprache zu echten Begegnungen mit dem Geist des Südens zählte ... Die lateinische Sprache mit der Architektonik ihrer Syntax war ihm die Lehrmeisterin für das gegenständliche Deutliche, für die Dinglichkeit der Darstellung, für die Taghelle seines Ausdrucks.“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!