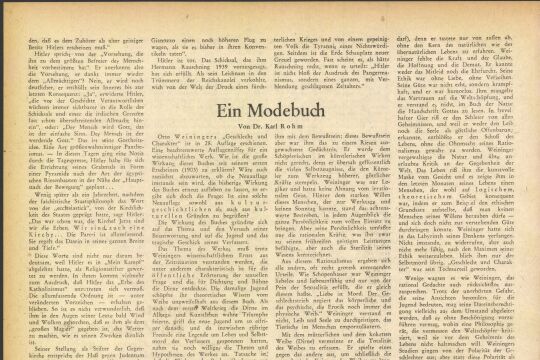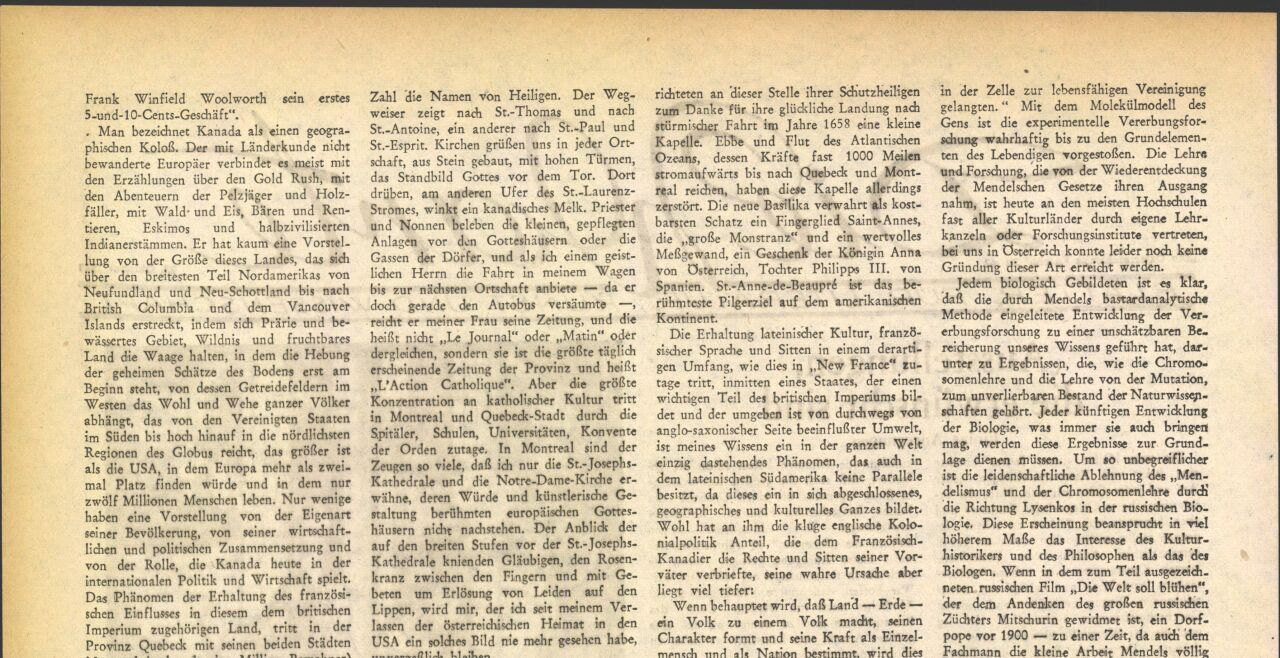
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Operndramaturgie
Wilhelm Heinrich Riehl hat einmal von der „Kriegsgeschichte der Oper" gesprochen und Oskar Bie beginnt sein umfängliches Buch von der Oper gar mit der Feststellung, sie sei ein „unmögliches Kunstwerk". Beide Ausdrücke sind nichts anderes als eine äußerste Verdichtung der Problematik, die dem musikalischen Bühnenwerk von eh und je anhaftet, in dem darstellende Kunst, Dichtung, Musik und Bild zur Einheit des Gesamtkunstwerks streben, gleichzeitig aber doch jede ihre Eigengesetzlichkeit wahren und durchsetzen möchte. So entsteht eine Labilität, die zwischen den Extremen der absoluten Vorherrschaft des dichterischen Elements einerseits und des musikalischen andererseits hin- und hergerissen wird, ab und zu auch einmal das Bildhafte, die Ausstattung, in den Vordergrund drängt, im übrigen aber alle Zwischenstufen durchläuft, die sich nur denken lassen. Ein wirklicher Ausgleich wurde bisher nur in seltenen Fällen erreicht, immerhin aber nicht nur vom Dramatischen her — bei den drei großen „Musikdramatikern“ Monteverdi, Gluck und Wagner —, sondern auch in den Spitzenleistungen der Oper im engeren Sinn, wie etwa bei Mozart, von der Musik her. Wir erinnern uns an Gluck, der bei der Komposition seiner Reformopern sich bemühte, zu „vergessen, daß er Musiker sei“ — und es dennoch in ganz eminentem Maße blieb, und denken wieder an Mozart, der forderte, daß in der Oper „die Poesie der Musik gehorsam Tochter“ sei und gleichwohl von einem dramatischen Instinkt sondergleichen geleitet wurde.
Die ästhetische Theorie ist nicht in der Lage, aus diesen Tatsachen ein bindendes Gesetz abzuleiten, ihr bleibt nur übrig, einen ständigen Kriegszustand festzustellen oder zum Paradoxon Zuflucht zu nehmen, das für unmöglich erklärt, was in unterschiedlichsten Abwandlungen seit dreieinhalb Jahrhunderten auf den Opernbühnen seine Möglichkeit erweist und in einer beispielhaften Auswahl zu unseren schönsten abendländischen Kulturgütern zählt. Es kann demnach nicht verwundern, daß wir auch keine praktische Handwerkslehne, keine gültige Dramaturgie der Oper besitzen. Für das dramatische Kunstwerk im engeren Sinne, sei es ernsten oder heiteren Charakters, konnte eine grundsätzliche Norm des Aufbaues aufgestellt werden, die, wenn auch in Varianten, verbindlich bleibt, weil sie einem ästhetischen Gesetz entspricht, die aber für das musikalisch-dramatische Werk so wenig gilt, daß man erfahrungsgemäß sagen kann, j vollkommener ein dramatisches Werk als solches sei, desto ungeeigneter sei es für die Oper. Es liegt das, abgesehen von der Zusammengesetztheit des musikdramatischen Werkes, in erster Linie daran, daß in ihm das Schwergewicht auf der Ebene ‘der Empfindungen, des Gefühlsmäßigen, liegt, im gesprochenen Drama hingegen im Gedanklichen. Was die Dramaturgie der Oper anlangt, so besitzen wir wohl Zeugnisse und Bekenntnisse großer Schaffender, die zwar als grundsätzlich gedacht waren, aber immer wieder ihre fast rein persönliche Gültigkeit erwiesen haben, mag man nun an die Vorreden Glucks zu den Partituren seiner Reformopern denken oder an die Schriften Wagners und Pfitzners zu den Problemen der Operndichtung und Opernkomposition. Auch die zur Sache vorliegenden Einzeluntersuchungen ergeben, daß letztlich jeder große Opernkomponist seine eigene Dramaturgie hatte, an der die Epigonen zuschanden wurden. Dazwischen macht sich immer wieder, wie in der neapolitanischen Oper, ein Schematismus und Manierismus geltend, der e contrario, das heißt an seiner Unfruchtbarkeit nicht weniger wie das Epigonentum die Richtigkeit der Behauptung bezeugt, daß es keine allgemeingültige O pe r n d r am at ur g i e gibt und daß das musikdramatische Meisterwerk vielleicht mehr als jedes andere immer erneut einzig und allein nur dem genialen schaffenden Geist und seiner Selbstherrlichkeit entspringt.
Nach dem ersten Weltkrieg, in einer Krisenzeit des Theaters ähnlich der jetzigen, erhoben sich nicht wenige Stimmen, die die Problematik der Oper kurzerhand damit abtun wollten, daß sie die ganze Kunstgattung überhaupt für überlebt und tot erklärten. Dieser Pessimismus hatte seinen Grund lediglich darin, daß es an neuen, „zugkräftigen" Werken fehlte, die die Scharen des Publikums in die Opernhäuser gelockt hätten, so daß vorübergehend, wie schon einmal zu Händels Zeiten, die politisch gewürzte Persiflage der „Dreigroschenoper“ triumphieren konnte. Gleichwohl waren und blieben aber die Komponisten am Werk, und wer einiges Fingerspitzengefühl hatte, der konnte spüren, daß die Oper keineswegs tot war, sondern daß sich in vielfältigen Bemühungen neues Leben regte und zu neuen oder doch erneuten und erneuernden Gestaltungen drängte. Die damals eingeleiteten Entwicklungen sind auch heute noch im Fluß und lassen nun klar erkennen, daß es sich dabei nicht nur um die periodisch bedingte Ablösung musikdramatischer Tendenzen durch opernhafte handelt, sondern um eine noch tiefer greifende Wandlung der Anschauungen vom Wesen des musikalischen Bühnenwerks. Die Öffentlichkeit steht im allgemeinen diesen Dingen mit Befremden gegenüber, ist sie doch in ganz bestimmten Vorstellungen über „Bühnenwirksamkeit“ und „Dramatik“ befangen, und sieht sich nun Werken gegenüber, die mit den gewohnten Maßstäben nicht zu messen sind.
Schon im Schaffen der Generation von Debussy, Richard Strauß und Pfitzner finden wir die Prizipien Wagners nicht nur zu Ende gedacht, sondern an einen entscheidenden Umschwung herangeführt. So ist die Lyrik von Debussys „Pelleas und Melisande“ zugleich letzte Konsequenz wagnerischer Grundsätze und bewußte Abkehr von ihnen. Ähnliches vollzieht sich auf einer anderen Ebene bei Strauß in den „symphonischen Dichtungen mit obligater Bühne" der „Salome“ und der „Elektra“, denen im „Rosenkavalier" und in der „Ariadne“ der Umschwung zum Klassizistisch-Opernhaften folgt. Im gleichen Sinne verläuft die Schaffenskurve Pfitzners von der dramatischen Legende „Der arme Heinrich“ zu der ganz lyrischen „Rose vom Liebesgarten" und dem edlen bühnensymphonischen Triptychon des „Palestrina“, der in Hindemiths „Mathis der Maler", ein jüngeres Gegenstück finden sollte. Von dieser symphonischen Bühnen- sonen über 65 Jahren bei ihnen geringer, der Anteil der Personen von 14 bis 65 Jahren dagegen höher war als bei den Einheimischen, während für die Kinder unter 14 Jahren die Relationen bei beiden Gruppen annähernd gleich waren. Die altersmäßige Struktur der Gesamtbevölkeruing ist jedenfalls durch die Flüchtlinge insgesamt günstig beeinflußt worden, wobei starke regionale Unterschiede diesen Umstand leicht zu verdunkeln vermögen.
Am stärksten belastet sind die Landgebiete, in die der Flüchtlingsstrom zunächst gelenkt wurde, die aber, auf lange Sicht gesehen, keine ausreichenden Möglichkeiten zur Eingliederung der Zugewanderten in den Wirtschaftsprozeß besitzen und daher die leistungstüchtigen und vorwiegend die männlichen Flüchtlinge in zunehmendem Maße an die städtisch-gewerblichen Gebiete verlieren. Die hauptsächlich vom Standpunkt der Wohnraumbeschaffung, nicht aber unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten vorgenommene Verteilung der Zuwanderer — soweit nicht überhaupt Willkür obgewaltet hat — bewirkt, daß die negativen wirtschaftlichen Folgen des Flüchtlingszustroms im ganzen noch überwiegen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!