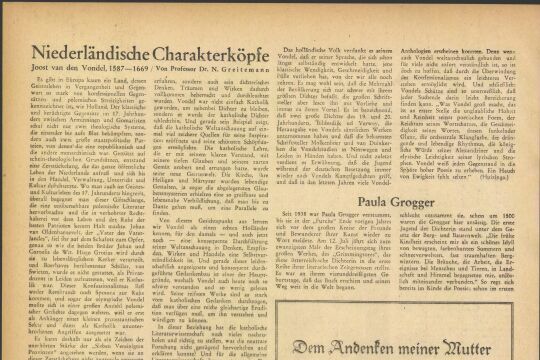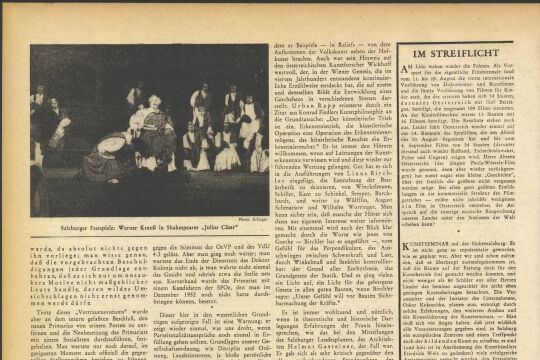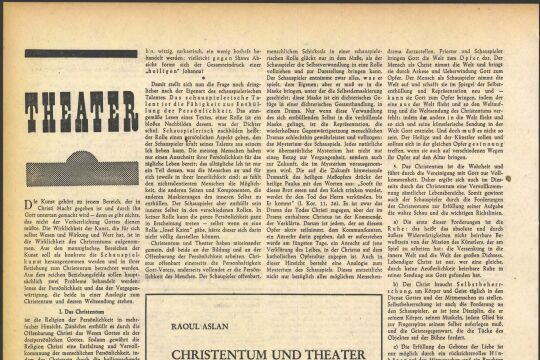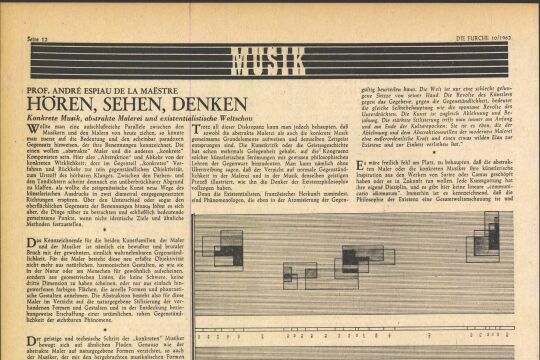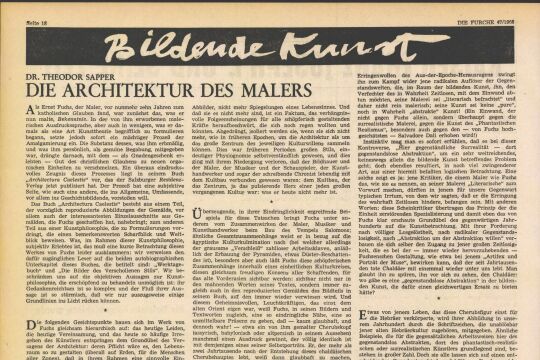Die Frage „Was ist Kunst?“ oder die ihr fast gleichkommende „Was ist ein Kunstwerk“ ist ebenso oft gestellt wie beantwortet worden und drängt sich dennoch bei jeder Gelegenheit wieder auf. Man braucht nur in eine Ausstellung zu gehen und eine Reihe von Bildern oder Plastiken daraufhin zu prüfen, warum uns das eine Werk gefällt, das andere weniger zusagt, um gewahr zu werden, wie schwer es ist, einen richtigen Maßstab für ein wohlbegründetes Urteil zu finden. Gilt das Bild als Kunstwerk, das der Natur am nächsten kommt, sie am besten zu kopieren versteht, oder jenes, an dem uns die persönliche Ausdrucksweise des Künstlers mehr fesselt als der Gegenstand der Darstellung? Haben wir uns bei Betrachtung eines Bildes oder Bildwerkes von objektiven oder subjektiven Gesichtspunkten leiten zu lassen? Ist beim Kunstwerk der Inhalt der Darstellung wichtiger als die Form, in der uns der Gegenstand dargeboten wird, oder kommen noch andere Kriterien in Betracht?
Es gibt bekanntlich eine Wissenschaft, die sich ausschließlich mit den Problemen des Künstlerischen befaßt, und das ist die Ästhetik oder — wie man sie früher nannte — die „Lehre vom Schönen“. Der Schönheitsbegriff bildete bis ins 19. Jahrhundert den Kardinalpunkt der Ästhetik, von der jeweiligen Auffassung dieses Begriffes hingen die Normen ab, mit denen man die praktische Kunstübung in bestimmte Bahnen zu lenken versuchte. Als der Begründer der normativen Ästhetik kann P 1 a t o n gelten, der die Idee des Schönen mit der des Guten verband und darum in seinem Idealstaat nur solche Kunstwerke anerkannte, die eine moralische Tendenz aufwiesen. Zugleich aber lehrte er auch, daß Kunst „Nachahmung der sinnlichen Erscheinung“ sei, und bewirkte dadurch, daß man im Altertum jene Arbeiten als die vollkommensten Kunstwerke pries, die der Natur am nächsten kamen, wie etwa die berühmte Kuh des M y r o n, die, aus Erz gebildet, so lebendig erschien, daß man glaubte, sie atmen zu sehen und brüllen zu hören.-Auf der gleichen Linie bewegt sich eine andere antike Anekdote, die berichtet, der griechische Maler X e u x i s habe Trauben so natürlich gemalt, daß die Vögel herankamen und daran pickten. Im Sinne dieser Anschauung sagt noch Vitruv: „Kunstwerke sind Nachbildungen dessen, was wirklich ist oder sein kann.“ Im 17. Jahrhundert modifizierte dann der Franzose B o i I e a u diesen Satz durch die Behauptung: „Nur das Wahre ist schön.“
In den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts L„te Theodor Fechner die Grundlagen zu einer experimen-t a 1 e n Ästhetik, die, von den Gefühlen und Empfindungen des Betrachters eines. Kunstwerkes ausgehend, festzustellen versuchte, ob sich der Eindruck des Schönen nicht zahlenmäßig ergründen ließe, nicht etwa in der Richtigkeit der Proportionen gelegen sei. Ähnliche Erwägungen hatte schon das Altertum angestellt, wie es der vielgenannte „Kanon“ des Polyklet beweist, der die als vorbildlich schön empfundene Statue eines „Doryphoros“ (Stabträgers) auf Grund von Messungen, die er an ebenmäßig gebauten' Männerkörpern vorgenommen hatte, modellierte. Die Lehre, daß man das Schöne an der Hand von Maßen künstlich herstellen könne, beherrschte namentlich die Renaissance; nicht nur Leonardo gab sich mit solchen Versuchen ab. auch Dürer brachte in seinem Stiche „Adam und Eva“ aus dem Kreis heraus konstruierte Menschenkörper.
In diesem Zusammenhange wäre auch auf die von Adolf Zeising zuerst erkannte ästhetische Bedeutung des „goldenen Schnittes“ hinzuweisen, der namentlich bei architektonischen Schöpfungen eine große Rolle spielt.
Mühten sich die Experimentalästhetiker vor allem um eine mathematisch fundierte Begründung des Schönheitsurteils, so suchten andere Forscher dem Wesen des Kunstwerks durch Ermittlung seiner Entstehungsgrundlagen beizukommen. So nahm der französische Kunstphilosoph Hippolyte Taine vom Wertbegriffe Abstand und erklärte jedes Kunstwerk als ein Produkt dreier Faktoren: der Rasse, des Klimas und des Zeitstils, mithin des M i' i e u s, aus dem es hervorging. Einer andern genetischen Methode bediente sich Gottfried Semper in seinem 1863 erschienenen dreibändigen Werke „Der Stil“, in welchem er die Entstehung aller Kunstformen aus dem Gebrauchszweck, dem Material und der zur Anwendung gebrachten handwerklichen Technik ableitete.
Gegenüber dieser materialistischen Betrachtungsweise führte eine Generation später (1893) der Wiener Kunsthistoriker Alois Riegl den Terminus des „Kunstwollens“ ein, das er als das eigentlich Primäre bezeichnete. Denn der Entstehung eines Kunstwerks voraus geht der Wille, eines zu schaffen, und dieser Wille sucht sich dann die geeignete Technik, die passende Form und das erforderliche Material. Hermann Popp entwickelte diesen Gedanken in seinem Buche „Maler-Ästhetik“ (Straßburg 1902) noch weiter, indem er ausführte: „Die sogenannte wissenschaftliche Ästhetik hat weder die Aufgabe, Anleitungen zur Kunstpraxis zu geben, noch das Recht, durch Aufstellung von Gesetzen diese als ausschlaggebenden Maßstab für die Wertschätzung der Kunstwerke zu verwenden. Die Ästhetik Jaat nur methodisch zu untersuchen, ob der Künstler das, was er in seinem Werke gewollt, auch gekonnt, das heißt zur sichtbaren Erscheinung gebracht hat... Das künstlerische Wollen muß stets den Ausgangs-, Mittel- und Endpunkt der ästhetischen Beurteilung bilden.“
Dieses Wollen ist aber nichts anderes, als der Ausdruck einer künstlerischen Energie, die nach Gestaltung ringt. Darum sagte schon Adolf Horwicz in seinen trefflichen „Grundlinien eines Systems der Ästhetik“ (Leipzig 1869) auf Seite 23 sehr richtig: „Kunst ist G e-staltungsvermöge n.“ So wertvoll diese Definition auch ist, gibt sie doch über einen wichtigen Punkt, das Ziel der Kunst, keine Auskunft, wobei freilich „Ziel“ nicht mit „Zweck“ zu verwechseln ist. Wenn zum Beispiel ein Maler ein Madonnenbild für eine Kirche malt, so ist es der Zweck dieser Arbeit, die Kirche mit einem Andachtsbild zu schmücken. Wenn aber diese Mutter Gottes von so holdseliger Schönheit ist, daß die Menschen von weither kommen, um gerade vor diesem Gemälde ihre Andacht zu verrichten, dann hat der Maler sein Ziel erreicht, durch d^ie Anmut seines Bildes auf die Beschauer zu wirken. Und wie in diesem Einzelfall können wir auch generell behaupten, daß das Ziel jeder Kunst die Wirkung sei. Sie ist es, die letztlich den Wert und die Höhe einer Leistung bestimmt. Worauf ist nun aber diese Wirkung zurückzuführen? Vor etwa zwanzig Jahren habe ich in einem Aufsatz über Dagobert Peche in den „Graphischen Künsten“ (Band XLIX, 1926, Seite 51 ff.) nachfolgenden Vergleich gebracht: „Jede echte Kunstschöpfung ist wie ein Stückchen Radium, das unaufhörlich Strahlen ausludet, und diese Ausstrahlungen, das untrügliche Kriterium des wahren Kunstwerks, sind um so stärker fühlbar, je bedeutender der Künstler ist, der hier seine Ideen verkörperte. Ein unversiegbarer, lebendiger Strom ziehen uns,diese Emanationen einer genialen Persönlichkeit noch nach Jahrhunderten mit magischer Gewalt in ihren Bann, erwärmen, erheben und beglücken uns. Wo wir solche Energien nicht spüren, kann von Kunst keine Rede sein. Demgemäß richtet sich der innere Wert eines Kunstdinges keineswegs nach der Beschaffenheit des dargestellten Sujets, sondern einzig und allein nach der geistigen Potenz de3 gestaltenden Künstlers, beziehungsweise danach, ob er in dem betreffenden Werke seine Persönlichkeit voll und ganz zum Ausdruck gebracht hat.“
Wenn wir also an der Vorstellung festhalten, daß die vom Künstler in sein Werk hineingebannte Energie in diesem lebendig bleibt und aus ihm unaufhörlich „hinausstrahlt“, daß somit jedes Kunstwerk gewissermaßen ein „Sende r“ ist, der Strahlen von besonderer Beschaffenheit in die Welt hinausschickt, dann bildet das Korrelativ dazu der „Empfänger“, der so geartet sein muß, daß er der Wirkung dieser Strahlen zugänglich ist. Daher ist nicht jeder befugt, zu entsdieiden, was Kunst ist, nicht jeder in der Lage, Kunst als Kunst zu fühlen, sondern nur derjenige, welcher einen Empfangsapparat in sich hat, der auf die Wellenlänge der Strahlen eines bestimmten Kunstwerks abgestimmt ist. Dieser innere Zusammenhang zwischen Sender und Empfänger erklärt es, warum die Menschen nicht für die Werke aller Kunstcpochen gleichmäßig empfänglich sind, sondern nur für jene, die ihrer eigenen Zeitperiode irgendwie entsprechen. Als der Impressionismus aufkam, stellte sich plötzlich ein auffallendes Verständnis für alle jene oft weit zurückliegenden Epochen ein, die auch impressionistisch empfunden hatten, und ebenso erkannte man erst im Zeitalter des modernen Expressionismus die Bedeutung eines Grünewald oder Greco. Y? Klassizismus hinwieder besaß nur Sinn für die Antike und lehnte alles andere kategorisch ab. Als Goethe Ende Oktober 1786 nach Assisi kam, hatte er nur Augen für den antiken Minervatempel, den er in seiner „Italienischen Reise“ voll Begeisterung „das löblichste Werk“ nannte, während er die uns heute weit mehr fesselnde Kirche des heiligen Franziskus mit ihren wundervollen Giottofresken geringsdiätzig als den „tristen Dom des heiligen Franziskus“ bezeichnete und „mit Abneigung“ links liegen ließ. Man sieht daraus: auch die Sterne am Kunsthimmel versenden ein „intermittierendes“ Licht, das bald aufleuchtet, bald erloschen zu sein scheint, in Wahrheit aber immer strahlt.
Aber auch mit der Annahme einer im Kunstwerk latenten schöpferischen und gestaltenden Energie ist das Wesen desselben nicht zur Gänze erklärt. Es fehlt dabei noch ein sehr wesentliches Moment, das vom Wollen wie vom Können des Künstlers völlig unabhängig, für den Schaffensakt entscheidend ist: die spontane künstlerische Einfall, die Eingebung von oben. Ohne sie ist alle Mühe vergeblich, kann das sonst so beglückende künstlerische Schaffen zu einer wahren Hölle werden, zu tiefster Verzweiflung führen. Wenn aber ein gütiges Schicksal dem Künstler unaufhörlich neue Einfälle schenkt, dann spricht man von seinem „Genius“ und verherrlicht ihn selber als „Genie“. Solche Genies, denen es nie an originellen Ideen mangelte, waren in der Musik J. S. Bach und Mozart, Havdn und Schubert, Richard Wagner, Verdi und Johann Strauß, in der Malerei Riffael, Dürer und Correggio, Rembrandt, Rubens und Watteau, in der Dichtkunst Shakespeare und Schiller, indes bei andern, selbst bei Goethe, der Fluß der Erfindung manchmal durch längere Zeit versiegte.
Aber es gibt auch Künstler, die nur ein einzigesmal in ihrem Leben geniale Einfälle harten und damit berühmt wurden, nachher aber ihre ersten, großen Erfolge nie wieder erreichten, wie es etwa bei Pietro Mascagni oder Ruggiero Leoncavallo der Fall war. In gleicher Weise könnte man auch Maler und Bildhauer anführen, die sich bloß mit einem einzigen, nie wieder übertroffenen Werke einen Namen machten. Das verleiht Künstlers Erdenwallen, vom so häufigen Unverständnis der Zeitgenossen abgesehen, oft einen tragisdien Zug, und man muß darin Schiller beistimmen, der in der „Glocke“ diese Erkenntnis in die klassisdien Verse kleidete:
Von der Stirne heiß
Rinnen muß der Schweiß,
Soll das Werk den Meister loben:
Doch der Segen kommt von oben.
Betrachten wir nach all dem Angeführten ein Kunstwerk als das relativ seltene Produkt einer starken, gestaltenden Energie und gewisser unerklärlicher, aber nicht zu leugnender, vom Menschen unbeeinflußbarer, übersinnlicher Einflüsse, die wir durch die Begriffe „Phantasie“, „Inspiration“ oder „göttlicher Funke“ umsdireiben, dann möchten wir auf die eingangs gestellte Frage „Was ist Kunst?“ eine sehr einfache Antwort geben: Kunst ist Gnade. Gnade nicht nur für den Schaffenden, der mit dem „Kunstwollen“ allein noch kein Kunstwerk zustande bringt, sondern auch für den Kunst Empfangenden und Genießenden. Diese Begnadung ist weder im Leben des einzelnen noch in dem der Völker mit Gewalt zu erzwingen. Im Reiche der Kunst gibt es keine Diktatur. Kunst kann weder „befohlen“, noch „gelenkt“ werden, da jeder wahre Künstler die Gesetze seines Sdiaffens in sich trägt und diese Gesetze einmalig sind und nur für ihn gelten. Aus solcher Einsicht heraus prägte der Ästhetiker Adolf Horwicz den Satz: „Das Gesetz der Kunst: die Freiheit des Künstlers“, verfaßte Ludwig Hevesi 1S98 für die neu^egr^ndete Wiener Sezession den schönen Leitspruch: „Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit.“
Daß die Gnade der Kunst keineswegs allen Zeitepochen und Nationen gleichmäßig zuteil ward, lehren Kunstgeschichte und Kunstgeographie, von denen die erstere ein ewiges Werden und Vergehen der Stilformen, die letztere einen steten Wechsel der Schauplätze erkennen läßt, auf welchen sich die großen Kunstleistungen abspielen. Dennoch aber ist die geheimnisvolle Kraft der Kunst immer irgendwo und irgendwie vorhanden, als ein heller Strahl aus dem Dunkel des Weltraumes, der die Menschen von innen erleuchtet und wärmt. Über allem Menschlichen stehend, ist Kunst die Sublimierung reinsten Menschentums, keinem andern lebenden Wesen als dem Menschen erkennbar und verständlich. In einer Zeit, die sich an Unmensdilichkeit nicht genugtun konnte, dürfen wir darum gerade von der Kunst eine Regeneration unserer auf einen bedauerlichen Tiefstand herabgesunkenen kulturellen Verhältnisse erhoffen.