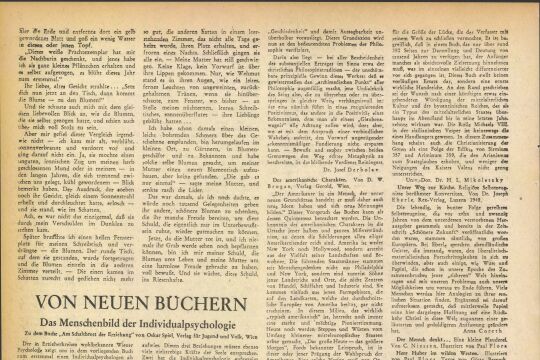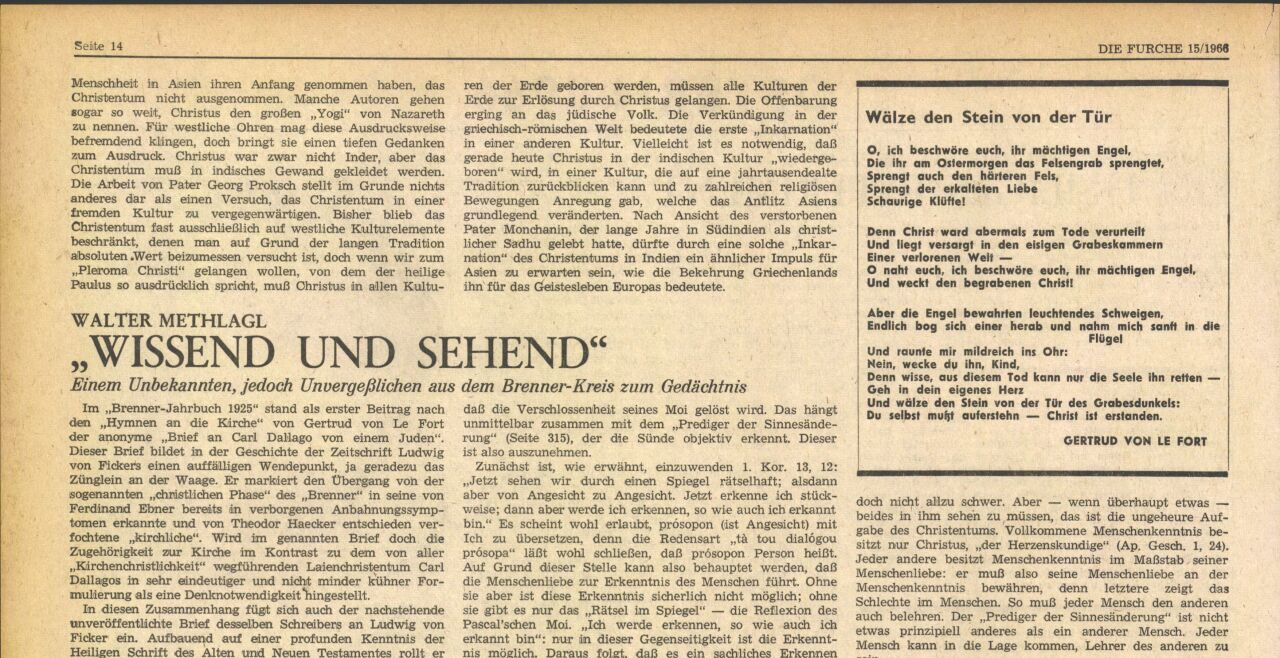
„WISSEND UND SEHEND“
Einem Unbekannten, jedoch Unverqeßlichen aus dem Brenner-Kreis zum Gedächtnis
Einem Unbekannten, jedoch Unverqeßlichen aus dem Brenner-Kreis zum Gedächtnis
Im „Brenner-Jahrbuch 1925“ stand als erster Beitrag nach den „Hymnen an die Kirche“ von Gertrud von Le Fort der anonyme „Brief an Carl Dallago von einem Juden“. Dieser Brief bildet in der Geschichte der Zeitschrift Ludwig von Fickers einen auffälligen Wendepunkt, ja geradezu das Zünglein an der Waage. Er markiert den Übergang von der sogenannten „christlichen Phase“ des „Brenner“ in seine von Ferdinand Ebner bereits in verborgenen Anbahnungssymptomen erkannte und von Theodor Haecker entschieden verfochtene „kirchliche“. Wird im genannten Brief doch die Zugehörigkeit zur Kirche im Kontrast zu dem von aller „Kirchenchristlichkeit“ wegführenden Laienchristentum Carl Dallagos in sehr eindeutiger und nicht minder kühner Formulierung als eine Denknotwendigkeit‘hingestellt.
In diesen Zusammenhang fügt sich auch der nachstehende unveröffentlichte Brief desselben Schreibers an Ludwig von Ficker ein. Aufbauend auf einer profunden Kenntnis der Heiligen Schrift des Alten und Neuen Testamentes rollt er am Beispiel von Ebners „Pneumatologischen Fragmenten“ in einprägsamen Distinktionen und doch auch schlicht begreifbaren und ergreifenden Bildfolgen die persönlichen Besinnungshintergründe des Verfassers auf, denen sich in der Folge der Empfänger, Ludwig von Ficker, in einem hohen Maß verpflichtet wußte. Es geht um die „Erkennbarkeit des Du“ bei Ebner, also darum, denkend zu ergründen, ob ein Mensch den anderen, seinen Nächsten, in seiner Gläubigkeit wie seiner Sündhaftigkeit und Verurteilbarkeit je „verstehen“ kann oder ob er sich darauf beschränken muß, über alles Widersprüchliche hinweg an ihn zu „glauben“. Die Wechselbeziehung zwischen Glauben und Wissen, „Liebe und Wort“, Leben und Lehre steht in dieser frühesten Befassung mit Ebner und seinem Werk zur Diskussion, die Frage schließlich nach dem Weg vom „Einzelnen“ Kierkegaards zur Gemeinsamkeit der Kirche, also das letzte und entscheidende Anliegen des „Brenner“ bei seiner Sondierung der Verbindbarkeit von kennzeichnenden Erscheinungen wie Sören Kierkegaard und John Henry Newman.
Dabei gebührt dem Umstand besondere Beachtung, daß Erich Messing, so hieß nämlich der Autor der beiden Briefe, seiner Abkunft nach Jude, der Konfession nach jedoch Christ war. Gleicherweise war er von den Geschicken seines Väterglaubens und — hierin Simone Weil nicht unähnlich —vom Heilsanspruch des Christentums betroffen. Solche Ansprechbarkeit nach zwei Richtungen hin paarte sich mit dem jüdischen Privileg des Vermögens zu kristallklarer Dialektik, mit gründlicher Beherrschung mehrerer Sprachen und mit der Bereitschaft zu strengster Abstraktion. Daraus ergab sich wohl das Eigentümliche seiner beruflichen Laufbahn als Ingenieur und Lehrer der Elektrotechnik zunächst in Wien und später, nach 1925, in Saarbrücken. Gerade die augenscheinliche Distanz dieser Art der Beschäftigung zu den geistigen Dingen, um die es ihm eigentlich ging, zeugt von der erstaunlichen Spannweite der intellektuellen und spirituellen Fassungskraft Erich Messings.
An notwendigen Daten über den Verlauf seines Lebens, das er selbst in Anonymität und Inkognito verborgen und geborgen wissen wollte, seien hier nur folgende angeführt:
Zunächst eine Lebensskizze, die er 1931 seiner Doktor arbeit voranstellte:
„Ich bin geboren in Wien am 25. Dezember 1895 als Sohn des kaufmännischen Direktors Heinrich Messing und seiner Frau Maria Messing. Ich besuchte die Oberrealschule in Wien VI., an der ich die Reifeprüfung 1913 ablegte. In den Jahren 1913 und 1914 absolvierte ich die Technische Hochschule in Wien und legte 1922 die zweite Staatsprüfung aus dem Fach Elektrotechnik ab. Nach zweieinhalbjähriger Praxis im Betrieb einer Überlandzentrale wurde ich an die Saarbrückner Höhere Technische Lehranstalt berufen, an der ich bis jetzt als Lehrer der Mechanik und Elektrotechnik tätig bin.“
Dazu gehören, als unerläßliche Ergänzung, fünf lakonische Aufzeichnungen aus einem hinterlassenen, durch glücklichen Zufall geretteten Tagebuch:
„12. 4. 1933 Austritt aus dem Schuldienst… 13. 1. 1935 Saarbrückner Abstimmung… 16. 9. 1935 Einführung der Judengesetze …“ (Beschäftigung als Handelskorrespondent, Privatlehrer, Transportarbeiter, Gelegenheitsarbeiter) „…5.3.1941 Verhaftung …10. 6.1942 Abreise.“
Mit diesem letzten Wort ist die „Reise“ in eines der Vernichtungslager des Dritten Reiches gemeint, von der Erich Messing nicht mehr zurückgekehrt ist. Nach dem Zeugnis eines Freundes hat er sie „wissend und sehend“ angetreten.
Am 25. Dezember 1965 hätte Erich Messing seinen sieb-
zigsten Geburtstag gefeiert.
Saarbrücken, 5. III. 1925 Hochverehrter Herr!
Ebner sagt (Seite 94/95 ): es gibt nur ein „Ich“, und das bin ich selber. Jeder andere Mensch ist für mich „Du“; wenn aber nicht, so ist er nur das Spiegelbild des Pascalschen Moi in mir: ich projiziere in ihn, was an mir schlecht ist. Das Ich im anderen ist also unerkennbar. Kein Mensch kann den anderen Menschen in seinem Gottesverhältnis verstehen (Seiite 122); keiner kann um die Wahrheit dieses Gottverhältnisses des anderen wissen (ebenda). Man kann also an den Nebenmenschen nur glauben. Selbst beim Heiligen kann man nur glauben; und anderseits muß man selbst beim Verbrecher daran glauben. Daher wird auch (Seite 306) die Sünde niemals Objektiv erkannt. Anderseits aber räumt er doch die Möglichkeit ein, daß (Seite 258) einem Menschen die geistige Kraft gegeben wäre, den anderen das „Du“ unmittelbar wahrnehmen zu lassen: also derart auf ihn einzuwirken,
daß die Verschlossenheit seines Mol gelöst wird. Das hängt unmittelbar zusammen mit dem „Prediger der Sinnesänderung“ (Seite 315), der die Sünde objektiv erkennt. Dieser ist also auszunehmen.
Zunächst ist, wie erwähnt, einzuwenden 1. Kor. 13, 12: „Jetzt sehen wir durch einen Spiegel rätselhaft; alsdann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber werde ich erkennen, so wie auch ich erkannt bin.“ Es scheint wohl erlaubt, prösopon (ist Angesicht) mit Ich zu übersetzen, denn die Redensart „tä tou dialogou prösopa“ läßt wohl schließen, daß prösopon Person heißt. Auf Grund dieser Stelle kann also behauptet werden, daß die Menschenliebe zur Erkenntnis des Menschen führt. Ohne sie aber ist diese Erkenntnis sicherlich nicht möglich; ohne sie gibt es nur das „Rätsel im Spiegel“ — die Reflexion des Pascal’schen Moi. „Ich werde erkennen, so wie auch ich erkannt bin“: nur in dieser Gegenseitigkeit ist die Erkenntnis möglich. Daraus folgt, daß es ein sachliches Erkennen des Menschen nicht gibt. Um über einen Menschen urteilen (gerecht urteilen) zu können, muß ich also bereits Gutes von ihm wissen, muß bereits die Grundlage der Erkenntnis gegenseitig vorhanden sein: die Agape. Dann aber kann ich über ihn nicht aburteilen: ich kann Fehler an ihm erkennen (vorher kann ich es nicht), aber ich kann ihn nicht verurteilen. Daß also ein Mensch vollkommen verworfen wäre, kann ich nie erkennen, ich kann es nie wissen. Auch die Menschenkenntnis'des Auserwählten bildet hier keine Ausnahme. Das „Empfanget den Heiligen Geist“ (Joh. 20, 23) kommt erst nach dem „Dies befehle ich euch, daß ihr einander liebt“ (Joh. 15, 17). Eine wirkliche Ausnahme ist nur Christus selbst: „Denn er wußte selbst, was im Menschen war“ (Joh. 2, 25).
Die Frage, wie sich ein Mensch zur Wahrheit verhalte, kann ich also nur beantworten, wenn ich weiß, daß diese Frage im positiven Sinne zu beantworten ist.
Dagegen wäre nun einzuwenden, daß es ein derartiges Wissen nicht geben könne. Einige Stellen aus Ezechiel besagen, daß dem Reuigen seine frühere Sünde nicht angerechnet würde, aber dem Gefallenen auch nicht seine frühere Gerechtigkeit. Daher würde also auch das Erlebnis, daß man Zeuge der positiven Wahrheitsentscheidung des Nebenmenschen wäre, keine endgültige Gewißheit geben. Dieser Einwand besteht sicherlich zurecht, und ganz konsequenterweise sagt auch Ebner, an den Nebenmenschen müsse man glauben. Der Gegeneinwand lautet aber: aus diesem Glauben muß auch ein Wissen folgen. Wie jedes Wissen eine Folge des Glaubens ist, so auch dieses; und wie jeder Glaube zu einem Wissen führt, so auch dieser. Wenn der Glaube zu keinem Wissen führt, so ist der Christ geistig nicht erhaben über dem Heiden: die dunkle Gottesahnung des Heiden wäre
Ein Brief Erich Messings an Ludwig von Ficker ebenso viel wie die Gewißheit des Christen: „Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen“ (Matth. 18, 20). Und ganz folgerichtig sagt auch Ebner (Seite 258): das hägion pneüma sei der Geist des Einverständnisses der Menschen. Was aber soll ein solches Einverständnis, wenn nicht das Wissen um den Nebenmenschen in seiner Geistigkeit vorhanden ist? Wie kann es möglich sein ohne dieses Wissen?
Der eigentliche Wert des Satzes „In welchem Maß ein Mensch Menschenliebe hat, im selben Maße hat er auch Menschenkenntnis“, besteht in der aus der Menschenkenntnis, und nur aus ihr, folgenden Möglichkeit einer Belehrung des Menschen durch den anderen. Wer das Du im anderen sieht und infolgedessen auch das Ich, der sieht die Discre- panz zwischen beiden. (Ebner Seite 315). Im Nebenmenschen nur das Du zu sehen, ist zweifellos schwer, aber vielleicht doch nicht allzu schwer. Aber — wenn überhaupt etwas — beides in ihm sehen zu müssen, das ist die ungeheure Aufgabe des Christentums. Vollkommene Menschenkenntnis besitzt nur Christus, „der Herzenskundige“ (Ap. Gesch. 1, 24). Jeder andere besitzt Menschenkenntnis im Maßstab seiner Menschenliebe: er muß also seine Menschenliebe an der Menschenkenntnis bewähren, denn letztere zeigt das Schlechte im Menschen. So muß jeder Mensch den anderen auch belehren. Der „Prediger der Sinnesänderung“ ist nicht etwas prinzipiell anderes als ein anderer Mensch. Jeder Mensch kann in die Lage kommen, Lehrer des anderen zu sein.
Es scheint mir also, daß Ebners These eigentlich nicht falsch, sondern nur gewissermaßen zugespitzt, übertrieben ist. Wenn er betont hätte, daß aus dem zunächst notwendigen Glauben an den Nebenmenschen auch ein Wissen folgt, daß dieses Wissen, die Kenntnis des Nebenmenschen, identisch ist mit der Gemeinschaft des Heiligen Geistes, so wäre wohl nichts einzuwenden. Auch geht ja aus der obigen Betrachtung (deren Richtigkeit vorausgesetzt) hervor, daß das Buch das Korrektiv des Fehlers schon in sich hat, daß also aus der in ihrer Übertriebenheit unrichtigen These keine falsche Konsequenz gezogen ist. Soweit ich also urteilen kann, glaube ich, daß die Korrektur des Fehlers ohne allzugroße Veränderung des Buches durchgeführt werden könnte. Allerdings müßte er auf die Gegenüberstellung Liebe-Wort (subjektive-objektive Seite der menschlichen Existenz) wohl verzichten.
Die Liebe ist eben auch die objektive Seite des Ich, und das Wort auch die subjektive. Am Anfang des 10. Fragments (Seite 187) betont er letztere Tatsache. Wie und in welcher Weise Ich, Wort und Liebe Zusammenhängen, ist wohl ein 'f’rinitätsproblem, von dem auch das Wort gilt, das‘(ich weiß nicht welcher) Kirchenvater einmal gesprochen find das Haecker im Nachwort zitiert hat: „Quid tibi prodest alta de Trinitate disputare? Opto magis sentire compunctionem quam eius definitionem.“ Das Buch ist aber, glaube ich, auf diese Disjunktion subjektiv-objektiv nicht angewiesen; es läßt sich sicherlich halten ohne diese Disjunktion. — Ich muß aber sagen, daß ich das Buch mit eben seinem Fehler schätze. Die Übertriebenheit der These schadet nicht, sie kann nur nützen; und wenn diese Übertriebenheit dem Buch die eigentümlich düstere Färbung verleiht, die es auszeichnet, so ist auch diese düstere Färbung — der Zeit der Entstehung entsprechend — wertvoll, weil ethisch bewegend.
Bemerkenswert ist, daß das Buch sich illustrieren läßt, und daß die Zeichnungen bereits vorhanden sind: in Dostojewskys Romanen. Ich denke vor allem an Iwan Karamasoff und sein Gespräch mit Sossima. Sossima versteht den Iwan; aber nicht literarisch, sondern, was diesem unangenehm und unverständlich ist, geistig. Sossima ist überhaupt der einzige Mensch, der den Iwan versteht. Iwan —die Lebendigkeit dieser Romanfigur legt die Vermutung nahe, daß die größten Genies nie zur Produktion gekommen sind — erscheint geradezu gespalten in ein Ideal-Ich und ein Real-Ich. Er kann schließlich überhaupt mit keinem Menschen mehr sprechen. Sein Gespräch mit Aljoscha muß in Anführungszeichen stehen: er muß mit Aljoscha als Poet sprechen und sich nachher jede weitere Annäherung verbieten. Dieser Zwiespalt ist es, an dem er zugrundegeht. Noch krasser ist dasselbe bei Stawrogin der Fall. Auch er wird nur von qinem einzigen Menschen verstanden: von Schatoff; und zwar ist hier auch die Liebe das Medium des Verstehens. Schatoff leidet darunter, daß das „Du“, das er in Stawrogin gefunden zu haben meint, nicht „real“ ist, sondern „ideell“ (Ebner Seite 119 ff), und daß das reale Ich des Stawrogin einen schauerlichen Kontrast zu seinem ideellen Ich bietet. In beiden Fällen — Stawrogin wie Iwan — befindet sich ein defektiver Mensch im Besitz höchster Erkenntnisse (scire definitionem), ohne sie realisieren (sentire compunctionem) zu können.
Alles zusammengenommen, finde ich Ebners Buch ausgezeichnet. Nur eins möchte ich noch anmerken: warum Genialität eine Tatsache der Natur sein soll (Seite 289), kann ich nicht einsehen. Diese unbewiesene Behauptung paßt auch nicht gut zu den ausgezeichneten Darlegungen auf Seite HO ff und Fragment 18. — Ferner könnte „objektiv“ von „sachlich“ unterschieden werden. Sachlich betrachte ich Materielles, ohne persönliche Stellung zu nehmen, objektiv betrachte ich einen Menschen, zu dem ich persönlich Stellung nehme.
Soweit ich urteilen kann, fügt sich das Buch (mit Ausnahme des besprochenen Fehlers) durchaus dem Wort der Bibel. Der Ursprung des Buches ist nicht spekulativ. Die Betrachtungen Seite 115 bis 119 und Seite 91 f scheinen mir die Ursprünge des Werkes zu sein. Das Werk ist also nicht philosophisch; der Autor hat das Recht, die Philosophie zu kritisieren.
1 Messing zitierte nach der ersten Auflage von Ebners Buch „Das Wort und die geistigen Realitäten“ (Innsbruck 1921); in der vorliegenden Wiedergabe wurden die Seitenzahlen an die leichter zugängliche Neuauflage der Schriften Ebners im Kösel-Verlag (Bd. I, München 1962) angeglichen.