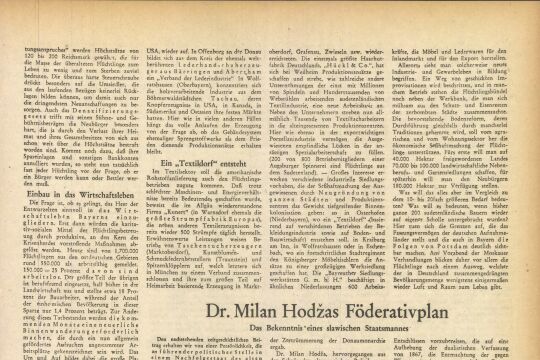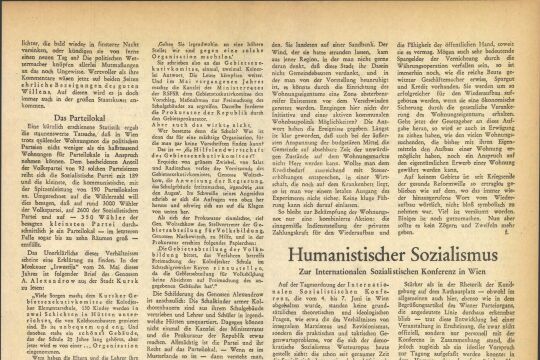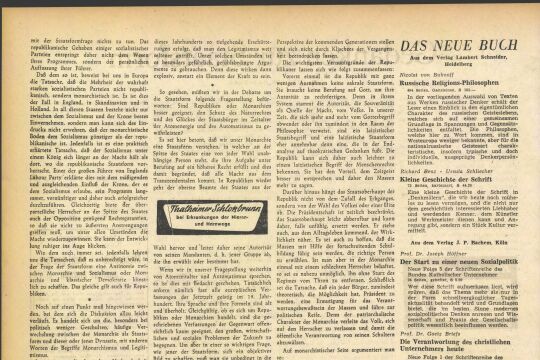Republik zwischen Konsens und Konflikt
Die Ausrufung der Republik Österreich jährt sich heuer zum 100. Mal. Politologe Anton Pelinka und Historiker Dieter A. Binder im FURCHE-Gespräch über die Lehren der Ersten und Zweiten Republik und Potenziale der aktuellen EU-Ratspräsidentschaft.
Die Ausrufung der Republik Österreich jährt sich heuer zum 100. Mal. Politologe Anton Pelinka und Historiker Dieter A. Binder im FURCHE-Gespräch über die Lehren der Ersten und Zweiten Republik und Potenziale der aktuellen EU-Ratspräsidentschaft.
Ab dem Herbst 1918 wurden die noch heute bestehenden Grundlagen Öster reichs festgelegt. Der Wiener Politologe Anton Pelinka und der Grazer Historiker Dieter A. Binder -der eine lehrte bis vor Kurzem an der Budapester Central European University, der andere lehrt nach wie vor an der Budapester Julius Andrassy Universität -erörtern in einem FURCHE-Doppelgespräch im Rahmen der Interview-Reihe 1914/2014-1918/2018 Chancen und Scheitern der Ersten Republik. Sie sprachen auch über die daraus gezogenen Lehren der Zweiten Republik bis hin zu möglichen Potenzialen der aktuellen EU-Ratspräsidentschaft im Wechselspiel von Geschichte und Politik.
DIE FURCHE: Im Herbst jährt sich die Ausrufung der Republik Österreich zum 100. Mal. Diese Staatsform verdankt ihre Existenz keiner Revolution, sondern entstand in einer Phase des politischen Vakuums. War sie tatsächlich eine "Notlösung", wie Sie, Herr Prof. Pelinka, das einmal bezeichneten?
Anton Pelinka: Die Gründung der Republik als parlamentarische Demokratie war für die daran Beteiligten -die 1911 in das Abgeordnetenhaus des Reichsrates gewählten Parlamentarier des "Restes" des Kaiserreiches - die einzige konsensfähige Variante. Die anderen denkmöglichen Optionen, Monarchie oder Räterepublik, hätten keinesfalls eine breite Zustimmung erhalten können.
Dieter A. Binder: Die Entscheidung fiel spät. Dem Bekenntnis der Sozialdemokratie zur Republik folgten zunächst die christlichsozialen Bauern und der Flügel um Leopold Kunschak. Hier spielten die kriegswirtschaftliche Zwangswirtschaft und die Rekrutierungszwänge der Militärführung eine große Rolle. Letztendlich blieb der Ersten Republik eine monarchistische Fundamentalopposition im Gegensatz zur Weimarer Republik erspart.
DIE FURCHE: Welche Rolle spielten die ehemaligen Kronländer -nunmehr Bundesländer - in der Gründungsphase der Republik? Liegen hier die Wurzeln des -zumindest in den Augen mancher - überausgeprägten österreichischen Föderalismus?
Pelinka: Den Ländern kam bei der Republikgründung selbst keine wesentliche Bedeutung zu. Aber nach der Ausrufung der Republik machten sie sich bemerkbar, weil ja einige von ihnen -Vorarlberg in Richtung Schweiz, Tirol und Salzburg in Richtung Deutschland - sezessionistische Alternativen ins Auge gefasst hatten. Das Bundes-Verfassungsgesetz 1920 war ein politischer Kompromiss zwischen den betont föderalistischen Christlichsozialen und den grundsätzlich zentralistischen Sozialdemokraten.
Binder: Der föderalistische Habitus der Christlichsozialen war vor allem gegen das Rote Wien gerichtet. In dem Augenblick, wo man die Regierung stellte, richtete man sich rasch in der Verfassungswirklichkeit ein. Der sogenannte "Christliche Ständestaat" verzichtete völ-
lig auf föderalistisches Beiwerk. DIE FURCHE: Der Konsens der politischen Lager ging über die Verabschiedung der Bundesverfassung kaum hinaus. Die jeweiligen Modelle von Staat und Kultur schlossen die jeweils andere Seite weitgehend aus. Hätte es Ansatzpunkte einer politischen Konsenskultur gegeben und, wenn ja, warum konnten diese ihr Potenzial nicht entfalten? Welche Rolle spielten dabei die entscheidenden "Player" Seipel und Bauer zum Einklang und im Ausklang der Republik?
Pelinka: Ansätze zu einer Konsensdemokratie gab es sehr wohl. Der Verfassungskonsens von 1920 war ja ein Beispiel für ein solches Potenzial, und die Gründung der Arbeiterkammern schaffte eine für die Entwicklung einer Sozialpartnerschaft wesentliche strukturelle Voraussetzung: ein klar definiertes Gegenüber zu den bereits bestehenden Handelskammern. Auch die im Konsens vorgenommene Abspaltung Wiens von Niederösterreich zeigte auf, dass wesentliche Ansätze zu einer politischen Kultur der Machtteilung gegeben waren. Seipel und Bauer waren, in der Anfangszeit der Republik, durchaus Teil dieser Bereitschaft zu Konsenslösungen. Am Ende der Republik hatten sie sich jedoch in Illusionen verstrickt -deutlich bei Bauer, der dachte, der Sieg des demokratischen Sozialismus könnte ganz einfach abgewartet werden; weniger deutlich bei Seipel, dessen "wahre Demokratie" nebulos blieb, wenn man sie nicht als ideologischen Überbau für eine Politik deutete, die letztlich die demokratische Republik zerstören musste.
Binder: Die Konsensbereitschaft führte zum Schulgesetz 1926, letztlich auch zu den Verfassungsnovellen 1925 und 1929. Konsensuale Politik sieht man bis in den schleichenden Staatstreich 1933/1934 hinein in den Bundesländern. Die "wahre Demokratie" Seipels, ähnlich konturlos wie Viktor Orbáns "illiberale Demokratie", spiegelt das Narrativ vom "starken Mann" im Heimwehr-Faschismus. Während sich die Sozialdemokratie unter Bauer dem Traum der 51 Prozent hingab, suchte der Bürgerblock den Machterhalt um jeden Preis. DIE FURCHE: Scheiterte die Erste Republik an divergierenden Narrativen, lag das Erfolgsrezept der Zweiten Republik in der Verständigung der maßgeblichen Kräfte auf gemeinsame Narrative. In den letzten 20 Jahren scheinen diese der österreichischen Politik abhanden gekommen zu sein. Die "Message" beziehungsweise deren "control" überlagern zunehmend Inhalte, geschweige denn Visionen. Sehen Sie darin ein unausweichliches "postdemokratisches" Phänomen?
Pelinka: Das Paradoxe ist, dass die Erfolge der Zweiten Republik ohne die Katastrophen von 1933, 1934 und vor allem 1938 kaum vorstellbar sind. Zum Erfolg der Zweiten Republik gehört, dass die politischen Parteien faktisch auf Visionen verzichten, wenn diese nicht a priori zumindest potenziell mehrheitsfähig sind. Visionen sind nicht "out" - sie müssen aber aus der Gesellschaft kommen, nicht in diese von "oben" hineingetragen werden. In diesem Sinne sehe ich kein "postdemokratisches" Zeitalter, sehr wohl aber ein "postheroisches" - als Zeichen des Erfolges der Demokratie.
Binder: Dieser stabilisierende Verzicht auf Visionen und die historischen Erfahrungen schufen die Basis für das pragmatische Miteinander, das in der Sozialpartnerschaft den gesellschaftlich notwendigen Transfer ermöglichte. Auf das Gefühl einer grenzenlosen Freiheit 1989/1995 folgte in Teilen der Bevölkerung, die ihre Stabilität aus den klaren Grenzziehungen der bipolaren Welt des Kalten Krieges bezogen hatten, eine tiefe Verunsicherung. Diese nutzte der Populismus. Die weitgehende Historisierung der Zeit vor 1945 führt zu einem Verlust des gemeinsamen Narrativs, an dessen Stelle populistische Signalworte treten: "Umvolkung", "Grenzschutz","Heimatschutz" etc.
DIE FURCHE: Nicht zuletzt aus Sicht zweier Budapester Universitäten, für die Sie stehen: Genau hundert Jahre nach 1918 hat Österreich im zweiten Halbjahr 2018 die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Welche Position könnte beziehungsweise sollte Österreich - gerade im Rückblick auf den Ersten Weltkrieg und seine Folgen - heute in der Union im Allgemeinen und in Bezug auf Mitteleuropa im Besonderen einnehmen?
Pelinka: Meine persönliche Wunschvorstellung ist die einer sich weiter vertiefenden Europäischen Union -eine europäisierte, entnationalisierte Migrations-und Sicherheitspolitik. Ich bin aber skeptisch, ob die österreichische Bundesregierung solche Ziele überhaupt ernsthaft verfolgen will; und wenn, ob sie in der Lage ist, dazu einen entscheidenden Beitrag zu leisten. Die Möglichkeiten der rotierenden Ratspräsidentschaft dürfen nicht überschätzt werden.
Binder: Das europäische Projekt wird von jenen denunziert, die für ihre Politik ein Feindbild benötigen. Ob da ein rotierender Ratsvorsitz in dieser Regierungskonstellation jene absolut notwendigen Schritte in die von Pelinka skizzierte Richtung setzten kann, wage ich zu bezweifeln. Solange man mit europäischen Themen kleinkariert innenpolitische Groschen prägen will, wird sich da nicht wirklich was ändern.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!