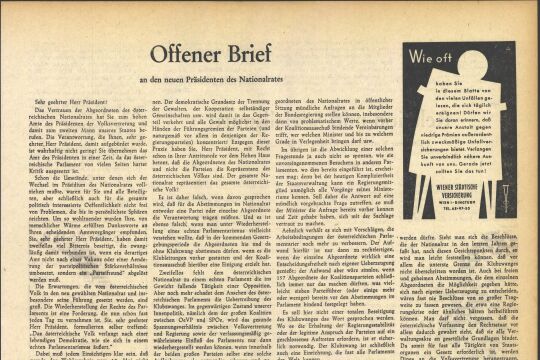Hans Kelsen, der "Vater der Bundesverfassung" und die aktuelle Wahlrechtsdebatte.
Eine wenig bekannte Facette aus dem Werk Hans Kelsens, dessen 125. Geburtstags am 11. Oktober gedacht wurde, ist sein origineller Ansatz für eine Reform des Wahlrechts in der Ersten Republik. Ginge es nämlich nach seinen Vorstellungen, dann könnten die Wähler die Abgeordneten zum Nationalrat persönlich nominieren, ohne dass ein Übergang zum Mehrheitswahlrecht die Folge wäre. Sein Modell, das dem Grundkonsens der Ersten Republik zum Verhältniswahlrecht - im bewussten Gegensatz zum Mehrheitswahlrecht der k.u.k. Monarchie - entsprach, bezeichnete er als "personalisierte Verhältniswahl in Einerwahlkreisen". Der Vorteil seiner Ideen liegt auf der Hand: Die Abgeordneten hätten sich in ihren Wahlkreisen volksnah profilieren können, die Parteienherrschaft über die Listen wäre zurückgedrängt worden.
Kelsen versus Renner
Kelsen setzte sich aber weder mit seinen Entwürfen zum Wahlrecht der Konstituierenden Nationalversammlung (die im Februar 1919 gewählt wurde), noch mit seinen Reformbestrebungen für das Nationalrats-Wahlrecht in den zwanziger Jahren durch. Vergeblich publizierte er die Thesen in der Arbeiter-Zeitung, in der Neuen Freien Presse und im Fach-Organ Der österreichische Volkswirt. Die für die wahlrechtliche Identität der Republik heute maßgeblichen Regelungen - das Verhältniswahlrecht (der wahlwerbenden Parteien) in Wahlkreisen - sind der rechtspolitischen Urheberschaft Karl Renners zuzuschreiben, der die Reminiszenz an die "historisch gewachsenen Wahlkreise" der k.u.k. Monarchie nicht aufgeben wollte, auch wenn viele davon 1919 nur mehr auf dem Papier bestanden (Sudetenland, Südtirol etc.).
Vergleicht man also die beiden durchaus "konservativen" Sozialdemokraten Renner und Kelsen miteinander, so wäre Kelsens Ansatz für die erste republikanische Wahlordnung moderner und origineller gewesen. Er hätte auch die Querelen erspart, die sich nunmehr durch den Streit um die Parteien-und Kurzbezeichnungen in den Wahlvorschlägen ergeben.
Verzerrte Ergebnisse
Der aus dem mährischen Unter-Tannowitz stammende Jurist Karl Renner hatte Kelsen für den mühsamen Prozess der Verfassungslegistik als Konsulent der Staatskanzlei unter seine Fittiche genommen. Das Wahlrecht der Ersten Republik fand sich in der Wahlordnung für die Konstituierende Nationalversammlung (Vorläuferin der Nationalrats-Wahlordnung - NRWO) und einem modernen Gesetz über einen Wahlgerichtshof. Die von Kelsen gewünschte radikale Verwirklichung des Proportionalsystems fand darin keinen Niederschlag, auch die Fülle der Wahlausschließungsgründe (z. B. für Prostituierte) erschien als undemokratisch.
Dementsprechend kritisch waren auch seine Anmerkungen in einem populärwissenschaftlichen Artikel aus 1918, aber auch in der Verfassungsedition, die im Folgejahr beginnt und die auch den von Karl Renner verfassten Motivenbericht zu jener Wahlordnung enthält, nach der im Februar 1919 das erste Parlament der Republik gewählt wurde. Kelsen kritisierte die großen Verzerrungen der Verhältnismäßigkeit, welche durch das Grundmandatssystem und das Fehlen eines zweiten Ermittlungsverfahrens bei der Wahl 1919 bewirkt wurden. Auch nach dessen Einführung blieb die "Mandatsgerechtigkeit" noch fast 70 Jahre auf der Strecke, bis die Wahlreform 1992/93 ein drittes Ermittlungsverfahren mit einem "Proportional-Ausgleich" vorsah.
Kelsen und Renner waren sich mit den herrschenden politischen Strömungen in den wesentlichen Weichenstellungen des subjektiven Wahlrechts der Republik einig, die da lauteten, endlich das Frauenwahlrecht einzuführen und ein maßvolles Wahlalter vorzusehen. Die Beratungen zur Wahlordnung 1918 führten dann im Ergebnis zu einem noch niedrigeren Wahlalter, als in Renners Entwurf vorgesehen war.
Objektivität ...
Die Bundesverfassung des Jahres 1920 brachte auf dieser Ebene nur zwei substanzielle Änderungen, nämlich eine geringfügige weitere Herabsetzung des Wahlalters und eine Einschränkung der Ausschlussgründe auf gerichtliche Verurteilungen und Verfügungen. Heute ist davon nur mehr die gerichtliche Verurteilung übrig geblieben, womit Österreich - im internationalen Vergleich erstaunlich - nur sehr wenig verfassungskonforme Wahlausschließungsgründe erlaubt und damit das Wahlrecht vom Geisteszustand abkoppelt. Das subjektive Wahlrecht als politisches Recht der Wählerinnen und Wähler war indes im Jahr 1920 längst erkämpft und daher kein Novum des Bundesverfassungsgesetzes.
... der Wahlbehörden
Einigkeit bestand 1918 auch in der Bildung der Wahlbehörden, die erst 1925 Eingang in die Verfassung fanden. Die Verteilung der Sitze in den Kollegien erfolgt bis zum heutigen Tag nach der Vertretung der Parteien bei der letzten Wahl, also nach Parteienproporz. Mit dieser Zusammensetzung sollte laut Renner die größtmögliche Objektivität der Wahlbehörden ermöglicht werden, die durch ihre Zusammensetzung "verbürgt" sein sollte. Das Proporzverfahren würde es den Parteien gestatten, ihre erfahrensten Kräfte in die Wahlbehörde zu entsenden und dadurch sich selbst vor Schaden zu sichern. Renner meinte damit irrtümlich, dass damit der gesamte Wahl-vorgang dem hinterherigen Streit entzogen und für die "Reinheit" der Wahlen am besten vorgesorgt wäre.
Hans Kelsen hat mit seiner Wahlrechtskritik in vielen Punkten ins Schwarze getroffen. Das zeigen die späten Versuche des Gesetzgebers aus dem Jahr 1992, mit dem dritten Ermittlungsverfahren die Proportionalität auszugleichen und eine stärkere "Personalisierung" des Wahlrechts mit zweifacher Vorzugsstimme zu bewirken. Die Ermittlungsverfahren haben Vorteile gebracht, doch eine "echte" Personalisierung ist misslungen.
Einladung zu Fehlern
Die zahlreichen Novellen zur NRWO haben auch neue Probleme gebracht, die zuletzt wieder bei der Oktoberwahl 2006 virulent wurden. Die gleichzeitig mit der Reform 1992/93 eingeführten Regionalwahlkreise haben den Schwächen der Renner'schen Lösung nicht den Stachel genommen, sondern laden in Verbindung mit einem komplizierten Wahlkartensystem die Wahlbehörden zu Fehlern ein. Erinnert sei an Stimmzettel mit den "falschen" Vorzugsstimmenkandidaten in einem burgenländischen Regionalwahlkreis bei der Wahl 1995, wogegen der damalige Fall "Moser" in Reutte auf typisch österreichisches Obrigkeitsdenken zurückging, aber gleichwohl zur Wahlwiederholung im dortigen Wahlkreis führte.
Angesichts des Verhältniswahlsystems, bei dem eine einzige Stimme den Ausschlag für einen Mandatsübergang geben kann, haben Behördenfehler oftmals ein höchstgerichtliches Nachspiel. Auch die kasuisistischen Regeln für die Wahlbewerbung und die Parteien-sowie die Kurzbezeichnung im Wahlvorschlag führen zu Auslegungsproblemen - was einst bei den "Grünen" zwischen ALÖ und VGÖ sowie der Liste "Grünweiß Natur Erhalten" und nun trotz Änderung der NRWO bei BZÖ/FPÖ für Streit sorgte.
Wahlanfechtungen
In Österreich endet diese Auseinandersetzung immer nach vierwöchiger Anfechtungsfrist zeitgerecht bei einem zentralen Wahlgerichtshof, dem (nunmehrigen) Verfassungsgerichtshof in Wien. Der Begriff Verfassungsgerichtshof geht übrigens auf Renners Handschrift zurück. Der VfGH darf nach dem Artikel 141 Bundes-Verfassungsgesetz eine Wahl oder einen Teil davon, wie z. B. ein Ermittlungsverfahren in einem Wahlkreis oder im gesamten Bundesgebiet, nur dann für nichtig erklären und der Anfechtung Folge geben, wenn der "Fehler", das heißt die erwiesene Rechtswidrigkeit des Verfahrens Einfluss auf das Ergebnis haben konnte.
Der VfGH als Wahlgericht löste das System eines (aus Verfassungs-, Verwaltungs-und OGH-Richtern) gemischten Wahlgerichts aus 1918 ab und ist eine moderne und effiziente Schöpfung der Bundesverfassung 1920. Nur ein Nachteil haftet dieser Kontrolle im Nachhinein an: Unterlaufen den Wahlbehörden im Vorfeld der Wahlwerbung massive Fehler, dann muss die gesamte Wahl ab der Stimmabgabe wiederholt werden.
Der Autor ist ao. Professor am Institut für Staats-und Verwaltungsrecht der Juridischen Fakultät an der Universität Wien.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!