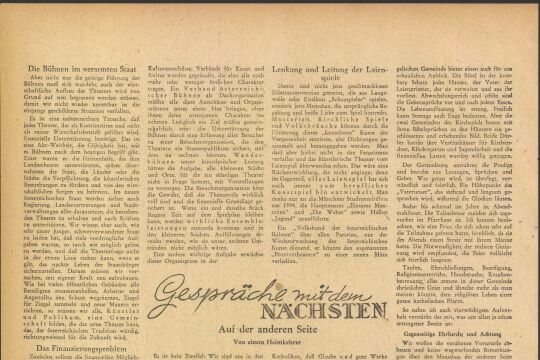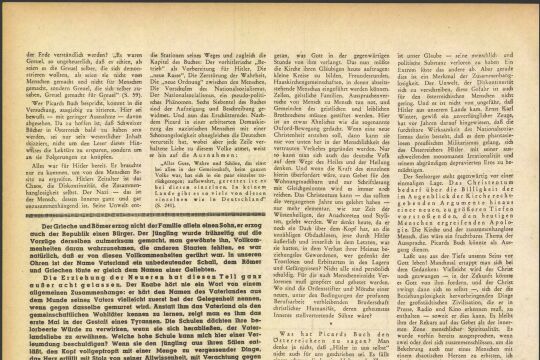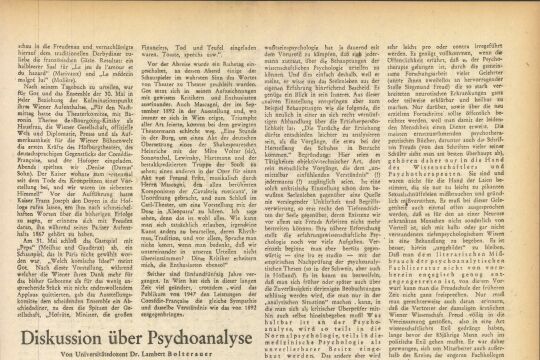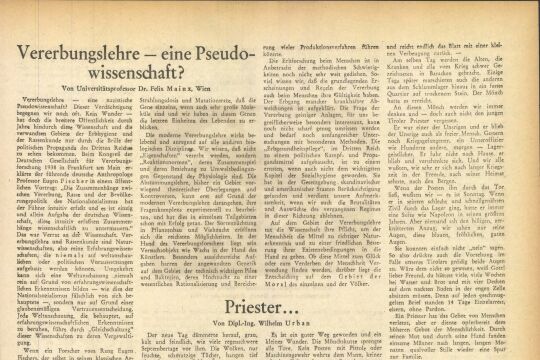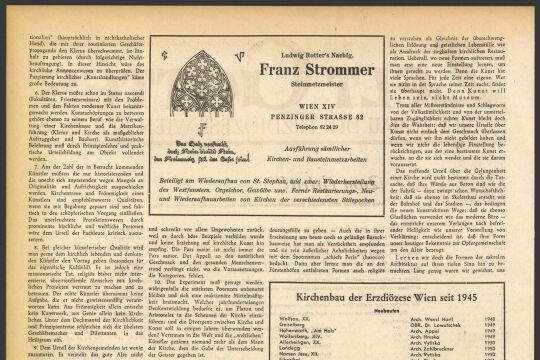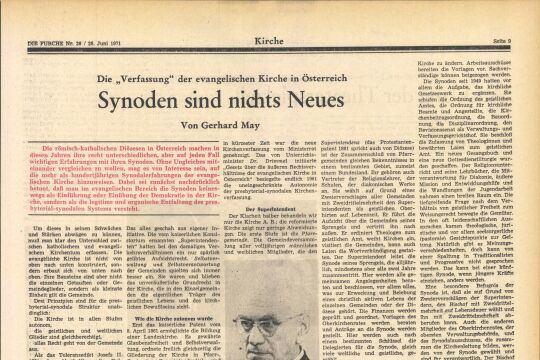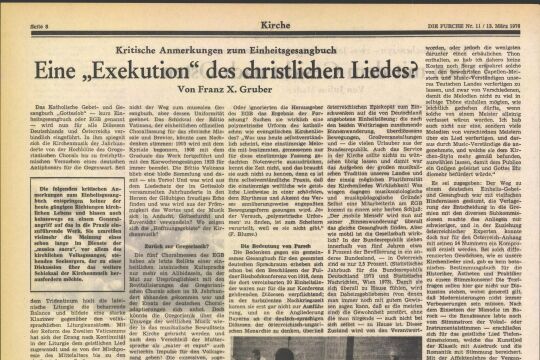Trotz der Liturgiereform des II. Vatikanums stagniert die Gottesdienstkultur: Auch der Gebrauch von "Alltagssprache" macht das Geschehen noch nicht verständlich. Die veränderte Rolle des Priesters wird ebenfalls wenig bedacht.
Die vielbejubelte Liturgiereform des Konzils hat neben Erfreulichem auch zu einer bedenklichen Stagnation der Gottesdienstkultur geführt: In den Kirchen werden die Messen zwischen gepflegter Langeweile und liturgischer Kreativhektik selten "gefeiert", sondern meist bloß "gehalten". Es wird viel geredet und wenig zugehört. Die Gemeinden sind mit ihren Seelsorgern gemeinsam alt geworden. Junge Menschen werden gelegentlich gesichtet. Die folgenden fragmentarischen Überlegungen kreisen um drei Kernpunkte der damaligen Erneuerung.
I. Die (Volks-)Sprache
Durch die Einführung der Landessprache kam die Fiktion auf, nun würde man alles verstehen. Im akustischen Sinn mag das stimmen. Doch in der Überfülle des Gesagten bleibt weniger hängen als je zuvor. Die offiziellen Texte der Liturgie atmen die dürre Spiritualität theologischer Schreibtischprodukte. Selbstgemachte Gebete hingegen gelingen nur selten sprachmächtig oder gar poetisch. Dagegen sind allzu subjektive und bis zur Peinlichkeit modisch-frömmelnde Herzensergießungen weithin beliebt. Die Predigt ist allzu häufig ein unverbindliches Wort zum Sonntag mit pseudoaktuellen Anleihen bei Zeitgeist oder Fernsehprogramm. Die Predigt als kompetente und den Menschen berührende Schriftauslegung hat Seltenheitswert.
Die Meinung, eine bloße Übersetzung in die Alltagssprache der Gläubigen würde das Geschehen schon verständlich und zugleich eindringlich machen, war eine spätaufklärerische Fiktion. Das viele "Gerede und Getue" macht die heutigen Gottesdienste eher belanglos und wortlastig. Das alte Latein - ohne es wieder einführen zu wollen - hatte hingegen eine deutliche Symbolik im Hinblick auf das Unverfügbare des Göttlichen und bewirkte eine disziplinierende Sparsamkeit für den zelebrierenden Kleriker. Die vielen betulichen Einschübe und Ausweitungen müssten in lateinischer Sprache unterbleiben. In vielen Gottesdiensten ersticken die geschwätzigen Wucherungen wie ein liturgischer Sprachkrebs das kultische Geschehen.
Wahrscheinlich lebt jeder gute Gottesdienst, wenn er nicht eine bloße Sprech-Sing-Stunde sein will, von der geglückten Balance von Sprache und Zeichen, von Wort und Symbol. Aus dieser Balance sind unsere Liturgien seit dem letzten Konzil gekippt: wortreich und symbolarm. Und all das in einer sprachlich kaputtgeschwätzten Kultur. Dass unsere Gottesdienste allzu oft in diese vom Zeitgeist gegrabene Grube plumpsen, macht es gerade kritischen und intellektuellen Christen schwer, dort redlich froh zu werden.
II. Der (Volks-)Altar
Natürlich war die Errichtung des Volksaltares mit Blick zur Gemeinde eine richtige Entscheidung. Doch dabei wurde kaum bedacht, dass sich damit die Rolle des Priesters grundlegend verändert. Aus dem einsam im Angesicht Gottes stellvertretend für die Gemeinde betenden Zelebranten - so die symbolische Gewichtung früher - wurde der gemeinsam mit seiner Gemeinde feiernde Vorsteher. In der ersten Rolle war es durchaus sinnvoll, den Text lateinisch, leise und abgewandt vom Volk zu rezitieren. Seither ist das Sprechen des Priesters aber ein kommunikativer Akt: Im Blickkontakt in teilweise freier Rede und authentischer Gestalt und Gestik zu kommunizieren, ist etwas völlig anderes, als das bisherige "Zelebrieren".
Manche Priester erkennen das und wandeln sich zum leutseligen Sakral-Entertainer, der seine Fans durch die poppige Kultshow führt, gewürzt mit spiritueller Ermunterung und launigen Bemerkungen. Was sich hier wie eine Karikatur modischer Mess-Events liest, bringt jedoch die Sache auf den Punkt: Der Priester der erneuerten Liturgie ist ein Kommunikator. Wenn er nur bescheiden vor sich hin zelebriert, so wird das Geschehen bloß einen geringen Ausstrahlungskreis entfalten. Das mag fromm und ehrlich sein. Doch die erneuerte Liturgie hatte einen Anspruch darüber hinaus. Gerade der gegenwärtige Papst demonstriert das mit großer Eindringlichkeit: Der Vorsteher der Liturgie braucht eine Ausstrahlung, die man nur teilweise erlernen und einüben kann.
III. Kunst und Musik
Letztlich geht es um etwas, das man "Aura" nennen könnte - nicht in einem esoterischen Sinn, sondern in der alltäglich erfahrbaren Bedeutung einer Atmosphäre, eines Klimas, einer Ausstrahlung. Das beginnt bereits beim Ort: Es ist auffallend, dass für Trauungen, Taufen oder an höheren Feiertagen bestimmte Kirchen bevorzugt werden. Der Raum, die Architektur, Einrichtung und Ausstattung, die Gestaltung, Bilder und der Schmuck einerseits - Riten und Gesten, Sprache und Gesang, ja sogar das Sozialverhalten von Klerus, Mitwirkenden und Gemeinde andererseits: all das schafft eine Aura von Feierlichkeit und Bedeutsamkeit, die einen Gottesdienst über die korrekte Liturgie und die gescheite Predigt hinaus eindringlich und erlebenswert machen kann. Doch wie oft gelingt das?
Ohne auf die überaus schwierigen Fragen nach Architektur und Bild einzugehen, muss wenigstens zur Musik gesagt werden, dass sie - vielleicht mehr als andere Künste - das Herz des Menschen erreichen kann. Deshalb ist es schwer zu verstehen, dass gerade ihr hierzulande so wenig Bedeutung zugemessen wird. Die musische Dürftigkeit vieler Sonntagsmessen ist Merkmal einer rundum armseligen Feierkultur. Dabei geht es nicht um die Aufführung lateinischer Klassikermessen, sondern eher um die Beliebigkeit und die geringe Sorgfalt und Vorbereitung der Musik im Gemeindegottesdienst am Sonntag. Um es thesenhaft zu sagen: Musik ist nicht Ornament der Liturgie - sie selbst ist Liturgie.
Musik ist Sprache, Klangrede. Daher gilt auch für sie: Die meisten Gläubigen kommen nicht in die Kirche, um dort dieselbe Rede und dieselbe Musik zu hören wie im Alltagsgetriebe der Amüsierindustrie. Belangloses Geklimper (ob Orgel oder Gitarre) und belangloses Geplauder (ob Gebet oder Predigt) hat man in den Endlosschleifen der Rundfunksender und Shoppingmalls gratis und ohne Anstrengung - dazu muss man nicht in die Kirche gehen. Zeitgemäßer Gottesdienst wird nicht gelingen, wenn man sich billig und dem Banalen gemein macht, sondern vielmehr in einer sorgfältig vorbereiteten und authentisch gefeierten Kontrastkultur lebendiger Gemeinden. Es gibt ein unscheinbares Kriterium für einen redlichen und schlichten Gottesdienst, der sich bewusst absetzt vom pausenlosen Getue, Getön und Gerede unserer Tage: die Stille.
Ein Gottesdienst, der nicht an einigen Stellen innehält und still wird, eine Messe, die kein Schweigen kennt, verhindert, was bewirkt werden sollte: dass der Mensch zu sich und zu Gott findet.
Der Autor ist Akademiker- und Künstlerseelsorger in Linz und lehrt am Bruckner-Konservatorium. Sein jüngstes Buch: "Ein großer Gesang - Musik in Religion und Gottesdienst" (Styria Verlag, Graz 2002).
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!