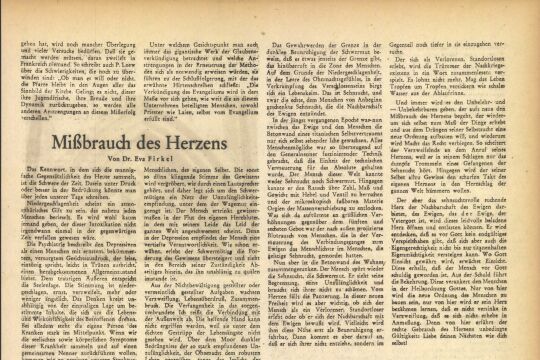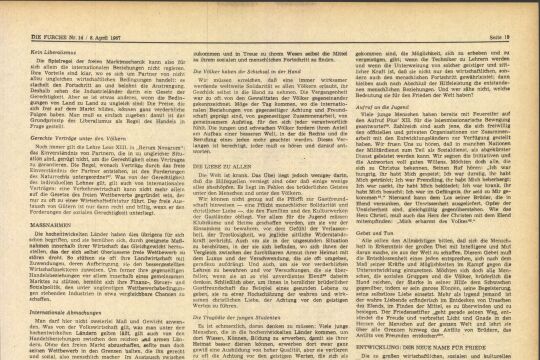Schokolade in der Schubhaft/Seelsorge in der Schubhaft: "Hier gibt es keine Hoffnung!"
Das erste Gespräch zwischen uns SeelsorgerInnen unterschiedlicher Kirchen mit Vertretern der Polizei ist mir im Gedächtnis geblieben. Wir warteten auf den Präsidenten der Präsidialabteilung - oder so ähnlich, man erhob sich zumindest ehrfürchtig, als er erschien. Mit wenig Geschick trugen wir unsere Bitte vor, regelmäßig Besuche bei Festgehaltenen durchführen zu dürfen.
Der Herr Präsidialabteilungspräsident (oder so ähnlich) konnte mit unserem Ansinnen herzlich wenig anfangen. Es abzulehnen wäre in der heiklen Situation damals (zum ersten Mal drang die Schubhaftpraxis in Salzburg massiv an die Öffentlichkeit) politisch nicht klug gewesen. Und immerhin - so kundig waren wir schon - gab es das grundsätzliche Recht eines Inhaftierten auf Seelsorge. Er fragte, was wir eigentlich bezwecken wollen und hatte sichtlich Angst, daß wir unseren Einlaß ins Polizeigefangenenhaus mißbrauchen und allzu viel "hinaus"tragen würden. Bis zu diesem Zeitpunkt (Sommer 1994) hatten nur wenige Rechtsanwälte und Mitarbeiter von amnesty international sehr limitierten Zutritt ins Polizeigefangenenhaus. Angst vor einer sozialen Kontrolle von außen war vorhanden.
Die Frage, was wir eigentlich wollten, war nicht leicht zu beantworten. Wir sprachen von Hoffnung. Der Präsidialchef (oder so ...) erwiderte heftig: Hier gebe es keine Hoffnung und es sei äußerst bedenklich und inhuman, Menschen ohne jegliche konkrete Aussicht, Hoffnung zu geben. Zaghaft versuchten wir zu erklären, daß für uns Hoffnung mehr bedeutet, als konkrete Aussichten. Ein zynisches Lächeln huschte über seine Lippen. Er glaube an nichts, aber wenn wir glauben ... Er beschwor uns, unserer Rolle als Seelsorger ja treu zu bleiben und den Inhaftierten nur ein "wenig Seelentrost" zu spenden. Jede konkrete Hilfeleistung sei ausgeschlossen.
Die Frage nach der Hoffnung kommt mir jetzt noch in den Sinn. Und nicht selten steigen in mir Zweifel hoch. Was soll ich wie sagen, damit es nicht wie billiger Trost klingt? Wie gehe ich mit meinen Gefühlen um, wenn ein Familienvater vor mir in Tränen ausbricht, weil er von Frau und Kindern getrennt irgendwohin abgeschoben wird? Was soll ich dem jungen Rumänen erwidern, der mir unumwunden zu verstehen gibt, daß das Gefängnis hier immer noch besser ist als der Hunger zu Hause? Die Besuche bei diesen Menschen ohne Boden für ihre Wurzeln setzen mir zu. Und jetzt, da meine Rolle wirklich die geworden ist, die sich der Herr Präsidialpräsidentenchef (oder so ...) gewünscht hat, und der Evangelische Flüchtlingsdienst die soziale Hilfestellung der Schubhäftlinge übernommen hat, gilt es erst recht, meine Gefühle der Hilflosigkeit in der Begegnung mit dem Elend auszuhalten. Warum tun wir uns das an?
Vielleicht liegt gerade im kargen Angebot unserer "Dienstleistung" die Hoffnung, um die es geht: Wir kommen mit leeren Händen, ohne konkrete Aussichten. Wir kommen, "nur" um einen Augenblick zu ermöglichen, der in dieser Umgebung rar ist: einen Augenblick der Begegnung. Und manch einer konnte ein Gefühl ausdrücken, das sich vielleicht in mehreren regt: Da sind zwei Menschen gekommen, "nur" meinetwegen. Endlich ein Wahrnehmen auf Augenhöhe, ein Mitempfinden, ein Ernstnehmen, ein Da-sein, das Würde zurückgibt.
Daß diese kurzen Begegnungen nicht Augenblicke allein zwischen Menschen sind, sondern daß diese in ihrer menschlichen Echtheit verweisen auf einen, der verschieden benannt oder auch verschwiegen wird, drückt das Gebet mit der Berührung an Händen und Stirn aus, das die meisten Inhaftierten wünschen. Das wohl - in allem Zweifel und im heftigen Gefühl der Ohnmacht - ist letztlich die Hoffnung, die mich in das Polizeigefangenenhaus hineinzieht: Einer sieht - der Eine sieht. Eine tatsächliche Hoffnung, und hier wird sie konkret.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!